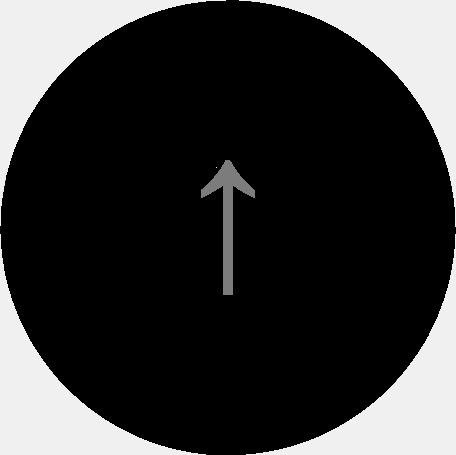Am Karfreitag vor 300 Jahren wurde Bachs erste oratorische Passion uraufgeführt. Er bezieht sich darin überwiegend auf den Leidensbericht des Johannes, der bis heute immer wieder zu Kontroversen führt. Ein Essay zur Passionsgeschichte Jesu …
WeiterlesenArchiv des Autors: Bernd Fessler
Violine solo
Die Violine hat ihren Ursprung im Alpenraum. Seit Jahrhunderten werden hier Streichinstrumente hergestellt. Eine Spurensuche …
„Ein modernes Instrument ist wie ein weißer Canvas, das heißt eigentlich bereitwillig einem folgend, macht alles wie man es will, ist laut, ist da, ist präsent. Aber hat es Mysterium? Nein.“
Die Violinistin Anne-Sophie Mutter in „Stradivari – Mythos und Markt“ (2023)
Ouvertüre
Als sich der schwedische Komponist Ludwig Göransson das erste Mal mit dem Regisseur Christopher Nolan wegen dem Soundtrack für dessen Film Oppenheimer zusammenkommt, sagte Nolan zu ihm nur: „I don’t really know where we’re going to go with this, but I think you should experiment with the violin.“ Die Violine sollte also das Fundament des Films bilden, und Göransson war damit durchaus einverstanden: „Ich hatte noch nie zuvor ein solches Drehbuch gelesen, das dich direkt in den Verstand von Oppenheimer versetzt. Du siehst die Welt durch seine Augen. Oppenheimer ist ein Genie, aber er verbirgt einen Dämonen“, zitiert ihn Dominik Lippe in einem Artikel in diesem Zusammenhang. Die Violine könne dem gerecht werden: „There`s so much in the performance of the violin. Within a second you can go from something beautiful to something completely horrifiying“, kaum ein anderes Instrument habe solche klanglichen Möglichkeiten.
In Oppenheimer verbindet Nolan früh im Film Musik und Mathematik: „Lernen Sie theoretisch zu denken“, erklärt der Physiker Niels Bohr dem jungen Oppenheimer bei dessen erster Begegnung, „Algebra ist vergleichbar mit einer Partitur. Die Frage ist nicht, können Sie Noten lesen, sondern können Sie sie hören?“ Danach setzt eine Kettenreaktion in der Vorstellung Oppenheimers ein, zu der Göransson „Can You Hear The Music“ komponiert hat. Lippe bemerkt dazu: „Es vollzieht sich ein Auf und ab des Gedankenprozesses, zusammengeschnitten mit Bildern von Funken, Sternen und Elementarteilchen. `Can you hear the music´ bringt mit seinen 21 Tempowechseln das Entstehen und Vergehen, Fussion und Fission auf den Punkt.“
Göransson selbst hielt dieses Stück zunächst für unspielbar: vierzig Violinisten und Violinistinnen, die zu den Bildern der rotierenden Atome langsam in eine atemberaubende Raserei geraten … Er wollte das zunächst im Studio einfach Takt für Takt aufnehmen – wurde dann aber von seiner Frau, der Violinistin Serena McKinney, dazu überredet es doch in einem Fort zu versuchen. Nach drei Tagen stand die Aufnahme schließlich: „Am Ende haben wir Musik aufgenommen, die das Übertraf, was ich für menschlich möglich gehalten habe“, zitiert ihn Lippe.
Die Szene zwischen Niels Bohr und Robert J. Oppenheimer, für die Göransson „Can You Hear The Music“ komponierte, hat zwar stattgefunden, aber nicht so, wie sie von Nolan gezeigt wird. In ihrer Biographie „J. Robert Oppenheimer“ (2010) schreiben Kai Bird und Martin J. Sherwin: „Zur ersten persönlichen Begegnung zwischen Oppenheimer und Bohr kam es in [Ernest] Rutherfords Büro. Als Robert hereinkam, stand Letzerer von seinem Schreibtisch auf machte Bohr mit seinem Studenten bekannt. `Ich stecke in Schwierigkeiten.´ – `Sind diese Schwierigkeiten mathematischer oder physikalischer Art?´ – `Das weiß ich nicht.´ Darauf sagt Bohr: `Das ist nicht gut.´ Bohr erinnerte sich lebhaft an diese Begegnung – Oppenheimer habe ungewöhnlich jung gewirkt, doch nachdem er gegangen sei, habe ihm Rutherford gesagt, er erwarte viel von diesem jungen Mann. / `Sind die Schwierigkeiten mathematischer oder physikalischer Art?´ – Jahre später erzählte Oppenheimer, wie bedeutsam diese Frage für ihn war: `Sie führte mich darauf, wie sehr ich mich in formale Fragen verrannte ohne einen Schritt zurück zu tun und mich darum zu kümmern, was sie mit der physikalischen Seite des Problems zu tun hatten.´ Später sah er, dass sich einige Physiker zur Beschreibung der Natur beinahe ausschließlich der Mathematik und ihrer Sprache bedienen. Die verbale Beschreibung sähen sie nur als `Zugeständnis an die Verständlichkeit, sie ist nur pädagogisch gemeint. Ich glaube, dass triff besonders auf [den britischen Physiker Paul] Dirac zu. Seine Einfälle sind am Anfang nicht verbaler, sondern algebraischer Natur.´ Ein Physiker wie Bohr dagegen betrachte `die Mathematik, wie Dirac Worte betrachtet, nämlich als einen Weg, sich verständlich zu machen …“
Hannah Arendt erkennt hierin – in diesem Verhältnis von Algebra und Sprache – nun ein grundlegendes Problem der Moderne. In „Vita activa“ (1958) schreibt sie: „Es zeigt sich nämlich, daß die `Wahrheiten´ des modernen wissenschaftlichen Weltbilds, die mathematisch beweisbar und technisch demonstrierbar sind, sich auf keine Weise mehr sprachlich oder gedanklich darstellen lassen. Sobald man versucht, diese `Wahrheiten´ in Begriffe zu fassen und in einem sprechend-aussagenden Zusammenhang anschaulich zu machen, kommt ein Unsinn heraus, der `vielleicht nicht ganz so unsinnig ist wie ein `dreieckiger Kreis´, aber erheblich unsinniger als ein `geflügelter Löwe´. (Erwin Schrödinger). Wir wissen noch nicht, ob dies endgültig ist. Es könnte immerhin sein, daß es für erdgebundene Wesen, die handeln, als seien sie im Weltall beheimatet, auf immer unmöglich ist, die Dinge, die sie solcherweise tun, auch zu verstehen, d. h. denkend über sie zu sprechen. Sollte sich das bewahrheiten, so würde es heißen, daß unsere Gehirnstruktur, d. h. die physisch-materielle Bedingung menschlichen Denkens, uns hindert, die Dinge, die wir tun, gedanklich nachzuvollziehen. – woraus in der Tat folgen würde, daß uns gar nichts anderes übrigbleibt, als nun auch Maschinen zu ersinnen, die uns das Denken und Sprechen abnehmen.“
Für Arendt ist klar: „die Wissenschaften reden heute in einer mathematischen Symbolsprache, die ursprünglich nur als Abkürzung für Gesprochenes gemeint war, sich aber hiervon längst emanzipiert hat und aus Formeln besteht, die sich auf keine Weise zurück in Gesprochenes verwandeln lassen. Die Wissenschaftler leben also bereits in einer sprach-losen Welt, aus der sie qua Wissenschaftler nicht mehr herausfinden. Und dieser Tatbestand muß, was politische Urteilfähigkeit betrifft, ein gewisses Mißtrauen erregen. Was dagegenspricht, sich in Fragen, die menschliche Angelegenheiten angehen, auf Wissenschaftler qua Wissenschaftler zu verlassen, ist nicht, daß sie sich bereitfanden, die Atombombe herzustellen, bzw. daß sie naiv genug waren zu meinen, man würde sich um ihre Ratschläge kümmern (…); viel schwerwiegender ist, daß sie sich überhaupt in einer Welt bewegen, in der die Sprache ihre Macht verloren hat, die der Sprache nicht mächtig ist. Denn was immer Menschen tun, erkennen, erfahren oder wissen, wird sinnvoll nur in dem Maß, in dem darüber gesprochen werden kann.“
Es sind diese Gedanken, die Arendt durch den Kopf gehen, als im Jahr 1962, in den Tagen der Kubakrise, als die Welt am Rande eines Atomkriegs stand, auf der Straße ihrem Studenten Richard Sennett begegnete. Und die „Raketenkrise“, so erinnert sich Sennett, „hatte sie wie uns alle erschüttert, sie aber auch in ihrer Überzeugung bestärkt“, wie er in „Handwerk“ (2008) schreibt. In „Vita activa“ hatte Arendt nur vier Jahre zuvor dargelegt, so rekapituliert Sennett, „dass der Ingenieur (…) nicht Herr im eigenen Hause sei. Die Politik stehe über der physischen Arbeit und müsse ihr Leitlinien vorgeben. Zu dieser Überzeugung war sie gelangt, als das Los-Alamos-Projekt 1945 die erste Atombombe entwickelte. (…) Arendts Furcht vor selbstzerstörerischen materiellen Erfindungen reicht in der westlichen Kultur zurück bis zum Mythos der Pandora. (…) Mit der Weiterentwicklung ihrer Kultur erkannten die Griechen in Pandora zunehmend ein Element ihres eigenen Wesens: Die von Menschen gemachten Dinge, in denen die Kultur gründet, bargen die ständige Gefahr der Selbstzerstörung. / Etwas nahezu Unschuldiges im Menschen kann diese Gefahr heraufbeschwören: Menschen lassen sich von Staunen, Erregung und Neugier verführen und schaffen so die Illusion, das Öffnen der Büchse sei ein neutraler Akt. Im Blick auf die erste Massenvernichtungswaffe hätte Arendt auch eine Tagebucheintragung von Robert Oppenheimer zitieren können, der das Los-Alamos-Projekt geleitet hatte. Darin schreibt Oppenheimer wie zur Entschuldigung: `Wenn man etwas technisch Verlockendes sieht, macht man sich an die Arbeit und fragt sich erst später, wenn man technisch erfolgreich war, wie man damit umgehen soll. So war es auch bei der Atombombe.´ (…) Im antiken Mythos waren die aus Pandoras Büchse dringenden Schrecken nicht die Schuld des Menschen. Sie hatten ihre Ursache im Zorn der Götter. In einem stärker säkularisierten Zeitalter ist die Angst vor Pandora Anlass zu größter Verstörung: Bei den Erfindern der Atombomben mischt sich Neugier mit Schuld. (…) In seinem Tagebuch erinnerte Oppenheimer an die Worte des indischen Gottes Krischna: `Ich bin der Tod, der Weltzerstörer.´ Fachleute, die sich vor ihrem eigenen Fachwissen fürchten: Wie sollen wir mit diesem schrecklichen Paradoxon umgehen?“
Oppenheimer wusste nicht, wie er mit dem, was er entfesselt hatte, umgehen sollte. Bei seinem Abschied am 2. November 1945 sagte er: „Es ist gut, nun die denkbar größte Kraft zur Kontrolle der Welt an die ganze Menschheit zu übergeben, damit sie nach ihren Erkenntnissen und Werten damit verfährt.“ Damit wird, wie Sennett bemerkt, „das Werk des Schöpfers zu einem öffentlichen Problem“ – und obwohl Arendt, wie Sennett vermutet, „nicht viel von Physik verstand, nahm sie Oppenheimers Herausforderung an: Sollte also die Öffentlichkeit sich dem Problem stellen. Sie besaß eine robuste Zuversicht, dass die Öffentlichkeit die materiellen Bedingungen ihres Lebens verstehen und politisches Handeln den Willen der Menschheit festigen konnte (…) In The Human Condition [Vita acitva], erschienen 1958, stellt sie heraus, wie wichtig es ist, dass die Menschen offen und frei miteinander sprechen. Sie schreibt: `Sprechen und Handeln … sind die Modi, in denen sich das Menschsein selbst offenbart.´“
Dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen – Richard Sennett aber ist nicht damit einverstanden, dass Arendt hier zwischen dem Handelnden und dem Denkenden unterscheidet. Für Arendt ist Oppenheimer ein geistloser Techniker, der Arbeit als Selbstzweck betrachtet und insofern handelt, ohne an die gesellschaftlichen Folgen seines Tuns zu denken. Das werde, so Sennett, dem Handwerker als praktisch tätigem Menschen nicht gerecht: „Bei jedem guten Handwerker stehen praktisches Handeln und Denken in einem ständigen Dialog. Durch diesen Dialog entwickeln sich dauerhafte Gewohnheiten, und diese Gewohnheiten führen zu seinem ständigen Wechsel zwischen dem Lösen und dem Finden von Problemen. Solch ein Verhältnis zwischen Hand und Kopf findet sich in scheinbar so unterschiedlichen Bereichen wie Maurern … oder dem Cellospiel. Die Entwicklung handwerklichen Könnens hat nichts Unausweichliches, wie auch die Technik als solche nichts geistlos Mechanisches besitzt“, schreibt er.
Für Sennet ist klar, dass es „(d)er westlichen Zivilisation tiefgründige Probleme bereitet (hat), Kopf und Hand miteinander zu verbinden“. Wir stehen aber aber, so Sennett, im Bereich der natürlichen Ressourcen und des Klimawandels „vor eine phyischen Krise, die weitgehend von uns Menschen gemacht ist. Aus dem Pandora-Mythos wird damit ein ganz profanes Symbol der Selbstzerstörung. Wenn wir diese physische Krise überwinden wollen, müssen wir andere Dinge herstellen als bisher und sie auf andere Weise nutzen. (…) Heute verwenden wir den Ausdruck „Nachhaltigkeit“ zur Kennzeichnung solch eines handwerklichen Könnens, und der Begriff trägt einiges im Gepäck. „Nachhaltigkeit“ meint, in größerem Einklang mit der Natur zu leben (…) die Herstellung eines Gleichgewichts zwischen uns und den Ressourcen der Erde, ein Bild des Ausgleichs und der Versöhnung. (…) Der Traum, in Frieden und Gleichgewicht mit der Welt zu leben, verleitet uns meines Erachtens, den Ausweg in einer Idealisierung der Natur zu suchen, statt uns der von uns selbst herbeigeführten Selbstzerstörung zu stellen. (…) Der Rückzug auf spirituelle Werte dürfte beim Umgang mit Pandora kaum helfen. Die Natur ist möglicherweise ein besserer Führer, sofern wir unsere eigene Arbeit als Teil der Natur begreifen.“
Füssen und der Lautenbau
Die Violine hat ihren Ursprung in den Alpen, das heißt seit Jahrhunderten werden im Alpenraum Streichinstrumente hergestellt. Auch in dem unscheinbaren Städtchen Füssen im Allgäu, direkt bei Schloss Neuschwanstein am Fuß der Alpen gelegen, etwa zwanzig Kilometer nordöstlich der Zugspitze. Nur etwa 2.000 Menschen lebten hier um 1600, und dennoch gilt Füssen als Wiege des Lauten- und des sich später daraus entwickelnden Geigenbaus: Hunderte von Lauten- und Geigenbauern sind über die Jahrhunderte von hier nach ganz Europa emigriert und haben den Instrumentenbau und -handel über den ganzen Kontinent maßgeblich beeinflusst, zeitweise sogar dominiert.
Dafür gibt es sicherlich mehrere Gründe, ein entscheidender aber dürfte insbesondere auch in der Armut der Menschen gelegen haben. Denn grundsätzlich ist der Boden in der Alpenregion an vielen Orten karg oder das Gelände zu steil und bergig, um hier großflächig Nutzpflanzen anbauen zu können. Viehwirtschaft war nur im Rahmen einer Alpwirtschaft möglich, hinzu kommt, dass die Winter oft lang und hart waren. Landwirtschaft war insofern also mühsam und gerade für kleine Bauern war es schwierig, ausschließlich davon zu leben. Viele von ihnen mussten entweder auswandern oder sich nach anderen Erwerbsmöglichkeiten umsehen.
Wie überall im Alpenraum hat sich so auch in der Region um Füssen die Holzwirtschaft entwickelt. Kräftige Männer verbrachten insbesondere die Sommermonate damit, in die Alpen zu wandern und von den Bergwäldern dort das Holz der Fichten, Tannen, Lärchen oder Eiben ins Flachland zu bringen. Sie nutzten dazu den damals befahrbaren Lechfluss, indem sie die Baumstämme zusammenbanden und sie auf dem Fluss über Füssen nach Augsburg flößten.
Schon seit jeher war das Holz aus den höheren Lagen der Alpen besonders wertvoll, da die Bäume hier aufgrund der Umweltbedingungen langsamer wachsen und somit dichteres Holz bildeten, das insofern besonders strapazierfähig und stabil waren. Hauptsächlich aus dicht gewachsenen Nadelhölzern wurden in Füssen schon im 15. Jahrhundert Saiteninstrumente wie Lauten, Fiedeln und Violen hergestellt, und 1562 dann auch die erste Lautenmacherzunft Europas gegründet.
Wegen seiner besonderen Resonanzfähigkeit für den Instrumentenbau gebraucht wurde vor allem das Holz von Fichten und Ahorn, hinzu kommt Birnenholz. Bevorzugt verwendet wurde langsam gewachsenes Fichtenholz, das auf mineralstoffarmen Böden gewachsen ist – wie eben auf den Steilhängen des Alpengebirges. Die Jahresringe haben sich hier in sehr engen Abständen ausgebildet. Das gilt insbesondere für die frühe Neuzeit, als das Klima kühl war, weshalb die Bäume langsam wuchsen und der Holzzuwachs entsprechend gering war. Man spricht in diesem Zusammenhang auch von der „Kleinen Eiszeit“.
Erstmals verwendet wurde dieser Begriff Ende der 1930er Jahre vom amerikanischen Glaziologen Francois Matthes (1875-1949), der die Gletschervorstöße in Nordamerika infolge der Abkühlung des Klimas nach der Warmzeit des Mittelalters untersuchte. Ihm zufolge gehen die meisten der noch heute existierenden Gletscher des nordamerikanischen Kontinents nicht auf die letzte Große Eiszeit zurück, sondern entstanden erst wesentlich später, nämlich ab dem 13. Jahrhundert. Entsprechend nannte er die Zeit zwischen dem 13. und 19. Jahrhundert, als es weltweit, auch in den Alpen, zu großen Gletschervorstößen kam, auch „the little ice age“. Dieser Begriff wurde dann von dem schwedischen Wirtschaftshistoriker Gustaf Utterström (1911-1985) aufgegriffen, der damit versuchte, die Klimaverschlechterung in Skandinavien im 16. und 17. Jahrhundert zu erklären. Utterström wandte sich damit gegen den von dem Soziologen Émile Durkheim (1858-1917) formulierten Grundsatz, Soziales nur durch Soziales zu erklären, und verwies stattdessen – wie vor ihm bereits Montesquieu – darauf, dass es auch externe Faktoren gebe, die das Leben der Menschen, deren Lebensform, beeinflussen – allen voran das Klima.
Nun hat man es bei der Kleinen Eiszeit allerdings nicht mit einer konstanten klimatischen Abkühlung zu tun, sondern mit einer vorherrschenden Tendenz, wie Wolfgang Behringer in „Kulturgeschichte des Klimas“ (2007) schreibt, allerdings sei für die Jahrzehnte ab 1563 im Alpenraum „ein deutlicher Rückgang der durchschnittlichen Temperaturen um etwa 2 Grad Celsius zu beobachten: Hier haben wir es mit einem der typischen Abkühlungsereignisse der Kleinen Eiszeit zu tun“, wobei die Kälte, die langen Winter, der viele Schnee, das dauerhafte Eiss und das Gletscherwachstum auch von den Zeitgenossen wahrgenommen wurden. Behringer schreibt in diesem Zusammenhang: „Lokale Chronisten stellten durchaus längerfristige Vergleiche an, und Prediger nutzten die ungeheuren Schneemassen für ihre geistlichen Ermahnungen. (…) Das Gletscherwachstum wurde aufmerksam registriert. So wandten sich im Jahr 1601 die Bauern von Chamonix in Panik an die Regierung von Savoyen, weil der Gletscher, der heute unter dem Namen Mer de Glace bekannt ist, ständig anwachse, bereits zwei Dörfer begraben habe und gerade dabei sei, ein drittes zu zerstören.“ Auch der Füssener Färbermeister Hanns Faigele, der eine private Stadtchronik verfasste, beobachtete die Veränderungen. Über die damals häufig auftretenden Kapriolen der Natur notiert er an einem Frühjahrstag: „Am Markustag [25. April 1618] schneite es den ganzen Tag, und es herrschte eine so große Kälte, die den gefallenen Schnee hart gefrieren ließ; es war so kalt, dass mir noch am darauffolgenden Freitag das Wasser in den Tüchern am Netz in der Mange gefror.“
So unklar die mit der Kleinen Eiszeit verbundenen Veränderungen des Ökosystems insgesamt auch sind, weil weitreichendere Aufzeichnungen von Beobachtungen als jene von Hanns Faigele aus dieser Zeit nicht existieren, kann man für den hochalpinen Bereich aber dennoch konstatieren, so Behringer, „dass die Baumgrenze sank und hochgelegene Almen aufgegeben werden mussten“, je länger die Kleine Eiszeit andauerte. „In den Mittelgebirgen und in den Alpen verkleinerten sich die Möglichkeiten der Viehhaltung, weil die Almweide entfiel.“ Auch die Holzbewirtschaftung war spätestens ab der Mitte des 17. Jahrhunderts von der Abkühlung betroffen: „Längere Heizperioden waren nicht nur ein Kosten-, sondern auch ein Umweltfaktor. Der Holzbedarf stieg und führte zu Knappheit oder Auseinandersetzungen um Ressourcen. Tagebucheinträge verdeutlichen, dass jährliche Holzkäufe schon wegen des Transports teuer waren und jede Menge Arbeit und logistisches Geschick sowie Lagerfläche erforderten. Hinzu kam, dass bei großer Kälte das Holz langsamer wuchs, wie wir auch von der Dendrochronologie wissen.“ Behringer zitiert in diesem Zusammenhang einen Zeitgenossen: „Das Holz im Wald wächset auch nicht mehr wie in Vorzeiten (…). Eine gemeine Klag und Sag unter den Leuten ist, dass, wenn die Welt länger stehen sollte, es ihr endlich und in kurzer Zeit an Holz mangeln und gebrechen würde.“
Im 16. Jahrhundert aber war von diesem Mangel noch nichts zu spüren, im Gegenteil. Hochwertiges Holz gab es reichlich – und so gab es um 1600 in Füssen schon 18 bei der Innung gemeldete Lautenbauerwerkstätten, während es, zum Vergleich, in Nürnberg mit seinen 40.000 Einwohnerinnen und Einwohnern nur fünf Lautenbauer gab und in Augsburg sogar nur drei. Gerade in landwirtschaftlich unsicheren Zeiten wie dann zunehmend während der Kleinen Eiszeit bot der Instrumentenbau einen Ausweg aus der ländlichen Armut, man konnte so durchaus mit einem stabilem Einkommen rechnen. Allerdings waren so viele Werkstätten auch deutlich zu viel für ein so kleines Städtchen wie Füssen: Es gab für die zahlreichen hier ausgebildeten Handwerker einfach nicht genug Arbeitsplätze – und die Wahrscheinlichkeit war hoch, dass man sich als Geselle woanders umsehen musste: Die Zunft kontrollierte nicht nur Preis und Qualität der hergestellten Lauten, sondern bestimmte auch, wie viele Werkstätten überhaupt zugelassen wurden. Einem Lehrling war so von Anfang an klar, die Stadt nach der Ausbildung verlassen zu müssen.
Nun führt durch Füssen jedoch nicht nur der Lechfluss, sondern auch die Via Claudia Augusta, eine alte Römerstraße, die von der Adria und den Ebenen des Po über die Alpen bis zur Donau führte, und so das eigentlich unbedeutende Provinzstädtchen mit einer der wichtigsten Metropolen jener Zeit, Venedig, verband. Die geographische Lage verband Füssen insofern mit einem der bedeutendsten Märkte jener Zeit. Und so machten sich viele Füssener über die Via Claudia Augusta auf den Weg auf die Alpensüdseite, was dazu führte, dass in Norditalien und Venedig bald zwei Drittel aller Lautenbauer Füssener Abstammung waren.
Aber umgekehrt kamen Einflüsse auf diesem Weg auch aus Venedig: Im 15. und 16. Jahrhundert war Venedig nicht nur als Seemacht bedeutsam, sondern insbesondere auch kulturell, wie Philipp Bloom in „Eine italienische Reise“ (2018) schreibt, wo er sich auf die Suche nach dem Ursprung seiner Geige macht: „Die musikalische Kultur Venedigs war (…) ein Abbild seiner internationalen Handelsverbindungen. Besonders die Kultur der moslemischen Welt erreichte mit den Händlern aus Konstantinopel und der Levante hier ihren ersten europäischen Hafen. So kamen nicht nur musikalische Formen, sondern auch Instrumente aus der islamischen Tradition nach Venedig. Das vielleicht wichtigste darunter war ein besonders vielseitiges Saiteninstrument, die Oud, die in Konstantinopel und im islamischen Spanischen al oud genannt wurde und in Europa bals als lute (englisch), liuta (italienisch) oder als Laute bekannt werden sollte.“
Quellen zur Frühgeschichte des Lautenbaus in Füssen sind rar und fragmentarisch, erklärt Blom, und es ist noch nicht erforscht, wie genau das Wissen und die Expertise hier in die Voralpen gelangen konnte, sodass Füssen eine derart wichtige Position im Instrumentenbau einnehmen konnte. Ein Anhaltspunkt könnte Blom zufolge die Einbürgerung eines gewissen Jörg Wolff als „Lauter“ am 10. Oktober 1493 gewesen sein. Seine Einbürgerung ist jedenfalls „ein Hinweis darauf, wie weit die Verbindungen der kleinen Stadt gereicht haben könnten. Die spanische Übersetzung von Wolf ist Lopez, und das Datum seiner Einbürgerung, 1493, legt zumindest die Möglichkeit nahe, dass Wolff ursprünglich Jorge Lopez gewesen sein könnte, ein spanisch-jüdischer Musiker und Lautenbauer, der ein Jahr nach der spanischen Reconquista auf der Flucht ins Alpenvorland kam“, wie Blom schreibt. Zwar lässt sich nicht beweisen, „dass mit Jörg Wolff ein Stück mediterrane Expertise nach Füssen kam“, es gab allerdings „eine bekannte spanisch-jüdische Musikerfamilie namens Olmaliach oder Almaliach (wohl eine Version von El-Malech)“, die sich „nach ihrer erzwungenen Konversion Lopez (nannte). In den folgenden Jahrzehnten verließen mehrere Mitglieder dieses Musikerclans Spanien, um anderswo in Europa ein besseres Leben zu suchen.“
Al-Andalus war der arabische Name für die zwischen 711 und 1492 muslimisch beherrschten Teile der Iberischen Halbinsel. Mit ihren maurischen, christlichen und jüdischen Einflüssen war die musikalische Kultur von Al-Andalus ungeheuer vielfältig und verfeinert, „und die wenigen Instrumente, die aus dieser Periode erhalten sind, zeugen von einer raffinierten Handswerkskunst“, wie Blom schreibt. Allerdings wurden schon vor Jörg Wolff, früher im 15. Jahrhundert, Lautenmacher in der Stadt urkundlich erwähnt. Womöglich haben sie sich im Gefolge des römisch-deutschen Kaisers Maximilian I. (1459-1519) hier niedergelassen: Vielleicht war es die schöne und praktische Lage, die den Kaiser dazu bewog, „oft und gelegentlich auch mehrere Monate lang in Füssen zu residieren“. Mit ihm kamen dann auch von überall her „Musiker (…) und Handwerker in den Ort, der um diese Zeit seine größte Blüte erlebte“, wie Blom erklärt. Unter diesen Bedingungen konnten sich auf jeden Fall von Füssen aus bald ein Netzwerk für die höfische Musik und den Lautenbau über den Kontinent spannen. Unabhängig davon also, ob der Lautenmacher Jörf Wolff nun aus Al-Andalus nach Füssen kam oder nicht – vermutlich gelangte die Laute schon zu dieser Zeit über die Via Claudia Augusta von Venedig aus hierher.
Es waren die Begegnungen mit dem Orient, vor allem über Al-Andalus, aber auch über die Beziehungen Venedigs zu Konstantinopel, von denen Europa insgesamt und Füssen in der Folgezeit im Besonderen profitierte: Grundlage dafür, dass sich der Lautenbau in der Stadt etablierte, waren insofern nicht nur das wertvolle Holz aus den hiesigen Bergwäldern und der befahrbare Lechfluss als Transportweg für das Holz, sondern auch die Handelsverbindungen nach Venedig über die Via Claudia Augusta.
Die Laute
Die Araber kannten drei Lautentypen, erklärt Gabriele Braune in „Europa und der Orient 800-1900“ (1989), von denen die Knickhalslaute, die al Oud oder al-Ud, die heute noch geläufigste ist, während die Kurzhalslaute Rabab im Mittelalter verbreiteter war und die Langhalslaute al-Tunbur sich wiederum insbesondere in der osteuropäische Musikpraxis etabliert hat. Die Knickhalslaute war im persischen Raum schon seit dem dritten Jahrhundert gebräuchlich. Im siebten Jahrhundert wurde sie in Mekka eingeführt, unter der Bezeichnung Barbat (Entenbrust), nach der Form des gewölbten, birnenförmigen Resonanzkörpers. Korpus und Hals waren dabei aus einem Stück Holz gefertigt. In früher Zeit war das Instrument nur mit zwei Saiten bespannt, später mit mehr.
Die Kurzhalslauten waren auch bekannt als Kiran, Mizhar oder Muwattar. Seit etwa Ende des 8. Jahrhunderts spricht man aber auch von diesem Lautentyp nur noch als al-Ud, was auf arabisch das Holz heißt. Gemeint ist damit jenes Instrument, wie Braune ausführt, „dessen elliptischer Korpus ohne Unterbrechung in einen rechtwinklig umgeschlagenen Wirbelkasten mit seitenständigen Wirbeln übergeht und in einen sogenannten Riegelschweif ausläuft. In den Resonanzkörper sind zwei oder mehr Schalllöcher eingelassen, die Saiten werden mit einem Plektrum geschlagen.“
Seit dem 13. Jahrhundert ist eine zunehmende Europäisierung der arabischen Laute zu beobachten, das heißt auf dem Griffbrett wurden Unterteilungslinien angebracht, wie man auf zeitgenössischen Darstellungen erkennen kann, was auf die Entwicklung einer Bundeinteilung schließen läßt, wie Braune erklärt. Außerdem wird das Schallloch in dieser Zeit zentral inmitten des Resonanzkörpers platziert, der Hals des Instrumentes vom Korpus abgesetzt, der nun auch langsam eine bauchige, an der Basis abgeflachte Form bekommt.
Vom 15. bis zum 17. Jahrhundert vergrößerte man den Umfang der Saiten auf sechs. Braune schreibt in diesem Zusammenhang: „Mit Ausnahme der beiden höchsten Saiten (Chanterelle) waren alle auf dem Griffbrett liegenden Saiten paarweise angeordnet; die zweite Saite der tieferen Chöre meist in der höheren Oktave der ersten Saite gestimmt. Jedes Saitenpaar, aber auch jede selbstständige Saite wurde Chor genannt, so daß man von fünf- bis sechschörigen Lauten sprach.“ Die Vergrößerung des Tonumfangs nach der Tiefe führte im 16. Jahrhundert außerdem zur Erfindung verschiedener Basslauten, die Theorben genannt wurden oder auch Arciliuto und Chittarone.
Neben den Bass- und den Langhalslauten war die arabisch Rabab genannte Kurzhalslaute im Westen bald am gebräuchlichsten. Dieses Instrument mit birnenförmigem Korpus ist aus einem Stück Holz geschnitten und läuft in einem rechtwinkelig abgebogenen Kopf mit seitenständigen Wirbeln aus. Es unterscheidet sich aber nicht nur der Form nach von den anderen Lautentypen, denn die Rabab ist ein Saiteninstrument, das mit einem Bogen gestrichen wird. Die typische orientalische Spielhaltung bestand dabei – ähnlich wie heutzutage bei einem Chello – in einem senkrecht vor dem Körper gehaltenen Instrument, das mit einem Bogen gestrichen wird. Die Rabab war aller Wahrscheinlichkeit nach das erste Streichinstrument, das während der arabischen Herrschaft im Westen bekannt wurde, jedenfalls spricht man in spanischen Quellen, wie Braune erklärt, seit dem 12. Jahrhundert von der Rabab als Rabé (morisco), Rabel oder Raben, während sich im deutschen Sprachgebrauch des Mittelalters der Begriff Rebec durchsetzte.
Das im Hinblick auf die Herausbildung der Violine wichtigste Resultat aus dem Bekanntwerden der Rabab hierzulande war die Übernahme des Streichbogens, der in Europa bis zum 9. Jahrhundert völlig unbekannt war, bald jedoch auf allen sogenannten Chordophonen – also Saiteninstrumenten – verschiedenster Art eingesetzt wurde. Der früheste Beleg eines gestrichenen Saiteninstruments europäischer Herkunft befindet sich in einer Apokalypsenhandschrift des Beatus de Liébana, die aber erst lange nach seinem Tod um etwa 798 zwischen 920 und 930 im arabischen Spanien entstand ist. „Die Citharae dei, in früheren Beatus-Handschriften stets gezupft dargestellt, werden nun mit einem Bogen gestrichen, der in typisch orientalischer Spielweise, das senkrecht vor dem Körper gehaltene Instrument zum Klingen bringt“, wie Braune schreibt.
Im 11. Jahrhundert ging man dazu über, die Rabab immer mehr zur europäischen Violine hin zu entwickeln: Der Wirbelkasten lief flach aus, am Korpus wurden Seiteneinschnürungen angebracht, so daß man das Instrument seitlich oder schräg umhängen oder halten konnte und den Bogen so zu führen vermochte, wie es typisch für die europäische Spieltechnik wurde. Durch die Vervollkommnung der Violen und schließlich das Aufkommen der Violinen wurde der Rabab-Typus dann immer mehr in den Hintergrund gedrängt.
Von der Laute zur Violine
Der Bau von Lauten ist eine außergewöhnlich komplexe Angelegenheit, erklärt Philipp Blom: „Sie haben im Wesentlichen die Form einer halbierten Birne und bestehen aus einem halbrunden Bauch, einer flachen Decke und einem langen Hals, über den je nach Art des Instruments unterschiedlich viele Saiten laufen. Die Spannung, Länge und Anzahl der Saiten, die Stimmlage und der Kontext, in dem die Laute gespielt werden soll, bestimmen die Größe des Instruments, wie stark der Bauch gewölbt ist, wie stabil die Konstruktion sein muss und wie die Einzelteile geformt sein müssen. Das erfordert nicht nur viel Erfahrung, sondern auch ein erhebliches geometrisches Wissen, um die Form und Beschaffenheit der einzelnen Teile richtig zu berechnen.“ Ist das aber einmal geschehen, können die Einzelteile auch in Heimarbeit hergestellt werden. Und so kam es, dass die Bauern und Flößer insbesondere in den Wintermonaten die Zeit nutzten und am Herdfeuer im Akkord Gerätschaften und Instrumententeile aus Holz fertigten, um ihr mageres Einkommen aufzubessern. „Die `Lautenspäne´, die wie Orangenscheiben zugeschnitten und über Hitze gebogenen Einzelteile, aus denen der Lautenbach zusammengesetzt wird, sind relativ einfach anzufertigen“, bemerkt Blom in diesem Zusammenhang. Genau darauf spezialisierten sie sich.
Die zu Hause hergestellten Lautenspäne wurden dann entweder von Werkstätten vor Ort in Füssen zusammengebaut oder aber über die Alpen nach Venedig geschickt, wo ausgewanderte Füssener Lautenbauer, die sich dort niedergelassen hatten, sie erst zu verkaufsfertigen Instrumenten zusammen montierten. Denn eine Laute ist ein sensibles, zerbrechliches Instrument, das bereits zusammengebaut nur schwer hätte über die Alpen transportiert werden können, die damals ohnehin noch nicht jene pittoreske Landschaft waren, zu der sie dann später wurden. Noch bis ins 18. Jahrhundert waren es die montes horribilis, die schrecklichen Alpen, wie man sie in der Antike nannte. Von seiner Durchquerung der Westalpen 1666 jedenfalls berichtet der Italiener Sebastiano Locatelli: „Wie ich wünsche, dass ich Worte hätte, um die Schluchten zu beschreiben, die den armen Reisenden umgeben, das Brüllen des Wassers! Das Beängstigendste von allem war, vor uns immer größere Höhen zu sehen, die noch erstiegen werden mussten. Der Gipfel … war mit Wolken verhangen, die sich manchmal lüfteten, dann wieder miteinander rangen, heller wurden, ineinanderflossen und scheinbar gegeneinander und den Gipfel selbst in die Schlacht zogen. (…) Aber unsere Füße traten auf Pfaden, die so hoch oben waren wie die funkelnde Milchstraße selbst, und wir fürchteten jeden Moment, dass wir für unseren Wagemut bestraft und in den Abgrund stürzen würden. Nachdem wir den engen und gewundenen Wegen blind gefolgt waren (die Augen vor lauter Angst zugekniffen), und auf unsere Maultiere vertrauend, die mit diesen Bergen vertraut waren, erreichten wir endlich einen Ort, an dem Frühlingsblumen blühten.“
Mehr als zwei oder drei fertig hergestellte Instrumente gleichzeitig über die Alpen zu befördern, sei es auf dem eigenen Rücken oder auf dem der Maultiere, wäre praktisch nicht möglich gewesen, nicht zuletzt auch deshalb, weil es noch keine ausgebauten oder gar befahrbaren Wege durch das Gebirge gab – die Via Claudia Augusta war im Hochgebirge wohl nichts anderes als ein Trampelpfad. Mit vorgefertigten Lautenspänen allerdings sah die Sache völlig anders aus. Hier hielt sich das Risiko von Beschädigungen und Verlust in Grenzen, das heißt die dünnen und flachen Späne ließen sich, genau wie auch die Decken und Hälse der Lauten, „bequem und sicher flach packen und in großen Mengen“ von Füssen Richtung Venedig über die Alpen transportieren. Die Füssener Heimarbeiter konnten so zeitraubende Vorarbeiten für die Füssener Instrumentenbauer in Venedig übernehmen, die die vorgefertigten Teile nur noch zusammenbauen mussten.
Um 1570 war Lautenträger ein bekannter Beruf in Füssen. Das lag auch daran, dass bis dahin schon zahlreiche Füssener Instrumentenbauer ihre Heimat verlassen mussten. Die meisten von ihnen wählten den Weg über die Alpen, nach Italien, wohin auch der Großteil der halbfertigen Instrumente verkauft wurde und wohin sie bereits Verbindungen hatten: Füssener Lautenbauer werden in den Registern italienischer Innungen bis hinunter nach Sizilien genannt und sind in fast allen norditalienischen Städten nachweisbar, erklärt Blom, besonders aber in Venedig, das in dieser Zeit die Musikgeschichte zweifelsohne prägte. Zu ihnen gehörten so namhafte Instrumentenbauer wie Giorgio und Matteo Sellas, eigentlich Matthäus und Georg Seelos, Söhne des bekannten Mang Sellas (um 1584 geboren), die schon als zwölfjährige nach Venedig aufgebrochen sind, oder auch Zuanne Curci, der 1651 in Füssen als Hanns Kurz geboren wurde und später in Venedig in der Werkstatt des berühmten Matteo Goffriller gearbeitet hat.
Der vielleicht bekannteste Füssener Auswanderer aber dürfte Caspar Tieffenbrucker (1514-1571) gewesen sein. Er wurde in Füssen geboren und wurde hier auch ausgebildet, bevor er sich 1539 auf den Weg nach Norditalien machte, wo er seine Gesellenjahre verbrachte. Nachdem er 1544 nach Füssen zurückgekehrt war und durch Heirat des Bürgerrecht erhalten hatte, hat sich Tieffenbrucker allerdings in Lyon niedergelassen, wo er ab 1553 urkundlich nachweisbar ist. Von Lyon aus verkaufte er seine Instrumente, dessen Teile er Blom zufolge wahrscheinlich noch immer aus Füssen bezog, auf dem ganzen Kontinent. Er gilt dabei als Begründer der französischen Lautenbauschule und war wohl auch einer der ersten Geigenbauer, der dort die Violine in ihrer heutigen Gestalt herstellte, wie Blom schreibt: „Tieffenbrucker dürfte auch einer der ersten Instrumentenbauer gewesen sein, der kleine Violen herstellte, Instrumente, die der heutigen Violine sehr ähnlich sind“, auch wenn keine originalen Instrumente von ihm erhalten sind, sondern nur ein Portrait, dass ihn mit einer solchen modernen Viola zeigt. Der Stich entstand jedenfalls 1548 – also mehr als ein Jahrzehnt, bevor der Cremoneser Meister Andrea Amati (1505-1577), der heute als Vater der modernen Geige gilt, die erste noch erhaltene moderne Geige schuf (die sich heute im Metropolitan Museum of Art befindet). Dass Tieffenbrucker aber noch vor Amati Violinen herstellte, bleibt eine Vermutung.
Andrea Amati, der früheste der berühmten cremonesischen Geigenbauer, soll die elegante Form der Violine erfunden haben. In einer 1576 erstellten Auflistung der Bürger Cremonas wird seine Tätigkeit allerdings ausschließlich mit „de far instrumenti de sonar“ („Herstellung von Musikinstrumenten“) angegeben, was zumindest bezeugt, dass er zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich der einzige in Cremona ansässige Instrumentenbauer gewesen sein dürfte. Ende des Jahres 1577 verstarb Amati, dessen Begräbnis am Heiligen Abend stattfand. Seine beiden Söhne Antonio (geboren 1537/40) und Girolamo (geboren um 1550) übernahmen die Werkstatt, die aber erst unter Girolamos Sohn Nicolò Amati (1586–1684) ihren Höhepunkt erreichen sollte.
Obwohl Andrea Amatis Name zu Lebzeiten auch außerhalb Italiens ein Begriff war, sind heute nur mehr ungefähr 20 Instrumente aus seiner Werkstatt bekannt (die er unter anderem an den Hof von König Karl IX. nach Paris lieferte). Anders als heute wurden bis ins 17. Jahrhundert Violinen, Violen und Violoncelli in unterschiedlichen Größen gefertigt. Auch Amati baute neben einem kleinen Geigenmodell (Korpuslänge etwa 342 Millimeter) ebenso ein großes, das in etwa dem heute üblichen Maß entspricht (353 Millimeter). Er hat so in Stil und Größe den Standard für die Geigenbauer in seiner Nachfolge gesetzt.
Bis dahin gab es alle möglichen Arten von Streichinstrumenten, das heißt zahllose Arten von Fiedeln und mehrsaitigen Violen, von denen einige da braccia, auf Arm und Schulter liegend, und andere da gamba, zwischen den Beinen gehalten, gespielt wurden. Oft hatten diese Vorläufer der Geige sechs Saiten, manchmal sogar mehr, die in unterschiedlichen Intervallen gestimmt waren – je nach Instrumententyp und auch Region. Das aber bedeutete, dass schon eine Tagesreise weit weg alles wieder anders sein konnte, sodass sowohl Musiker als auch Kompositionen immer nur regionale Bedeutung hatten (auch wenn sich in Venedig schon früh der Notendruck durchgesetzt hat und die Lagunenstadt hierin führend war: Ottaviano Petrucci (1466-1539) entwickelte dort ein besonderes Verfahren mit beweglichen Metalltypen zum Drucken mehrstimmiger Musik – er gewissermaßen der erste Musikverleger. 1498 erhielt er von der Stadt Venedig dazu das exklusive Recht. „Das war neu“, erklärt Blom, „und nun konnte man Noten, die bisher nur handschriftlich in wenigen Exemplaren verfügbar waren, leicht verfielfältigen. Venedig wurde zum Zentrum des europäischen Notendrucks. Antonio Gardano war als Nachfolger Petruccis einer der besten und wichtigsten Notendrucker seiner Zeit.“)
Den verschiedenen Violen gegenüber hatten die nun entstandenen Violinen, Bratschen und Celli den enormen Vorteil, dass sie standardisiert waren. Blom bemerkt in diesem Zusammenhang: „Sie hatten vier Saiten, immer in denselben Quintabständen gestimmt. Wer Bratsche spielte, konnte alle Bratschen auf Anhieb spielen, und Musik, die für diese Instrumente geschrieben wurde, konnte auch in einem anderen Land problemlos gelesen und reproduziert werden. Es war ein Erfolg durch Standardisierung. Dazu kam die einfache Tatsache, dass vier Saiten, die aus Schafsdarm gedreht waren und sich bei wechselnder Temperatur und Luftfeuchtigkeit in einem ungeheizten Saal mit Publikum unweigerlich verstimmten, weniger Arbeit beim Nachstimmen bereiten und weniger verstimmte Akkorde produzieren als acht, 16 oder mehr Saiten.“
Für die Geigenbauer, die diesen Prozess, der spätestens mit Andrea Amati einsetzte, miterlebten, boten sich nun natürlich ungeahnte Möglichkeiten, denn die neuen, stets mit nur vier Saiten versehenen Streichinstrumente waren plötzlich überall gefragt. Trotz der Standardisierung verbreitete sich dabei mit den zahlreichen ausgewanderten Handwerker immer auch ihre individuelle Methode, die Instrumente zu konstruieren, ihre Ästhetik, ihre Formensprache, die am neuen Lebensort der Auswanderer oft auf lokale Traditionen und Schönheitsideale traf und entsprechend angepasst wurde. Dabei hatte die Fertigung der Instrumente schon im 16. Jahrhundert „wenig mit der romantischen Idee des authentischen und einsamen Handwerkers zu tun“, wie Blom bemerkt: „Der Füssener Lautenbauer Laux Maler, der 1552 in Bologna starb, hinterließ laut Testament 1.100 fertige Lauten sowie 127 noch nicht vollendete, Hunderte von noch unbearbeiteten Lautendecken und ein ganzes Lager voller Späne für den Korpus und voller anderer Instrumententeile und Saiten, die von Spezialisten aus Schafsdärmen hergestellt worden war. (…) Im Testament von Moisè und Magno Tieffenbrucker in Venedig erschienen 1581 sogar `335 fertige Lauten und 8 Gitarren, 150 Lautenkorpora und 60 unfertige Instrumente (…) 15.200 Eibenspäne, 2.000 Decken, 300 Stege, 600 Hälse, 160 Wirbel´. Näher konnte man im vorindustriellen Zeitalter der Produktion auf industriellem Niveau nicht kommen.“
Dreißigjähriger Krieg und Pestepidemie
Füssen war eine gut vernetzte und durch den Lauten- und Geigenbau auch wohlhabende Stadt, als 1618 der Dreißigjährige Krieg begann. Da die Stadt ohne strategische Bedeutung war, blieb sie vom Kriegsverlauf und von damit verbundenen Kampfhandlungen zunächst verschont, sieht man von der Bedrohung der Handelswege durch umherziehende und marodierende Soldaten ab. So konnten die Instrumentenbauer ihre Werkstätten also zunächst mehr oder weniger unbehelligt weiterführen – und den Handel mit ihren hergestellten Musikinstrumenten sogar noch ausbauen: 27 Laute- und Geigenbauer-Werkstätten zählte man in Füssen jedenfalls im Jahr 1623.
Dann allerdings änderte sich die Lage und der Krieg rückte immer näher heran, wie Blom schreibt: „Die unsicheren Straßen und die immer unsicherer erscheinende Zukunft trafen den Instrumentenhandel wie auch den Holzhandel. Die ersten Menschen verließen ihre Häuser und Höfe in und um Füssen im Jahr 1624, um anderswo ein besseres Leben zu finden. (…) Langsam, aber sich kam der Krieg näher und brach in den Füssener Alltag ein. Soldaten aus den verschiedensten Ländern und Gegenden marschierten durch das Land, hungrige und verlauste Flüchtlinge zogen in Kolonnen des Elends auf der Suche nach Nahrung und Unterschlupf durch die Gegend. Ganze Regionen wurden leergekauft oder geplündert, und die umherwandernden Menschen waren die idealen Überträger von ansteckenden Krankheiten.“
So kam schon 1627 die erste Pestepidemie nach Füssen. Kostete sie zunächst nur einigen Einwohner das Leben, wütete sie drei Jahre Später dann mit voller Wucht. Der Färbermeister Hanns Faigele schrieb während der Kriegsjahre eine private Stadtchronik und notierte in diesem Zusammenhang: „Am 12. November hat allhie die Bestilenz anfachen Regieren …“ Etwa die Hälfte der Füssener Bevölkerung gingen daran zugrunde – die Auswirkungen auf die Stadt waren verheerend. Was der Krieg verschonte, erledigte nun die Seuche: „Nach dem Krieg sollen noch immer 94 der 266 Häuser und Wohnungen in der Stadt unbewohnt gewesen sein“, schreibt Blom, „56 von ihnen baufällig.“ Faigele notiert über diese schreckliche Zeit: „Dieses verflossene Jar send allhie gestorben und vergraben worden Jung und Alt bei 1.600 an der Pestilenz und sonst. Gott sey in gnedig und barmherzig und uns allen.“
Mit dem Zusammenbruch der Stadt kollabierte auch der Instrumentenbau – Die Füssener hatten ihre Instrumente immer für den Export gebaut, aber die Nachfrage brach nun ein, bis kaum ein Meister von seinem Handwerk leben konnte. Außerdem traf der Schwarze Tod hat auch zahlreiche Lautenbauer. Abgesehen vom Geld fehlte es nun überall an Menschen, die das Verlorene hätten wieder aufbauen können. Faigele schreibt dazu 1635: „Von der Fruchtbarkeit dieses Jahres kann ich nichts anderes schreiben, denn es war eine recht gute fruchtbare Zeit, denn es gedieh alles wohl. Aber es gab wenige Leute, die es nützten und einbrachten.“
Und dann blieb in der zweiten Kriegshälfte auch Süddeutschland und die Regionen an Lech und Donau, Füssen selbst, nicht mehr vom Blutvergießen verschont, als sich General Tilly, oberster Heerführer der Katholischen Liga und ab 1630 auch der kaiserlichen Armee, hier gegen die Schweden in Stellung brachte, bevor er 1632 in Ingolstadt ums Leben kam. (Bertolt Brecht lässt seine „Mutter Courage“ am Begräbnis teilnehmen.) Als der Dreißigjährige Krieg 1648 dann schließlich endete, so Blom, „war Füssen, wie viele andere Städte auch, erschöpft, verarmt, teilweise zerstört, entvölkert und massiv traumatisiert“.
Nach Krieg und Pest lebten nur noch etwa 800 Menschen in Füssen. Der Holzhandel kam aufgrund der Verteuerung des alpinen Holzes praktisch zum erliegen, ohnehin aber waren die für den Lautenbau so wichtigen Lärchen, Eiben und Fichten in dieser Zeit schon beinahe abgeholzt. Auch der Markt für Musikinstrumente ist fast völlig eingebrochen – die Menschen hatten andere, existentielle Sorgen. Hinzu kam, dass sich nun auch in Venedig selbst, bis dahin immerhin „der wichtigste Abnehmer für Füssener Instrumente“, wie Blom bemerkt, die Situation gravierend änderte: Etwa 400 Jahre lang, von Anfang des 13. bis zur Mitte des 16. Jahrhunderts, beherrschte Venedig als Seemacht den Handel zwischen Orient und Okzident, es bescherte ihm ein goldenes Zeitalter. Nach der Entdeckung Amerikas im Jahr 1492 und dem Seeweg nach Indien durch den Portugiesen Vasco da Gama im Jahr 1498 sowie den verstärkten Expansionsbestrebungen des Osmanischen Reiches im östlichen Mittelmeer jedoch verlor Venedig im ab dem 16. Jahrhundert langsam seine Vormachtstellung im Orienthandel und insgesamt an Macht und Einfluss.
Ein weiterer Grund für den Niedergang von Venedig war dieselbe Katastrophe, die 1630 so viele Füssener das Leben gekostet hatte: Die Pest verbreitete sich in den Jahren von 1629 bis 1631 rapide und flächendeckend im gesamten Alpenraum und damit auch in Norditalien, nachdem deutsche Soldaten sie dort von Norden aus eingeschleppt hatte. Eine geschätzte Million Menschen kostete sie das Leben: Verona verlor fast zwei Drittel seiner Einwohner, Mailand knapp die Hälfte, und auch Venedig wurde hart getroffen. 46 000 Venezianerinnen und Venezianer wurden in hastig ausgehobenen Massengräbern beigesetzt, ein Drittel der Bevölkerung. „Für die Handelsmetropole besiegelte dieser katastrophale Verlust an Menschen, Arbeitskraft, Expertise und Kaufkraft das Ende ihrer ehemaligen Macht“, bemerkt Blom.
Venedig als Stadt der Musik
Venedig mag politisch an Macht verloren haben – musikalisch aber war die Stadt noch immer eines der tonangebenden Zentren in Europa. Gleichwohl änderte sich in dieser bewegten Zeit, als man „nicht mehr so richtig an die Dogmen und Überlieferungen der Kirche glaubte“, wie Martin Geck in „Die kürzeste Geschichte der Musik“ (2020) schreibt, auch der Musikgeschmack: Wo der Handel eine erfolgreiche bürgerliche Kaufmannsklasse entstehen ließ, sollte auch die Musik die gewonnene Freiheit ausdrücken. So verlangte der aufgeklärte Zeitgeist ungefähr ab 1600, als Ersatz nach neuen musikalischen Formen, die sich fortan an die bürgerliche Gesellschaft richten sollten – und zwar in öffentlichen Räumen wie dem Theater als einer Art Gegenpol zum adligen Palazzo und der Kirche. So entstanden in dieser Zeit mit dem Konzert und der Oper zwei neue Gattungen, die auch den Möglichkeiten der in dieser Zeit entstandenen neuen Streichorchester gerecht wurden.
Lauten sind zwar lyrische, polyphone Instrumente, mit denen auch komplexe musikalische Kompositionen (wie beispielsweise Johann Sebastian Bachs Suite in g-Moll, BWV 995 aus dem Jahr 1727) gespielt und Sänger und Sängerinnen unterstützt werden können – laut sind sie aber nicht. „Ihr zarter Klang“, stellt Blom fest, „ist ideal für einen großen Wohnraum und zur Begleitung einer Gesangsstimme. In den Gewölben einer Kirche oder im Gemurmel eines Theaters aber können sie sich kaum durchsetzen.“ Das änderte sich mit den neu entstandenen Streichinstrumenten, wie Blom schreibt: „Keine Atmosphäre, kein Sound-Effekt, den diese Instrumente nicht schaffen konnten, von flatternden Herzen zu Stürmen auf hoher See, von Vogelgesang bis zu Dudelsack und Jagdhörnern. Sogar zu Mozarts Lebzeiten hatten viele Orchester noch Lautenisten, aber es war klar, dass die Zukunft den brillanteren, facettenreicheren und raumfüllenden Klängen von Celli, Bratschen und Geigen gehörte.“
Die Oper sollte dem Streichorchester zum Durchbruch verhelfen – und Venedig war nicht nur deren Geburtsstadt, sondern auch lange danach noch immer der wichtigste Aufführungsort jener neuen musikalischen Gattung, die womöglich 1607 mit Claudio Monteverdis „L`Orfeo“ das Licht der Welt erblickte (. Monteverdi hat die „Oper“, die diesen Namen damals noch gar nicht hatte, für den Karneval in Mantua komponiert, erst 1613 kommt er als Kapellmeister nach Venedig, nach San Marco (Markusdom), wo er zunächst einen berühmten Chor mit mehr als dreißig Sängern aufbaut, bevor er schließlich als Opernkomponist reüssierte.
Claudio Monteverdi wurde 1567 in Cremona geboren, zehn Jahre vor Andrea Amatis Tod. Nach Venedig wird er berufen, nachdem er in Mantua entlassen worden ist, weil eine in Auftrag gegebene Messe missfallen hatte. So wird aus dem beruflichen Scheitern die Karriere eines der berühmtesten Musiker der Welt, der in Venedig sogar der il divino, der Göttliche, genannt wird, nicht zuletzt, weil er mit seinen Opern Venedig endgültig als Stadt der Musik etabliert: Monteverdi war es, der hier 1637 das erste Opernhaus der Welt, das Teatro San Cassiano, gründete. Es war das erste öffentliche, das heißt allen Bürgern und Bürgerinnen zugängliche Opernhaus und wurde von ihm auf der kommerziellen Grundlage freien Unternehmertums als impresario geleitet.
Monteverdis „L`Orfeo“ stellte sich noch, wie Geck schreibt, „in den Dienst des Dramas“, das heißt hier kam es noch zu einer „perfekte[n] Synthese von Text, Handlung, Szene, Gesang, Tanz und Instrumentalmusik“, es war noch nicht jenes gewaltige, insbesondere von einem Streichorchester getragene Totalerlebnis, zu dem sich die Oper später entwickeln sollte. Dass es soweit kommen sollte, lag insbesondere an dem Zwang, „wirtschaftlich denken und sich gegenüber ständiger Konkurrenz behaupten zu müssen“, wie Geck schreibt. Man musste auf den Geschmack des Publikums achten und das hieß, neben der Vergrößerung des Orchesters, insbesondere, exzellente Sängerinnen und Sänger zu engagieren.
Die große Zeit der sogenannten Da-capo-Arien und der Primadonnen brach an – mit Georg Friedrich Händel (1685-1759) folgten etwas später die ob ihrer Abnormität allseits faszinierenden Kastraten –, wobei es wohl Francesco Cavalli (1602-1676) war, er sang noch im Knabenchor Monteverdis, der die Oper in diesem Sinne populär machte; er war es jedenfalls, der mit seinen Kompositionen den belcanto einführte, also das schöne, melodiöse lamenti.
Dass die Oper so raschen Erfolg hatte, hängt auch mit einer verheerenden Pestepidemie 1630 zusammen, nach der die Zeit der großen Chöre vorbei war, auch jene von San Marco. Das nach der Katastrophe neuerwachte Musikleben ging nicht mehr von den Kirchen, sondern von den Opernhäusern aus. Auf Monteverdis Teatro San Cassiano folgten in den nächsten Jahren rasch sieben weitere Opernhäuser in einer Stadt, die mit etwa 200.000 Einwohnern und Einwohnerinnen bis zum Beginn des 18. Jahrhunderts dann bereits sechzehn Opernbühnen haben sollte.
Neben der Oper aber war das Konzert beziehungsweise concerto die zweite wichtige musikalische Neuerung jener Zeit. Es geht zurück auf Andrea Gabrieli, vor allem aber auf dessen Neffe Giovanni Gabrieli (1554/1557-1612), der noch in San Marco als Organist tätig war, bevor er als Komponist erfolgreich wurde. Dabei hat er eben nicht nur Kirchenmusik komponiert, sondern er gilt auch als Erfinder der Violinsonate, außerdem taucht bei ihm in einer 1587 veröffentlichen Sammlung von Kompositionen auch erstmals das Wort „concerto“ auf. „Konzert“, darauf verweist Martin Geck, wird meist mit „Wettsreit“ übersetzt, weil sich zum Beispiel beim Violinkonzert der Solist mit dem Orchester misst. (Hervorgegangen ist es aber aus dem – im Grunde durchaus geselligen – Streit von zwei Vokalchören, die nicht mehr im Altarraum aufgestellt waren, sondern auf gegenüberliegenden Emporen, wo sie sich – der eine begleitet von Violinen, der andere von Posaunen – wechselseitig zu singen. Martin Geck schreibt in diesem Zusammenhang: „Es ist kein Zufall, dass diese konzertante Mehrchörigkeit ihre erste Blüte im Stadtstaat Venedig erlebt hat. Zum einen steht dort wegen des florierenden Überseehandels so viel Geld zur Verfügung wie nirgendwo sonst; man kann daher problemlos eine größere Truppe von Berufsmusikern bezahlen. Zum anderen bedarf es, um auswärtigen Besuchern zu imponieren, repräsentativer Staatsakte.“)
Giovanni Gabrieli war ein außerordentlich virtuoser Organist – sogar der Deutsche Heinrich Schütz kam als junger Mann auf Wunsch mit einem Stipendium des Landgrafen Moritz von Hessen-Kassel 1609 für drei Jahre nach Venedig um bei ihm zu lernen. Wichtiger für die Musikgeschichte aber ist, dass er als einer der ersten „reine“ Instrumentalmusik geschaffen hat: Einer neuen Druckausgabe von mehrchörigen Vokalkonzerten gibt er, wie Martin Geck bemerkt, „einige Instrumentalkonzerte bei, darunter die berühmte Sonate Pian e forte. Die Bezeichnung `Sonate´ muss in diesem Zusammenhang nicht verwirren: Man wusste anfänglich nicht recht, wie man die neuen Instrumentalstücke überhaupt nennen sollte, und versuchte es auch mit dem Vorschlag `Sonate´, also `Klangstück´.“
Die Bezeichnung Pian e forte trägt zum einen der Tatsache Rechnung, dass neben den Streichinstrumenten gerade auch das Pianoforte, also das Klavier, erfunden wurde, gleichwohl aber verweist Gabrieli mit dieser Namensgebung auf mehr: Denn zweifelsohne ist jede Musik einmal leise, einmal laut – aber er signalisiert damit, wie Geck bemerkt, „dass sein Werk immerhin ein klar herauszuhörendes Thema habe, nämlich den stetigen Wechsel zwischen einem `lauten´ Instrumentenchor und seinem `leisen´ Echo.“ Mit Überschriften wie diesen gibt er dem Zuhörer damit ein gewisses „Programm“ mit auf den Weg, das heißt er kann erst dadurch etwas inhaltliches mit der Sonate assoziieren. Darin aber liegt für Martin Geck auch der Erfolg der neuen Instrumentalmusik begründet – zu denen beispielsweise auch Antonio Vivaldis Violinkonzerte Die vier Jahreszeiten gehören, die „ohne diese Überschrift und ohne ihr programmatisches Eingehen auf die Merkmale von Frühling, Sommer, Herbst und Winter gewiss weniger berühmt geworden (wären)“.
Den Weg den Giovanni Gabrieli eingeschlagen hat, bringt Antonio Vivaldi (1678-1741) dann gewissermaßen zu Ende. Das heißt er hat vielleicht als erster konsequent nicht mehr für eine kirchliche Gemeinde, sondern für ein bürgerliches Publikum komponiert. Eigentlich aber war Vivaldi, wie sein Vater, der in San Marco tätig war, Violinist. Er gab zunächst Geigenunterricht, bevor er dann den Chor in einem der großen ospedali leiten durfte, dem Ospedale della Pietà. Diese ospedali waren ursprünglich karitative Einrichtungen für Bedürftige: Alte, Kranke, Arme und auch für Waisenkinder, zumeist Mädchen, die dort eine musikalische Ausbildung erhielten und dann in den angeschlossenen Kirchenchören bei Messen eingesetzt wurden. Dabei erreichten diese Einrichtungen bald eine solche Qualität, dass man sie vielleicht – aus heutiger Perspektive – als Konservatorien bezeichnen müsste. Jedenfalls wurde sie so berühmt – Goethe zum Beispiel erwähnt sie begeistert in „Italienische Reise“ (Den 3. Oktober) –, dass man aus ganz Europa Schüler zur Ausbildung hierher schickte.
Das Wort „Konservatorium“ kommt von conservare, „bewahren“, und geht zurück auf Bewahranstalten, Waisenhäuser in Neapel, in denen auch Kinder musikalisch ausgebildet wurden. In Venedig sagte man ospedali, weil die Institute an Krankenhäuser angeschlossen waren. Vivaldi baute am Ospedale della Pietà, dem ältesten, 1345 gegründeten ospedale, einen berühmten Mädchenchor mit Orchester auf. Die Mädchen bekamen zu ihren Vornamen den Namen ihres Instrumentes oder ihrer Gesangsstimme – Catarina dal Cornette, Luciana Organista, Maddalena dal Soprano et cetera.
Vivaldi leitete den Chor und das Orchester im Ospedale della Pietà 35 Jahre lang – komponierte aber vor allem auch Konzerte, und zwar Hunderte, und außerdem auch zahllose Opern. 94 Opern habe er komponiert, sagte Vivaldi, 47 davon sind nachzuweisen, für einige hat sogar der damals noch unbekannte Carlo Goldoni die Libretti geschrieben. Ansonsten waren die Konzerte für alle nur denkbaren Soloinstrumente geschrieben. Dass jedoch seine Violinkonzerte besonders bekannt geworden sind, lässt sich nicht zuletzt damit erklären, dass er selbst, wie Martin Geck erklärt, „ein phantastischer Geiger“ war. Das wird auch daran deutlich, dass der Frankfurter Patrizier Johann Friedrich von Uffenbach, der während des Karnevals 1715 in Venedig weilte, geradezu erschrocken über das Spiel des Maestros berichtete: „denn er kahm mit den Fingern nur einen Strohhalm breit an den Steg daß der bogen keinen plaz hatte, und das auf allen 4 saiten mit Fugen und einer geschwindigkeit die unglaublich ist.“ Daran, so Geck, werde deutlich, „wie man damals dem Publikum im Bereich der `reinen´ Instrumentalmusik am besten imponierte: (…) mit viel virtuoser Hexerei. Unter solchen Bedingungen kann selbst das polyphone und mehrgriffige Spiel – Uffenbach spricht etwas übertreibend von `Fugen´ – zur Sensation werden.“
Jacob Stainer
Die Füssener Handwerker konnten sich nach dem Dreißigjährigen Krieg und der Pest nicht mehr an die Veränderungen der von Venedig ausgehenden Musikkultur anpassen. Zwar waren die Lauten, die noch zuletzt hier gebaut wurden, durchweg hochwertig hergestellt – mit aufwändigen Schnitzereien und wertvollen Materiellen – und elegant im Stil, damit aber konnten die Geigen nicht annähernd mithalten: „Instrumente, die nach dem Krieg in Füssen selbst hergestellt wurden, waren häufig sehr rustikal: roh, asymetrisch und improvisiert, grob geschnitten, wie mit stumpfen Werkzeugen und müden Augen, Instrumente, die man im Wirtshaus spielt“, bemerkt Blom in diesem Zusammenhang. Während vor dem Krieg noch mehr als zwanzig Werkstätten in Füssen existierten, waren 1675 nur noch fünf Meister ansässig: Hans, Christoph und Michael Fichtel, Mattheis Aicher und Lucas Socher. Das zeigt deutlich, dass die Nachfrage nach qualitativ gut gemachten Streichinstrumenten für die neue Musik im italienischen Stil offensichtlich nicht vorhanden war.
Auch deshalb verließen zahlreiche Füssener Geigenbauer aus dieser zwischen 1650 und 1680 geborenen Generation die Stadt und gingen nach Italien, wo sie das Handwerk mitbestimmten, wie Blom erklärt: „Unter den Füssenern, die in diesem Umfeld gelernt hatten, um dann nach Italien auszuwandern, waren einige der besten `italienischen´ Meister des frühen 18. Jahrhunderts“. Nach der katastrophalen Pestepidemie hatte sogar Cremona auswärtige Handwerker als Gesellen genommen.
Auch der Tiroler Jacob Stainer (1618-1683), lernte in Italien, sehr wahrscheinlich sogar bei dem großen Nicolò Amati. Aber „Stainer war einer der wenigen, die wieder in die Heimat zurückgingen. In Absam in Tirol schuf er Instrumente, die nördlich der Alpen fast alle anderen Geigenbauer beeinflussten“, schreibt Blom.
Stainer kam im Laufe der Zeit viel herum und ist auf seinen zahlreichen Reisen auch mit den Ideen der Reformation bekannt geworden. Das sollte ihm im erzkatholischen Tirol zum Verhängnis werden, als im Haus des durchaus belesenen Stainers im Zuge einer Durchsuchung indizierte Bücher gefunden wurden, denn der Haller Stadtpfarrer erstattete daraufhin 1668 tatsächlich eine Anzeige wegen Häresie. Stainer wurde von einem bischöflichen Gericht verurteilt, konnte aber zumindest die einem gesellschaftlichen Bann gleichkommende Exkommunikation verhindern.
In dieser von persönlichen Rückschlägen gekennzeichneten Zeit hat sich Stainer auf seine Arbeit konzentriert – und zahlreiche Aufträge aus dem Ausland bearbeitet. Seine Produktivität war vor allem vor dem Hintergrund, dass er allein arbeitete, also ohne Lehrlinge und Gesellen, beachtlich, bis ihm aber eine Krankheit zusehends zu schaffen machte. 1680 wurde in einem kurfürstlichen Rechnungsbuch vermerkt, dass Stainer „ganz sinnlos“ geworden sei, dennoch arbeitete er bis zuletzt.
Anders als Stainer kehrten die aus Füssen ausgewanderten Geigenbauer nicht zurück ins Allgäu – und auch als Zulieferer von Instrumententeilen wurde die Stadt zusehends immer unwichtiger, da Streichinstrumente wesentlich einfacher zu bauen sind als Lauten: sie bestehen aus weniger Teilen und sind insgesamt auch weniger zeitaufwändig in der Herstellung. Grundsätzlich ist zwar auch die Violine ein komplexes Instrument, sie besteht aber nur aus etwa 80 Teilen, die nun jeweils ähnlich arbeitsteilig in den Werkstätten vor Ort hergestellt und zusammengebaut werden.
Die Violine
Jacob Stainers Geigen sind, wie Rudolf Hopfner schreibt, „hochgewölbt und zeichnen sich durch eine besondere Klangqualität aus. Daher zählten sie, neben Nicolò Amatis Instrumenten, bis ins späte 18. Jahrhundert zu den begehrtesten und auch teuersten Streichinstrumenten.“ Erst mit dem Aufkommen von immer mehr Konzertsälen und stark besetzten Orchestern ab dem 19. Jahrhundert setzten sich dann zunehmend die Instrumente Antonio Stradivaris und später auch die von Batolomeo Giuseppe Guarneri „del Gesù“ (1698-1744) durch, die mit etwas längeren Hälsen versehen wurden und ein etwas größeres Tonvolumen hatten, wie Hopfner bemerkt. Die Violinistin Anne-Sophie Mutter erklärt in diesem Zusammenhang über ihre Geige von Stradivari: „Wohl in der unterbewussten Vorahnung, dass sich die Musik aus dem höfischen Zeremoniell in die Demokratie – in die Mitte des Volkes – bewegen würde und damit natürlich auch in größere Räume … Irgendwie hatte er wohl die Vision von, ich weiß nicht, Royal Albert Hall mit siebentausend Zuhörern, denn das Mysterium der Geige ist nicht unbedingt die Größe und die Lautstärke des Klanges, sondern ihre Tragfähigkeit. Es ist auch diese Präsenz im ganz Leisen (…), dass tatsächlich noch im Saal bei Person Nummer 4.000 gehört wird.“
Der Klang einer Geige ergibt sich grundsätzlich über das Resonanz- und Schwingungsvermögen der verwendeten Materialien und Teile. Die Zargen beziehungsweise der Zargenkranz – also die Teile der Seitenwand – verbindet dabei Boden und Decke der Geige. Sie sind entscheidend für den Klang, denn die Schwingungen von Boden und Decke werden über die Zargen übertragen. Je dünner Boden und Decke aus dem Ausgangsmaterial gearbeitet sind, desto dunkler ist gemeinhin der Ton.
Der Bassbalken im Inneren des Instruments verteilt die Schwingungen dabei gleichmäßig auf die Decke: Ohne ihn würde der untere Bereich der Decke gegenläufig zum oberen Bereich schwingen, der Knotenpunkt dabei liegt genau beim sogenannten Stimmstock. Der Bassbalken gleicht diese gegenläufigen Schwingen jedoch aus, sodass die Decke eine harmonische Schwingungsbewegung ausführt. Seine Gestaltung wirkt sich erheblich auf den Klang des Instrumentes aus. Gewöhnlich hat der etwa über zwei Drittel der Länge des Korpus verlaufende, nur wenige Millimeter breite und etwa einen Zentimeter hohe Bassbalken seinen höchsten Punkt, dort, wo sich der Steg befindet, und läuft an seinen beiden Seiten geschwungen aus.
Der Korpus ist der Resonanzkörper der Geige. Dieser Hohlkörper verstärkt die Schwingungen eines Tons und damit den Klang. Durch die sogenannten f-Löcher, die aus der Decke herausgeschnitten werden, kann der Schall aus dem Korpus heraustreten.
Zum Schutz vor Rissen wird am Rand des Bodens und der Decke der schmale, nur wenige Millimeter dicke sogenannte Einlegespan aus einem hellen Ahornstreifen, der von zwei dunklen Ebenholzstreifen umgeben ist, wie eine Intarsie eingearbeitet. Aus dem harten Ebenholz gefertigt sind auch das auf dem Hals der Geige befestigte Griffbrett sowie die vier Wirbel des in den Hals eingearbeiteten Wirkbelkastens unterhalb der Schnecke am Kopf des Instruments.
Neben dem Bassbalken ist auch der Stimmstock entscheidend für den Klang einer Geige. Er besteht aus einem runden Fichtenstäbchen mit etwa 6 Millimeter Durchmesser, das ungefähr an der breitesten Stelle des Bassbalkens zwischen Boden und Decke eingesetzt, das heißt eingeklemmt wird. Der Stimmstock überträgt die Schwingen von der Decke auf den Boden. Durch seine Positionierung kann die Spannung eines Korpus verändert werden – mehr oder weniger Spannung – und dadurch auch der Klang eines Instruments.
Die Grundierung (ein Gemisch aus Silikat- und einigen Harzanteilen, das das Holz härtet und die Poren verschließt) und die anschließende Lackierung einer unbearbeiteten Geige – bis zu zehn Schichten werden aufgetragen – verändert noch einmal den Klang eines Instruments: Die Lackierung bremst die Schwingungen des Holzes, sie darf sie aber nicht dämpfen
Beim Geigenbau wird zuletzt der Steg auf dem ansonsten fertigen Instrument angepasst. Auch er wird, wie der Stimmstock, nicht mit dem Instrument verleimt, sondern quasi zwischen den Saiten und dem Korpus eingeklemmt. Der Steg überträgt so die Schwingungen der Saiten (mit den Tönen E, A, D und G) auf den Korpus. Die Saiten werden heutzutage nicht mehr aus Schafsdarm hergestellt, sondern aus verschiedenen Materialien: sie bestehen aus einem Kern und einer Umspinnung, wobei der Kern bisweilen aus Kunststoff ist und die Umspinnung aus Aluminium oder Silber. Die E-Saite ist die dünnste Saite und besteht meistens aus Stahl. Gegenüber der Darmsaite hat die Kunststoffsaite den Vorteil, dass sie die Stimmung länger hält und sich nicht mehr so schnell verstimmt. Gegenüber Saiten mit einem Stahlkern haben sie einen etwas wärmeren Klang.
Auch der Bogen beeinflusst den Klang eines Instruments enorm, Bogenmacher aber ist ein eigenständiger Beruf – er wird nicht in der Geigenbauwerkstatt gefertigt. Der Bogen besteht bisweilen aus einem Edelholz wie dem brasilianischen Fernambuk, und ist mit Pferdehaaren bezogen. Ein guter Bogen sollte die Schwingung der Saite sofort übernehmen.
War Jacob Stainer noch alleine tätig, spezialisierten sich die Handwerker in den vielen Werkstätten nach ihm auf einzelne Arbeitsschritte wie das Biegen der Zargen, das Schnitzen von Boden und Decke, das Schnitzen der Schnecken, das Schneiden der f-Löcher oder das Grundieren und Lackieren des Holzes. So konnten alle Lehrlinge und Gesellen einer Werkstatt an einem Instrument beteiligt sein, das dann doch nur den Namen des Meisters und Besitzers trug. Gleichzeitig aber blieb jetzt der gesamte Fertigungsprozess in einer Werkstatt, die ein Instrument vom Holzscheit bis zur letzten Politur fertigstellte. Das galt auch für die Werkstatt des wohl bekanntesten Geigenbauers überhaupt: Antonio Stradivari.
Antonio Stradivari und seine Werkstatt
Cremona in Oberitalien, etwa 30 Kilometer südlich der Alpen bei Brescia gelegen – hier wurde Antonio Stradivari 1644 geboren. Über seine Ausbildung ist wenig bekannt. Man ging früher davon aus, dass er bei Nicolò Amati gelernt hat, inzwischen aber wird auch eine Lehre als Holzschnitzer in Betracht gezogen. Das älteste erhaltene Dokument in Zusammenhang mit Stradivari betrifft jedenfalls seine Eheschließung im Jahr 1667. Wenig später bezog das Paar ein Haus mit Werkstätte im Zentrum Cremonas.
Als Stradivari dort mit dem Bau eigener Geigen begann, stand er in einer Tradition, deren Maßstabe für den Zuschnitt der Decke, des Bodens und des Wirbelkastens von Streichinstrumenten Andrea Amati ein Jahrhundert zuvor gesetzt hatte. Spätere Geigenbauer – die natürlich immer auch andere Streichinstrumente hergestellt haben – hielten sich an die von den Meistern in Cremona und deren österreichischem Nachbarn Jacob Stainer gesetzten Maßstäben, die sich in den Anfangsjahren des Geigenbaus in Norditalien trafen und auch vermischten.
Wer nicht direkt von diesen Meistern oder ihren Schülern ausgebildet wurde, lernte durch die Reparatur ihrer alten Instrumente, wie Richard Sennett in „Handwerk“ (2008) schreibt: „Die technische Ausbildung basierte auf direktem Umgang mit den Instrumenten und einer direkten Anleitung, die mündlich von Generation zu Generation weitergegeben wurde. Der junge Geigenbauer hatte eine Original-Amati in Händen, die er nachbaute oder reparierte. Das war die Methode des Wissenstransfers, die Stradivari erbte.“
Wie schon in den Werkstätten vor ihm, war auch Stradivaris Werkstatt zugleich Schlaf- und Arbeitsplatz für die Familie Stradivaris wie für seine Lehrlinge und Gesellen. Die Arbeit beherrschte den Tagesablauf, das heißt von Tagesanbruch bis zur Abenddämmerung wurde in der Werkstatt gearbeitet, während die unverheirateten Lehrlingen und Gesellen und Stradivaris Söhne nachts auf Strohsäcken unter den Werkbänken übernachten.
Die Herstellung der Streichinstrumente erfolgte arbeitsteilig: Die jüngsten Lehrlinge hatten „vorbereitende Arbeiten wie das Einweichen des Holzes in Wasser, den groben Zuschnitt und das grobe Vorformen“ zu erledigen, während die erfahreneren Gesellen „feinere Arbeiten wie den Zuschnitt der Decke oder den Zusammenbau des Halses“ übernahmen und Stradivari selbst „den endgültigen Zusammenbau“ vornahm und den Firnis auftrug, also die schützende Lackschicht, die nach Meinung mancher Experten den Klang des Instruments wesentlich bestimmen soll. Stradivari war allerdings, wie Sennett betont, „in allen Phasen des Herstellungsprozesses präsent“ und dabei bisweilen „ein herrischer, zuweilen sogar tyrannischer Charakter, der seinen Launen gelegentlich auf spektakuläre Weise freien Lauf ließ und nicht mit Anweisungen oder Ermahnungen sparte“.
Stradivaris älteste erhaltene Geige stammt aus dem Jahr 1666, gerade aus dem ersten Jahrzehnt seiner Werkstatt sind jedoch nur wenige weitere Instrumente erhalten geblieben. Erschwerend kommt hinzu, so schreibt Rudolf Hopfner, dass „bei den meisten dieser frühen Geigen die Zettel manipuliert oder entfernt (wurden). Instrumente aus seiner frühen Schaffensperiode zeigen Stilmerkmale Amatis auf, sind jedoch hinsichtlich des verwendeten Modells und der Wölbungsform uneinheitlich. Offensichtlich experimentierte Stradivari in dieser Phase seines Schaffens, indem er unterschiedliche Parameter variierte.“
Nachdem sich Stradivari 1680 mit seiner Werkstatt an der zentral gelegenen Piazza di San Domenico, in der Nähe der Werkstätten von Guarneri und Amati, niedergelassen hatte, experimentierte er ab 1690, so Hopfner, „mit einem Korpusmodell, das um einige Millimeter über dem Standard lag und als long pattern bezeichnet wird. Ab 1700 erreichte Stradivaris Werkstatt ihren qualitativen Höhepunkt. Das von da an vorherrschende breite Modell mit einer sehr vollen Wölbung mittlerer Höhe ist sowohl in ästhetischer Hinsicht als auch klanglich optimal; wohl auch wegen des hervorragenden Tonholzes, das Stradivari zu dieser Zeit zur Verfügung gestanden ist.“
Die Produktivität der Werkstatt stieg, nachdem die beiden Söhne Stradivaris, Francesco (geboren 1671) und Omobono (geboren 1679), ihre Ausbildung abgeschlossen hatten. Man bezeichnet diese Zeit zwischen 1690 und 1720 auch als die Goldene Periode. Die danach gebauten Instrumente wirken hingegen häufig „sehr kräftig, haben breitere Ränder und eine schwach ausgebildete Hohlkehle“, so Hopfner, der aber betont, dass auch diese späten Instrumente, wenn man „von geringfügigen altersbedingten Unsicherheiten in handwerklicher Hinsicht“ absieht, „großes klangliches Potential“ besitzen.
Stradivaris Werkstatt, die schon der Neuzeit nahe steht, wie Richard Sennett bemerkt, unterschied sich von mittelalterlichen Werkstätten insbesondere dadurch, dass er auf dem offenen Markt auftrat und sich nicht auf einige wenige Gönner beschränkte. Fauto Cacciatori, Kurator des Museo del Violino in Cremona, erklärt in diesem Zusammenhang: „Zweifelsohne führte Stradivari ein vielbeschäftigtes Leben und vermehrte seinen Wohlstand kontinuierlich. Er hatte in Cremona die bedeutendsten Persönlichkeiten als Auftraggeber – adlige Auftraggeber, die schon zu seinen Lebzeiten Unsummen für seine Instrumente bezahlten. Schritt für Schritt begannen andere ihm nachzueifern. Zweifellos: Er war schon damals ein berühmter Mann.“
Schon zu Stradivaris Zeit war die handwerkliche Produktion dabei auf die Herstellung von Markenerzeugnissen ausgerichtet: Der Name Stradivari stand lange für Qualität – und seine Erfolge setzten schon früh die anderen Geigenbauer in Cremona unter Druck. Mit Blick auf die von Andrea Guarneri (1623-1698) gegründete Geigenbauwerkstatt von Bartolomeo Giuseppe Guarneri, genannt „del Gesù“, in der Nachbarschaft von Stradivari schreibt Richard Sennett: Del Gesù „arbeitete in Stradivaris Schatten. `Im Gegensatz zu Antonio Stradivaris umfangreicher internationaler Klientel´, so schreibt Guarneris Biograph, `bestand seine Kundschaft hauptsächlich aus … einfachen Cremoneser Musikern, die in Palästen und Kirchen in und um Cremona´ spielten. Obwohl del Gesù in seinen Fähigkeiten nicht hinter Stradivari zurückstand, konnte er seine Werkstatt nur fünfzehn Jahre halten. Und noch größere Schwierigkeiten hatte er, seine besten Lehrlinge zu halten.“
Aber auch Stradivari hatte nach dem Ende der sogenannten Goldenen Periode Probleme, sich zu behaupten. Sennett schreibt in diesem Zusammenhang: „Die Zahl der Geigenbauer und der hergestellten Instrumente hatte sich zu Stradivaris Zeiten beträchtlich vergrößert. Das Angebot begann die Nachfrage zu übersteigen. Selbst Stradivari, der schon früh Berühmtheit erlangte, musste sich Sorgen um seinen Absatz machen, denn er hatte es mit einer Vielzahl privater Kunden zu tun, und diese Marktpatronage erwies sich vor allem gegen Ende seines langen Lebens als unbeständig. Während des allgemeinen wirtschaftlichen Niedergangs der 1720er Jahre musste seine Werkstatt die Kosten senken, und ein großer Teil der Produktion wanderte ins Lager. Die Risse in der Werkstatthierarchie verbreiterten sich aufgrund der Unsicherheit des offenen Marktes. (…) Der offene Markt verringerte den zeitlichen Rahmen für die Herrschaft des Meisters.“
Schon 1727 kaufte Stradivari eine Grabstätte in der Basilika San Domenico und regelte die Aufteilung seines beträchtlichen Vermögens. Im März 1737 starb seine zweite Frau Antonia im Alter von 72 Jahren, er selbst folgte ihr schließlich im Dezember desselben Jahres. Stradivari wurde über 90 Jahre alt – bis in sein letztes Lebensjahr hinein blieb er im Geigenbau aktiv.
Man hat Stradivari zum berühmtesten Geigenbauer aller Zeiten erhoben. Das hat, erklärt Rudolf Hopfner, „gleichermaßen mit seiner langen Schaffenszeit, den zahlreichen erhaltenen Instrumenten, der stilistischen Konstanz seiner Arbeiten, der hohen Ästhetik und – vor allem – dem klanglichen Potenzial seiner Instrumente zu tun. Alle bis heute erhaltenen Violinen, Violen und Violoncelli Stradivaris wurden im Lauf der Zeit baulich verändert. Sie erhielten längere und stärker geneigte Hälse sowie längere Bassbalken. In Verbindung mit dem heute verwendeten Saitenmaterial, das höhere Spannung erlaubt als die ursprünglich verwendeten Darmsaiten, besitzen diese Instrumente eine Klangfülle und ein Timbre, das sie zu idealen Konzertinstrumenten macht.“
Mit Stradivari wurde Cremona zum Zentrum des Geigenbaus – heute gibt es dort 150 Geigenbauwerkstätten –, wobei er selbst als bedeutendster Geigenbauer der Geschichte und seine Instrumente nach wie vor als unübertroffen gelten. Das aber ist mehr Fluch als Segen, wie Richard Sennett bemerkt: Denn als Antonio Stradivari starb, stirbt mit ihm auch sein Wissen. Er übergab das Geschäft zwar an seine Söhne, die „noch mehrere Jahre Nutzen aus dem Namen Stradivari zu schlagen (vermochten), doch dann ging das Unternehmen zugrunde. Er hatte sie nicht gelehrt und sie nicht lehren können, Genies zu sein.“
Mythos Stradivari
Über 1.000 Instrumente soll Stradivari in seiner Werkstatt hergestellt haben, von denen heute noch, je nach Quelle, etwa 500 bis 650 erhalten sind. Nicht zuletzt aufgrund des beschränkten Angebots ist um sie ist ein regelrechter Mythos entstanden – durch den Stradivaris, im Englischen oft auch einfach „Strads“ genannt, zu den teuersten Instrumenten der Welt geworden sind, zu wahren Investments, sodass die Instrumente anstatt bei den Musikern und Musikerinnen in irgendwelchen wohltemperierten Safes landen. An den Auktionsbörsen wie dem Tarisio, einem der ersten, das sich auf Streichinstrumente spezialisiert hat, werden inzwischen Preise im zweistelligen Millionenbereich für eine Stradivari erzielt, zuletzt waren es sogar über 15 Millionen Dollar.
Kein Wunder, dass kein anderer Geigenbauer so oft gefälscht worden ist wie Stradivari – und von keinem öfter als von dem Deutschen Dietmar Machold. Mit Echtheitszertifikaten und Garantien, die er selbst erstellte, machte er Millionen. (Ansonsten sind Gutachter für Streichinstrumente ohnehin rar und ein eher verschwiegenes Kartell, deren Urteil kaum anzufechten ist.) Das väterliche Stammgeschäft in Bremen war Machold bald zu klein, sodass er von einem Schloss bei Wien aus, das wohl Seriosität ausstrahlen sollte, Filialen in der ganzen Welt gründete und dabei vornehmlich mit Foundations und Banken handelte, weil Händler seine Instrumente eher nicht gekauft hätten. Schlussendlich konnte er überführt und zu sechs Jahren Gefängnis verurteilt werden.
Dass es überhaupt Fälschungen gibt, liegt daran, dass es seit nahezu dreihundert Jahren nicht gelungen ist, dem Geheimnis der Stradivaris auf die Spur zu kommen – er scheint es mit ins Grab genommen zu haben. Worin aber besteht dieses Geheimnis? Was macht diese Violinen so unübertroffen? An der Perfektion seiner Instrumente arbeitete Stradivari akribisch, experimentierte mit verschiedenen Formen, Größen und Materialien – immer mit dem Ziel, den idealen Klang zu erreichen. Und tatsächlich zeichnen sich seine Instrumente auch durch eine außergewöhnliche Klangqualität aus. Um der auf die Spur zu kommen, analysiert man die Geigen Stradivaris und konzentriert sich dabei vor allem auf folgende Aspekte: manche versuchen, exakte Nachbauten der Stradivaris herzustellen (die aber nur einen Bruchteil kosten), wie beispielsweise der New Yorker Geigenbauer Samuel Zygmuntowicz für den Violinisten Isaac Stern (1920-2001); andere sehen das Geheimnis in der Lackierung und versuchen deshalb, die Firnis der Instrumente chemisch zu analysieren; wieder andere bemühen sich um eine Rekonstruktion auf der Basis des Klangs, wobei es hier nicht um eine Nachahmung der Form und Konstruktion geht.
Im Hinblick auf die Lackierung sagt man, Stradivari habe einen Lack aus Öl verwendet, unter anderem mit Pigmenten, Kurkuma und Gummigutta gemischt. Bis heute aber ist es nicht gelungen, seine Rezeptur zu analysieren, das heißt man kennt sein Rezept genauso wenig wie die Rezepturen der andern italienischen Meister. Außerdem sind die 8 bis 10 Schichten Lack, die Stradivari bei seinen Instrumenten aufgetragen hat, bei den meisten Geigen heute mitunter komplett abgerieben oder sie wurden zwischenzeitlich ohnehin neu lackiert. Vom Lack lassen sich insofern bislang keine direkten Rückschlüsse auf die Klangqualität eines Instruments machen.
Die Geige ist ein komplexes Instrument und gibt sein Klanggeheimnis nicht so ohne weiteres preis. Manche behaupten, dass die Klangqualitäten einer Stradivari auf dem verwendeten Holz beruhen, das Stradivari im Wald von Tarvisio gefunden hat. Für den Geigenbau braucht man vor allem das Holz von Fichten und Ahorn, dazu Obstbaumholz; ursprünglich nahm man meistens Birnenholz. Stradivari verwendete weiches Fichtenholz, das für eher weichere Töne sorgt, für die Decke und den im Inneren des Korpus in die Deckenwölbung eingepassten Bassbalken, und hartes Ahornholz für Boden, Zarge und die Schnecke. Hartholz wie Ahorn ist für den Instrumentenboden wichtig, weil es für Klänge mit einer Obertonpalette sorgt.
Besonders geschätzt im Instrumentenbau ist Holz, das von langsam gewachsenen Fichten stammt: Sie wuchsen in den Alpenwäldern auf mageren und mineralstoffarmem Untergrund mit einem geringen Wassergehalt, etwa auf Steilhängen des Gebirges. Folglich ist ihr Wachstum langsam und die Jahresginge in sehr engen Abständen ausgebildet, ihre Ausrichtung viel gleichmäßiger, kompakter und dichter. Grundsätzlich kann man von den Jahresringen eines Baumes auf die mechanischen Eigenschaften eines Holzes schließen. Die besten Bäume wachsen in Norditalien heute an Hängen, die nach Norden gerichtet sind, denn Bäume, die viel Sonne einfangen, bilden gemeinhin mehr Harztaschen aus und haben deshalb mehr Hohlräume.
Besonders gering war der Holzzuwachs von Fichten, die im späten Mittelalter und in der frühen Neuzeit wuchsen, im kühlen Klima der Kleine Eiszeit. Diese Bäume konnte man im 17. und 18. Jahrhundert schlagen, also genau in der Zeit der Goldenen Periode von Stradivari. Die Bäume, die Stradivari verwendete, waren insofern lange Zeit winterlicher Kälte ausgesetzt. Gewachsen ist so ein massives Holz mit unvergleichlichen Klangeigenschaften, so glauben manche – gleichwohl aber hatten nicht alle Geigenbauer zur Zeit Stradivaris den selben Erfolg. Man geht deshalb davon aus, dass die lange Trockenzeit der Hölzer die Güte einer Stradivari ausmachen: Stradivari habe mit sehr trockenen Hölzern gearbeitet. Allerdings haben Untersuchungen ergeben, dass die Hölzer tatsächlich nicht wie bisher angenommen bis zu 60-70 Jahre getrocknet sind, sondern nur etwa 20 Jahre, sodass also auch diese These keine eindeutigen Ergebnisse bringt.
Auch wenn es anhand der Breite der Jahresringe des verwendeten Holzes wohl möglich ist, Fälschungen zu erkennen, weil das Klima, wie Hansjörg Küster in „Die Alpen“ (2020) schreibt, sich seit der frühen Neuzeit verbesserte und die Bäume schneller wuchsen – was in allen diesen Analysen, das heißt der Analyse der Firnis oder der des Holzes, fehlt, so Richard Sennett, ist jedoch „eine Rekonstruktion der Werkstätten dieser Meister – oder genauer, es fehlt ein Element, das unwiederbringlich verloren ist: die Allgegenwart des stillschweigenden, unausgesprochenen und nicht in Worte gefassten Wissens, das dort zur Gewohnheit wurde und in den tausend alltäglichen Bewegungen steckte, die in ihrer Summe eine bestimmte Praxis ausmachen. Die wichtigste Tatsache, die wir im Blick auf Stradivaris Werkstatt kennen, ist der Umstand, dass er überall unerwartet auftauchen konnte und die unzähligen Bits an Informationen sammelte und verarbeitete, die für seine mit Teilarbeiten beschäftigten Gehilfen nicht dieselbe Bedeutung haben konnten.“ Sennett spricht in diesem Zusammenhang auch von Kultur: „Hochspezialisierte Fertigkeiten bestehen nicht einfach aus einer Liste von Verfahren, sondern aus einer ganzen Kultur, die sich um solche Fertigkeiten gebildet hat.“
Das Wissen Stradivaris, so Sennett, das gewissermaßen definiert, was eine Violine sein kann, ist mit dem Tod des Meisters verloren (Sennett bezeichnet das auch als „Stradivari-Syndrom“), das heißt die qualitativ hochwertige Arbeit gründete hier ganz im impliziten Wissen Stradivaris und lässt sich nach dessen Tod nicht mehr rekonstruieren. „Obwohl man Unsummen an Geld ausgab und zahllose Experimente durchführte, ist es nicht gelungen, die Geheimnisse dieser Meister zu lüften. Etwas am Charakter ihrer Werkstätten muss den Wissenstransfer verhindert haben“, schreibt Sennett. Man kann insofern also sagen, dass es nicht möglich ist, den spezifischen Klang eines Instruments zu rekonstruieren. Andererseits aber, das zeigen neuere Untersuchungen von Akustikern, kann man auch nicht heraushören, aus welcher Form ein Klang kommt. Es gibt insofern keine Idealform – und eine Stradivari anhand ihres Klangs zu identifizieren ist insofern praktisch auch unmöglich. Selbst Experten scheitern an solchen Versuchen.
Außerdem ist es wohl auch so, wie Philipp Blom einen Geigenbauer anonym zitiert, dass es einfach nicht den Stradivari-Klang gibt, das heißt all das ist „reiner Unsinn. Diese Instrumente sind großartig, aber wie sie wirklich klingen, hängt von so vielen verschiedenen Faktoren ab: ob und wie eingreifend und wie kompetent sie über die Jahrhunderte repariert oder restauriert wurden, ob der Lack original ist, ob jemand neue Einlagen gemacht oder Boden und Decke weiter ausgehobelt oder, im Gegenteil, weiter verstärkt hat, wie hoch der Steg und wie er geschnitten ist, wie die Stimme eingestellt ist, was für ein Bassbalken drin ist, welche Saiten drauf sind, wie hoch die Luftfeuchtigkeit gerade ist, und wer sie spielt. Die Leute versuchen, das zu objektivieren mit allen möglichen wissenschaftlichen Methoden, Schwingungsmessungen und Spielautomaten, aber letztendlich ist die objektive Klangqualität eines Instruments gar nicht so interessant, denn es klingt ja erst durch das sehr subjektive Zusammentreffen mit einem Musiker, der auf seine Möglichkeiten und Anforderungen auf eine bestimmte, subtile und sehr persönliche Weise reagiert.“
Die damals 27jährige Anne-Sophie Mutter bemerkte in Zusammenhang mit der Beziehung zu ihrem Instrument in der Dokumentation „Anne-Sophie Mutter – Musik ist wie eine Droge“ (1991) einmal: „Ich war immer wahnsinnig fixiert auf eine Geige, und es hat mir schon von klein auf richtiggehend weh getan mich von einer Geige zu trennen. Eine Geige ist ja immerhin auch ein Teil von einem selbst, mit dem man lebt viele Jahre, in das man so unglaublich viele Emotionen legt. Und man trennt sich nur sehr schwer von einem Teil seines Lebens. Ich würde sicherlich zu allerletzt eine Geige verkaufen, wenn ich nur noch ein Hemd hätte – die Geige würde mich sicherlich bleiben müssen.“
Dann aber gibt sie ihre Violine von Alessandro Gagliano (1665–1732) doch zugunsten ihrer ersten Stradivari, der „Emiliani“ von 1703, auf, zu der sie sagt: „Diese Stradiviari, die erste von 1703, hat mir die Möglichkeiten eröffnet, mich von den Klangfarben her weiter zu entwickeln. Ich hatte vorher eine Gagliano, ein sehr schönes Instrument, aber halt ein bisschen begrenzt – sie war recht laut, hat gut getragen, aber mehr war da nicht drin. Die Geige an sich hatte keine große Persönlichkeit, die mich bereichert hätte, die mich auch gefordert hätte. Eine Stradivari ist ja ein ganz verzwicktes Gerät: sie ist sehr verschlossen in sich – es dauert lange Zeit, bis man wirklich den Ansatzpunkt gefunden hat, bis man auch so vertraut ist mit dem Instrument, so verwachsen, das man sich – gegenseitig, würde ich sagen, denn die Geige verändert sich ja auch, durch den der darauf spielt, und umgekehrt: man verändert sich, indem man das, was die Geige schon zu bieten hat, eingeht. Und das ist eine sehr, sehr wichtige Partnerschaft. Nur nach kurzer Zeit – nach drei, vier Jahren – habe ich bei der ersten Stradivari bemerkt, dass ich inzwischen schon so weit war in meinem inneren Ohr, klanglich, so weit entwickelt, dass ich mich auf der Geige nicht mehr habe ausdrücken können. (…) Sie hatte nicht die Klangfarben und auch nicht die Klanggröße, die Größe des Klanges. Es war dieser `Edge´, diesen Biss, den ich gesucht habe – und den hatte ich nicht auf der `Emiliani´. Diese Geige ist wunderschön, ist vielleicht sogar, was die Qualität des Klanges angeht, noch runder, noch dunkler, aber sie hat halt diesen Biss nicht, dieses, nicht Stählerne, aber dieses Lauernde – zwar unter der vollen, dunklen Färbung liegend, aber es muss noch ein bisschen so wie ein Drahtseil drunter sein.“
So hat sie schließlich sogar noch eine zweite Stradivari erworben, die „Lord Dunraven“ von 1710 – also genau wie die erste aus der Goldenen Periode –, zur der sagt sie: „Die ist natürlich noch besser im Sinn von weiter entwickelt: der Klang ist größer von der `Lord Dunraven´ und was Stradivaris ja ganz besonders auszeichnet, ist ihre Tragkraft. Das hat weniger zu tun mit der Lautstärke, die man darauf erreichen kann, sondern eigentlich mehr mit der Projektionskraft. Das heißt, wenn ich auf der Lord Dunraven ein Pianissimo hauche, kann ich sicher sein, dass man es auch bei 5.000 Sitzen ganz hinten noch hört. Es kann noch so Pianissimo sein, aber es ist immer eine Substanz da, es verschwindet nie im Nichts, es wird also nie Bedeutungslos, der Klang. Ich meine, das ist natürlich auch eine Frage der Vibratotechnik und so weiter, aber die Geige an sich hat schon diese Stimme, die man natürlich wissen muss, wie man sie erweckt.“
Damit auch junge Musikerinnen und Musiker sich an solch außergewöhnlichen Violinen erproben können, stellt ihnen Anne-Sophie Mutter mit ihrer Stiftung alte Instrumente zu Verfügung. Denn wer wenn nicht sie wüßte, wie sie in dem aktuellen Portrait „Anne-Sophie Mutter – Vivace“ (2023) sagt: „Ehre, Freude, Privileg – all of the above. Aber meinen Sie nicht (…), dass so eine Geige leicht zu spielen wäre. Und so ist diese Auseinandersetzung mit dieser komplexen Persönlichkeit Stradivari immer wieder eine Bereicherung, aber auch eine große Herausforderung. Letzten Endes – das ist jetzt mein Schluß nach fast 45 Jahren Zusammenleben mit einer Stradivari – scheinen diese Geigen tatsächlich alles in sich zu tragen, aber man lernt an ihnen, ein kompletterer Musiker zu werden.“
Bachs Suiten für Violine solo
Johann Sebastian Bach (1685-1750) besaß keine Stradivari, aber doch war „sein erstes Instrument wahrscheinlich die Geige“, bemerkt Philipp Blom. Für sie jedenfalls hat er mit seinen Sonaten und Partiten für Violine solo, im Originaltitel „Sei Solo a Violino senza Basso accompagnato“ (BWV 1001-1006) im Jahr 1720, zum Abschluss der Goldenen Periode Stradivaris gewissermaßen, als erster alle Möglichkeiten des Instruments – nicht nur in technischer, sondern auch hinsichtlich des Ausdrucks – kompositorisch in Perfektion ausgelotet.
Dabei war auch Bach, wie Blom ausführt, zuerst ein „musikalischer Handwerker“, wenngleich er aufgrund der Tätigkeit seines Vaters als Stadpfeifer wohl kaum hungern musste wie die Füssener Bauern in ihren schlimmsten Zeiten. Gleichwohl aber ist sein Vater früh gestorben – und so kam Johann Sebastian zu einem älteren Bruder, der ihm die Violine gewissermaßen abnahm und ihn in Orgel und Tonsatz unterrichtete. Bach wurde bald zu einem wahren Orgelvirtuose.
Bach hat niemals formal Komposition studiert, sondern sich sein musikalisches Wissen, wie Blom schreibt, immer immer „angeeignet, wie es Handwerker häufig taten: durch Kopieren und Imitieren und Weiterentwickeln und Üben“ der Werke anderer Komponisten. Er begreift sich dabei, durchaus der Auffassung seiner Zeit entsprechend nicht als Künstler sonder als Handwerker. Seine Kompositionen sind jedenfalls fast immer zweckgebunden und erfüllen eine bestimmte Funktion – sei es bei öffentlichen Ereignissen oder im Gottesdienst. Dort fungieren seine Kompositionen als eine Lobpreisung Gottes, der nach der Vorstellung des tief im christlichen Glauben verwurzelten Bach die von ihm angewandten musikalischen Ordnungen geschaffen habe. Fast alle seine Werke unterzeichnet Bach mit Formeln wie „Soli Deo Gratia“ (allein zur Ehre Gottes).
Spezialisierte Handwerker wie es Bach als Orgelvirtuose war, sind gezwungen auf die Walz zu gehen – also dorthin zu wandern, wo es Arbeit für sie gibt –, denn der Markt für Komponisten war, wie der für Geigenbauer, begrenzt. So entstand gewissermaßen auch Bachs „Handschrift“, wie Blom schreibt, das heißt sie „entstand aus einer Mischung regionaler Traditionen, historischer Überlieferung und internationaler Einflüsse, die er sich über zirkulierende, oft handschriftlich kopierte Noten aneignete, und durch das Zuhören bei großen Improvisatoren“, denen er auf seinen Wanderungen begegnete. Dabei lernte Bach auch Änderungen im musikalischen Geschmack kennen – der nun zunehmend von Venedig bestimmt werden sollte. Kompositionen von dort kamen zu Bachs Zeit in Mode und wurden überall studiert und gespielt, auch von ihm selbst.
Aus Venedig kam wohl auch die Inspiration für seinen Violinzyklus aus Sonaten und Partiten. Als noch unbekannter Komponist war er wohl fasziniert von den neuen Streichinstrumenten und dem Pianoforte – und „von der Idee, die technischen und vor allem die harmonischen und polyphonen Möglichkeiten der Tasten- und Streichinstrumente, die er selbst auch beherrschte, bis zum Letzten auszureizen und dabei Musik zu schreiben, die nicht nur unterhaltsam war, sondern den Musiker dazu antrieb, die Grenzen, die das Instrument ihm setzte, von vier Fingern auf vier Saiten, einzureißen“, wie Blom schreibt.
Nach Jahren als Organist kommt Johann Sebastian Bach etwa um 1709 nach Weimar. Dort erreicht sein Schaffen einen ersten Höhepunkt, bevor er als Komponist die alte polyphone Satzkunst zur Vollendung bringen sollte. Aber schon in Weimar wird deutlich, dass Bach nicht nur eine Karriere als Klavier- und Orgelvirtuose anstrebt, sondern – gerade dreißigjährig – mit aller Leidenschaft „nach den grundlegenden Gesetzmäßigkeiten von Musik fragt. Auf der Basis des obligatorischen dreistimmigen Satzes versucht er alsbald alle Bereiche der Komposition zu erfassen“, wie Martin Geck bemerkt, so entstehen alsbald die ersten Instrumentalkonzerte und Sonaten.
Es war wohl eine ganz konkrete Begegnung, die Bach dazu veranlasste, die Stücke für Violine solo zu schreiben: In Venedig gab es ja bereits eine Tradition von Solostücken für Violine, die sich aber meistens als „virtuose Feuerwerks-Konfektionen“ darstellten, die nur dazu dienten die virtuose Technik der jeweiligen Solisten zu demonstrieren (die in dieser Zeit dennoch überall in Europa gefeiert wurden). Diese Stücke waren musikalisch oft nicht besonders interessant und ganz auf die technischen Fähigkeiten eines bestimmten Spielers zugeschnitten. – Einer dieser Solisten aber war auch Johann Georg Pisendel (1687-1755), der nur zwei Jahre jünger war als Bach, und der 1716 auch eine Reise nach Venedig unternommen hatte, um von den dortigen Virtuosen zu lernen. Ein Jahr verbrachte er so auf Kosten seines Dienstherrn in der Lagunenstadt, wo er unter anderem auch mit Antonio Vivaldi zusammenarbeitete.
In technischer Hinsicht waren die italienischen Virtuosen wie Vivaldi oder auch Giuseppe Tartini (1692-1770) allen anderen Geigern Europas überlegen, Pisendel jedoch konnte mit ihnen mithalten. Und so widmete ihm Vivaldi sogar einige besonders virtuose Sonaten (wie beispielsweise das Concerto in d-Moll „Per Pisendel“, Op. 8, No. 7, RV 242). Nach Deutschland zurückgekehrt, wurde Pisendel dann Musikdirektor in Dresden und schrieb dort zahlreiche virtuose Violinstücken (wie beispielsweise das Violin Concerto in d-Dur JunP I.7).
Als Pisendel nach Deutschland zurückkommt, ist Bach noch immer in Weimar als Konzertmeister, und das heißt als Geiger, tätig. Zwar dürfte er, darauf verweist Geck in seiner Bach-Biographie, auch „als Konzertmeister und selbst als späterer Köthener Kapellmeister (…) weiterhin oft am Cembalo gesessen (haben), je nach Bedarf aber auch zu einem Streichinstrument gegriffen haben. Immerhin schreibt Carl Philipp Emanuel Bach um das Jahr 1774 an Forkel: `Als der größte Kenner u. Beurtheiler der Harmonie spielte er am liebsten die Bratsche mit angepaßter Stärcke u. Schwäche. In seiner Jugend bis zum ziemlich herannahenden Alter spielte er die Violine rein u. Durchdringend u. Hielt dadurch das Orchester in einer größeren Ordnung, als er mit dem Flügel hätte ausrichten können. Er verstand die Möglichkeiten aller Geigeninstrumente vollkommen. Dies zeugen seine Soli für die Violine und das Violoncell ohne Baß.´“
Bach kannte seinen Kollegen Pisendel, weil auch er 1709 in Weimar verweilte. Und so lernte Bach nun über ihn die neuen italienischen Satztechniken kennen und begann bald selbst, an eigenen Stücken für Violine solo zu arbeiten – vermutlich sogar noch während seiner Weimarer Zeit. Denn wegen seine wachsenden Rufs holte ihn der junge Herzog Leopold von Sachsen-Anhalt-Köthen bald zu sich nach Köthen, einem Städten mit etwa 2.000 Einwohnern und damit etwa so groß wie Füssen, wo er Bach zum Hofkapellmeister und machte und ihm, wie Geck bemerkt, „zu der äußerlich schönsten Zeit seines Leben (verhalf): Mit Hofdiensten offenbar wenig behelligt, kann Bach in den Jahren 1717 bis 1723 ganz seinen kompositorischen Neigungen folgen und wichtige Werkreihen vollenden, die er zum Teil schon in Weimar begonnen hat: die Brandenburgischen Konzerte, die Inventionen und Sinfonien für Klavier, das Wohltemperierte Klavier, die Suiten für Violine und für Violoncello solo.“
Inzwischen ist Johann Sebastian Bach zum zweiten Mal verheiratet: Die erste Frau, Maria Barbara Bach, eine Cousine zweiten Grades, hat ihm sieben Kinder geboren, ehe sie 1720 vom Tod überrascht worden ist; seine zweite Frau ist die Köthener Hofsängerin Anna Magdalena Bach. Sie wird ihm weitere dreizehn Kinder schenken, wobei von den insgesamt zwanzig Söhnen und Töchtern letztlich nur neun das Erwachsenenalter erreichen werden – eine für die damalige Zeit recht hohe Quote und eine gute Voraussetzung, um über die Jahre hinweg in wechselnden Besetzungen Stubenmusik betreiben zu können. (Hansjörg Küster verweist in „Die Alpen“ (2020) darauf, dass zwei Violinen, eine Viola beziehungswesie Bratsche und ein Violoncello auch „ein Streichquartett (bilden), eine besonders wichtige Form von Haus- oder Kammermusik, die vielleicht in einer gewissen Verwandtschaft zur Stubenmusik steht“, wie sie besonders auch in den Alpen eine lange Tradition hat. Es ist insofern vielleicht kein Zufall, dass die ersten Kompositionen für solche Quartette von Joseph Haydn (1732-1809), der als Begründer des Streichquartetts gilt, im Alpenraum entstanden sind.)
In Köthen waren Bachs Aufträge als Hofmusiker eines protestantischen Fürsten meistens mit säkularer Musik verbunden. Jedenfalls weiß er „bei seiner Berufung an den reformierten Köthener Hof“, wie Geck erklärt, „daß ihn dort keine bedeutenden Aufgaben im Bereich der Kirchenmusik, vielmehr solche im weltlichen Bereich erwarten werden. (…) Dort leitet Bach eine große Kapelle; er hat ferner, wie er rückschauend im Erdmann-Brief schreiben wird, `einen gnädigen und Music so wohl liebenden als kennenden Fürsten´.“ Die Zeit, die ihn zum größten aller Kirchenmusiker machen sollte kommt für Bach erst später, in Leipzig. Köthen ist für ihn aber, so Geck des weiteren, „ein wichtiges Beispiel dafür, daß Bach in seinem Schaffen nicht nur der jeweiligen Lebenssituation folgt, sondern zugleich seine Vorstellungen von der Ordnung der Musik Schritt für Schritt weitertreibt. (…) Bach führt in jedem Fall das universelle Wesen der Musik vor. Er tut dies in äußerer und innerer Freiheit gegenüber seinem Kapellmeisteramt und dessen Aufgaben, denkt gleichsam von der Sache her. Gleichwohl gibt es Unterschiede zu den späten Leipziger Instrumentalzyklen: Akzentuieren die Köthener Werkreihen die Vielfalt, die aus ein und demselben musikalischen Denken erwachsen kann, so betonenen die Zyklen der letzten Jahre die geistige Einheit allen musikalischen Schaffens.“
Das gilt auch für die Sei Solo für Violine, die Bach nun fertigstellt – er schreibt diese Stücke für Violine solo aber auch als Demonstrationszyklus für seine Schüler. Geck bemerkt in diesem Zusammenhang: „Obwohl die Violine nicht Bachs Lehr- und Demonstrationsinstrument ist, legt allein die autographe Handschrift dieser Werke nahe, daß ihm das Instrument gleichwohl sehr nahe gewesen sein muß: Er scheint den Armschwung des Geigers unmittelbar auf das Notenbild übertragen zu wollen. Selten findet man bei Komponisten ein Notenbild, das kalligraphisch vollendet ist und zugleich etwas vom Geist der Musik mitteilt. Melodie und Harmonie in einem – das ist die Botschaft der Sei Solo, die darüber hinaus eine Enzyklopädie des violinistischen Solospiels darstellen: Präludium, Fuge, Konzert, Aria, Variation, Tanz – alles ist auf der Geige solistisch darstellbar.“ Und all ist auch auf vier Saiten mit vier Fingern, auf Holz, Schafsdarm (heute Kunststoff), Harz und Pferdehaar spielbar.
Die jeweils drei Sonaten und Partiten BWV 1001-1006 erschienen 1720. Das Manuskript von Bachs eigener Hand kündigt das Werk an wie folgt: „Sei solo à Violino senza Basso accompagnato“, darunter das Datum der Reinschrift und der Name des Komponisten. „Dieser Titel“, so Geck, „wirft einige Fragen auf. Zum einen ist da das Datum, das ungewöhnlich ist, denn gedruckte Noten wurden im Barock meistens nicht datiert. Musikliebhaber waren an neuen Stücken interessiert, es half also nicht, das Datum aufs Titelblatt zu schreiben.“ Noch verwirrender allerdings ist ein grammatikalisches Problem, wie Blom bemerkt: „Sollte es im Italienischen nicht sei soli heißen, im Plural, nämlich `sechs Soli´ für Geige?“, fragt er.
Nun war 1720 nicht nur das Datum der Fertigstellung der Sonaten und Partiten, es markierte auch einen tiefen Verlust für Bach: Er war nämlich mit seinem Dienstherrn nach Karlsbad gereist – und als er zurückkehrte, musste er feststellen das in der Zwischenzeit seine Frau Maria Barbara gestorben war und auch schon frisch begraben wurde. Sie war jäh an einer unbekannten Krankheit gestorben. Blom schreibt: „Plötzlich wurden diese großen Stücke für ein einsames Instrument zur Hommage an eine geliebte Person, was auch der Titel andeutet: Sei solo ist nicht falsches Italienisch für `sechs Soli´, sondern völlig korrektes Italienisch für: `Du bist allein´.“
So gelingt es Bach, den eigentlich nur als Demonstrationszyklus gedachten Stücken einen Gedanken und auch ein Gefühl mitzugeben, das sonst wohl nur schwer kommunzierbar wäre. „Er hatte sich so tief hineingedacht in die Texturen und Gezeiten der Einsamkeit“, schreibt Blom. „in Zyklus, den Bach mit dem ganzen Ehrgeiz seiner jungen Jahre geschrieben und dann in einer subtilen, kaum lesbaren Geste der tiefen Trauer seiner verstorbenen Frau gewidmet hatte, trug die Botschaft: `Du bist allein´ – und überwand gleichzeitig die Einsamkeit, indem er sie zum Klingen brachte.“ Und doch bleibt es, so Geck, „Bachs Geheimnis, wie er in einer konzentrierten Verbindung von Geistigkeit und Sinnlichkeit, Abstraktion und Klangfülle, universeller und gegenwartsbezogener Tonsprache sein Prinzip `Alles aus Einem und Alles in Einem´ am Beispiel der Violinmusik verdeutlicht.“
Patricio Guzmán, Engel der Geschichte
Nur wenn auch die Schattenseiten der Geschichte in der Erinnerungskultur eines Landes berücksichtigt werden, kann es Walter Benjamin zufolge gesellschaftliche Versöhnung geben. In diesem Sinn versucht Patricio Guzmán in seinen Dokumentarfilmen die ganze Wahrheit über die chilenische Vergangenheit ans Licht zu bringen. Dazu verknüpft er Geschichte, Politik und Landschaft seiner Heimat zu einem einzigartigen Gewebe. Für Helmut Schreier …
„Dein Schweigen ist ein Komplize – der Schüsse, der Misshandlungen und der Erniedrigungen! / Dein Schweigen ist ein Komplize – der Lügen, der Gewalt und der Demütigung! / Dein Schweigen ist ein Komplize – der Ohnmacht, des Schmerzes, der Verirrung deines Gewissens! / Dein Schweigen ist ein Komplize – von Tränengas, Verachtung und Blindheit! / Dein Schweigen ist ein Komplize …“
Ein Frauenchor während der Proteste in Chile 2019, in Patricio Guzmáns Mein imaginäres Land (2022)
„Das Exil ist für mich (…) wie ein Kontinent, der in Inseln zerfällt, wo jeder in seinen eigenen Landschaften und Erinnerungen lebt. Das Exil ist nicht wie ein riesiges Land, in dem wir alle zusammen sind. Es ist etwas sehr Persönliches“, sagt die chilenische Künstlerin Emma Malig in dem Dokumentarfilm Salvador Allende (2004) von Patricio Guzmán, der, aus dem Off, erklärt: „In Emmas Malerei entdecke ich jenes Chile, das ich erlebe: ein zerstückeltes Land, wegdriftende Inseln, die nicht zueinander finden.“ / Malig: „Wenn man zurückkehrt, meint man, etwas wieder zu finden, das man zurückgelassen hat, aber das stimmt nicht.“ / Guzmán: „Wie lebt man, wenn man sich in der Heimat und im Ausland fremd fühlt? Wo lebst du?“ / Malig: „In einer Utopie, einem Ort, den ich erfinde, um weiterzumachen. Sonst kann es sehr hart sein, nirgendwo daheim zu sein. Ich stelle mir ein Schiff vor, das keinen Hafen hat und davon treibt …“
***
„(W)enn es je einen ganz und gar Vereinzelten gegeben hat, so war es Benjamin“, schreibt Hannah Arendt 1968 über Walter Benjamin. Es waren die Machtübernahme der Nationalsozialisten Ende Januar und die Massenverhaftungen nach dem Reichstagsbrand Ende Februar, die ihn als jüdischen Schriftsteller Mitte März 1933 nach Paris ins Exil gezwungen hatten. Dort lebte er praktisch ohne Einkommen in prekären Verhältnissen – finanziell nur unterstützt von Theodor W. Adorno und Max Horkheimer vom Institut für Sozialforschung, das mittlerweile von Frankfurt nach New York verlegt wurde –, als im September 1939 mit dem Einmarsch der deutschen Wehrmacht in Polen der Zweite Weltkrieg beginnt. Noch im selben Monat wird Benjamin, wie auch zahlreiche andere Flüchtlinge aus Deutschland, als „feindlicher Ausländer“ im Arbeitslager Château de Vernuche in Varennes-Vauzelles, unweit von Paris, interniert. Nach dreimonatiger Haft wird er aus der Haft entlassen und kann Ende November ins verdunkelte Paris zurückkehren, wo er in den nun folgenden Winter- und Frühjahrsmonaten 1940 seinen letzten Text – insgesamt 18 geschichtsphilosophische Thesen und zwei Anmerkungen in „Über den Begriff der Geschichte“ – schreibt.
Frankreich stand schon seit 1939 im Krieg mit Deutschland – und als im Juni 1940 die Niederlage der französischen Armee unmittelbar bevorstand, beschließt Benjamin, sich angesichts der drohenden Bombengefahr in Sicherheit zu bringen und die Stadt zu verlassen. Bald darauf schon hat die Gestapo „seine Pariser Wohnung mit Bibliothek (er hatte `die wichtigere Hälfte´ aus Deutschland retten können) und einen guten Teil der Manuskripte beschlagnahmt“, schreibt Hannah Arendt, „und er hatte Grund, sich auch um die Manuskripte Sorge zu machen, die er noch vor seiner Flucht … durch Georges Bataille in der Bibliothèque Nationale hatte unterbringen können.“ Vor allem das überwiegend im Exil in Paris geschriebene, unausgearbeitet gebliebene „Passagen-Werk“ konnte so die Zeiten überdauern. „Dialektiker sein heißt den Wind der Geschichte in den Segeln haben“, schreibt er darin. „Die Segel sind die Begriffe. Es genügt aber nicht, über die Segel zu verfügen. Die Kunst, sie setzen zu können, ist das Entscheidende.“ Das „Passagen-Werk“ wurde 1981 glücklicherweise ausfindig gemacht und anschließend auch veröffentlicht.
Benjamin selbst aber war zeitlebens vom Unglück verfolgt: Es war „sein Ungeschick“, so Arendt, das ihn „mit einer nachtwandlerisch anmutenden Präzision jeweils an den Ort (leitete), an dem das Zentrum eines Mißgeschicks sich befand oder doch wenigsten befinden konnte“. Denn nicht nur, dass sich Frankreich für ihn als Falle erwiesen hatte, ist nun auch „bekanntlich auf Paris nie eine Bombe gefallen; aber Meaux, der Ort, an den er sich begab, war ein Truppensammelplatz und wohl einer der sehr wenigen Plätze in Frankreich, die in jenen Monaten des `drôle de guerre´ [wie man diese auch als Sitzkrieg bezeichnete Phase vor dem eigentlichen Kriegsausbruch in Frankreich nannte] ernsthaft gefährdet waren.“ Wenn sich Benjamin nicht ohnehin schon in Gefahr befand, stolperte er in sie … „Die Tradition der Unterdrückten belehrt uns darüber, daß der `Ausnahmezustand´, in dem wir leben, die Regel ist“, schreibt er in dieser Zeit in der VIII. geschichtsphilosophischen These und folgert: „Wir müssen zu einem Begriff der Geschichte kommen, der dem entspricht.“
Seine lebensbedrohliche Lage deutlich vor Augen schreibt er im August 1940 an Adorno: „(D)ie völlige Ungewissheit über das, was der nächste Tag, was die nächste Stunde bringt, beherrscht seit vielen Wochen meine Existenz.“ Überall glaubt er nur noch „die Stimme des Unglücksboten herauszuhören“. Und so flüchtet Benjamin ziellos hin und her durch das unbesetzte Frankreich, zunächst nach Lourdes und von dort aus wieder weiter nach Marseille. Hannah Arendt, selbst nach Paris ins Exil geflüchtet, bemerkt in diesem Zusammenhang: „Flüchtlinge aus Hitler-Deutschland – `les réfugeés provenant d`Allemagne´, wie sie in Frankreich offiziell hießen – waren durch das Waffenstillstandsabkommen zwischen Vichy-Frankreich und dem Dritten Reich mit Auslieferung nach Deutschland bedroht, und die Vereinigten Staaten hatten zur Rettung dieser Kategorie – die notabene niemals die unpolitische Masse der Juden, welche sich dann als die bei weitem Gefährdetsten herausstellten, mitumfaßte – eine Anzahl von Emergency-Visen durch ihre Konsulate im unbesetzten Frankreich verteilen lassen. Benjamin war dank der Bemühungen des Instituts für Sozialforschung unter den Ersten, die ein solches Visum in Marseille erreichte. Er gelangte auch schnell in den Besitz eines spanischen Durchreisevisums, um nach Lissabon zu kommen und sich von dort einzuschiffen. Allerdings hatte er kein Ausreisevisum aus Frankreich, da die Vichy-Regierung, um der Gestapo gefällig zu sein, den deutschen Flüchtlingen die Ausreisegenehmigung zu diesem Zeitpunkt prinzipiell verweigerte.“
Trotzdem wollte Benjamin im September 1940 den Versuch unternehmen, illegal nach Spanien zu gelangen, um von dort über Portugal in die USA zu emigrieren. Die österreichische Widerstandskämpferin Lisa Fittko, die aus dem französischen Internierungslager Camp de Gurs hatte entkommen können und Benjamin bereits aus Paris kannte, sollte dabei seine Fluchthelferin über die Pyrenäen sein. Unterstützt vom sozialistischen Bürgermeister von Banyuls, einer kleinen Weinbaugemeinde nahe der Grenze, eingezwängt zwischen Mittelmeer und dem hier steil abfallenden Gebirge, fand sie einen Schleichweg vom französischen Roussillon über die östlichen Pyrenäen ins spanische Katalonien, in den Grenzort Port Bou, wie sie im Gespräch mit der Shoah Foundation (etwa 1:46:45 bis 2:09:10) erzählt.
Zusammen mit einigen anderen war Walter Benjamin einer der ersten Flüchtlinge, den sie auf diesem Pfad bis zur Grenze begleiten sollte, aber der herzkranke Benjamin, damals 48 Jahre alt, war körperlich schon nicht mehr auf der Höhe und die Überquerung der Pyrenäen für ihn eine kräftezehrende Anstrengung. Zudem trug er die ganze Zeit, wie Lisa Fittko in dem Gespräch bemerkt, „eine schwere Aktentasche“ mit sich. In „Mein Weg über die Pyrenäen“ (1985) berichtet Fittko: „Er hat gesagt: `Ich trenne mich nie von dieser Tasche. Die hat das Manuskript, das wichtiger ist als ich selber. Das ist mein Nachlass, und ich werd’s nie aus der Hand geben. Und worauf es mir ankommt ist, nicht in die Hände der Gestapo zu fallen – ich als Person und das Manuskript.´“
Nur mit Mühe schaffte Benjamin den Weg über das Gebirge, wobei er bei dieser Passage, wie Fittko berichtet, seinem eigenen Rhythmus folgte: „He was a very strange person and he figured out everything by his own logic. And he had figured out, that he will walk for so many minutes and then, wether he is tired or not, he will rest for so many minutes. And he had his watch and was held to go exactly by the watch. Wether he was tired or not – he got up and started walking slowly along …“ Nach einer gewissen Gehzeit legte Benjamin also seiner Logik folgend eine entsprechende Pause ein – erschöpft oder nicht (beiläufig erwähnt nur sei, dass er „unterm Saturn zur Welt kam – dem Planeten der langsamen Umdrehung, dem Gestirn des Zögerns und Verspäten“, wie er einmal schrieb). Als er das spanische Port Bou schließlich erreichte, sollte er dort jedoch keinen sicheren Hafen vorfinden, sondern es stellte sich heraus, „daß an diesem Tage die Grenze von Spanien gesperrt worden war und die Grenzbeamten die in Marseille ausgestellten Visen nicht anerkannten“, wie Arendt schreibt.
Die spanische Polizei in Port Bou teilte Benjamin mit, dass er am nächsten Tag an die mit den Deutschen kollaborierenden Franzosen ausgeliefert werden würde, was bedeutete, dass er in die Hände der Nationalsozialisten gefallen wäre. Die Situation erschien ihm Hoffnungslos, wie er in einer letzten Notiz bemerkt: „In einer aussichtslosen Lage habe ich keine andere Wahl als Schluß zu machen“, schreibt er. Dort, wo man später in einer der Buchten eine Gedenkstätte an ihn errichten wird, „(i)n einem kleinen Dorf der Pyrenäen, in dem mich niemand kennt, wird mein Leben sich vollenden.“ Ihm bleibe keine Zeit mehr für all die Briefe, die er noch hätte schreiben wollen …
So nimmt sich Walter Benjamin in der Nacht vom 25. auf den 26. September 1940 mit einer Überdosis Morphin schließlich das Leben. – Als Bertolt Brecht davon erfährt, schreibt er: „Zum Freitod des Flüchtlings W.B. // Ich höre, daß du die Hand gegen dich erhoben hast / Dem Schlächter zuvorkommend. / Acht Jahre verbannt, den Aufstieg des Feindes beobachtend / Zuletzt an eine unüberschreitbare Grenze getrieben / Hast du, heißt es, eine unüberschreitbare überschritten. // Reiche stürzen. Die Bandenführer / Schreiten daher wie Staatsmänner. Die Völker / Sieht man nicht mehr unter den Rüstungen. // So liegt die Zukunft in Finsternis, und die guten Kräfte / Sind schwach. All das sahst du / Als du den quälbaren Leib zerstörtest.“
Gründe für den Selbstmord gab es sicherlich viele – wie sollte er ohne Bibliothek leben, ohne seine Exzerpte und ausgedehnten Zitatensammlungen, in einem Land, wo er vermutlich, wie er sagte, als „letzter Europäer“ zu Ausstellungszwecken herumgereicht werden würde –, allein „(d)er Anlaß aber war ein ungewöhnliches Mißgeschick“, bemerkt Arendt. „Benjamin nahm sich in der Nacht das Leben, und seine Begleiter wurden daraufhin von den Grenzbeamten, auf die der Selbstmord doch einigen Eindruck gemacht hatte, nach Portugal durchgelassen. Die Visumsperre wurde nach einigen Wochen wieder aufgehoben. Einen Tag früher wäre er anstandslos durchgekommen, einen Tag später hätte man in Marseille gewußt, daß man zur Zeit nicht durch Spanien konnte. Nur an diesem Tag war die Katastrophe möglich.“
Ohne Schwierigkeiten könnte man Benjamins Leben als eine Folge solcher Katastrophen erzählen, so Arendt, er selbst hätte dem kaum widersprochen. Gerade deshalb aber ist es ein „so reines Zeugnis für die finsteren Zeiten und Länder des Jahrhunderts, wie das Werk, das mit so viel Verzweiflung diesem Leben abgezwungen wurde, paradigmatisch bleiben wird für die geistige Situation der Zeit“ – den „Augenblick, da die Politiker, auf die die Gegner des Faschismus gehofft hatten, am Boden liegen und ihre Niederlage mit dem Verrat an der eigenen Sache bekräftigen“, wie Benjamin selbst im Juni 1940, im Exil, auf der Flucht, am Ende seines Lebens in der X. geschichtsphilosophischen These schreibt. Insbesondere die in diesen Thesen formulierten Überlegungen Benjamins „Über den Begriff der Geschichte“ – wo er „das politische Weltkind“ der am Boden liegenden Politiker zu retten beabsichtigt –, haben bis heute nichts an Aktualität verloren. Im Gegenteil! – würde der Dialektiker anfügen.
***
Frankreich definierte seine Grenzen schon immer über die Geografie und favorisierte natürliche Grenzverläufe wie den Rhein oder eben auch die Pyrenäen. Andere Länder sehen in der gemeinsamen Sprache ein verbindendes Element und definieren ihre Grenzen entsprechend deutlich anders. Diese unterschiedlichen Vorstellungen sorgen bis heute immer wieder für Konflikte, in der Vergangenheit auch im Fall des Roussillon östlich der Pyrenäen: Diese Region gehört heute mit dem Languedoc zum Le Midi genannten Süden Frankreichs („Midi“ bedeutet, ähnlich wie „Mezzogiorno“ in Italien, „Mittag“ und ist abgeleitet vom Stand der Sonne um die Mittagszeit). Im Mittelalter wurde der Süden Frankreichs allerdings noch nicht Midi genannt, sondern Okzitanien. Denn zu dieser Zeit wurde hier Okzitanisch gesprochen – die Langue d`Oc. Das Roussillon aber gehörte damals nicht zu Frankreich, sondern seit 1258 zu Spanien – hier wurde schon immer die katalanische Sprache (català) gesprochen. Erst nach dem Ende des Dreißigjährigen Krieges (1618 bis 1648), mit dem sogenannten Pyrenäenfrieden 1659, fiel es an Frankreich – behielt sich jedoch stets seine katalanische Kultur.
Auch wenn die Pyrenäen seither die natürliche Grenze zum spanischen Katalonien bilden – noch heute sind die Menschen im Roussillon von dieser gemeinsamen Kultur beeinflusst. Und noch immer gilt den Katalanen in beiden Ländern der in den östlichen Pyrenäen liegende Pic du Canigou gleichermaßen als Heiliger Berg, als spirituelles Zentrum ihrer Kultur und Quelle tellurischer Kraft gewissermaßen – unabhängig davon, dass die Landschaft, die von seinem schneebedeckten, über 2.750 Meter hoch aufragenden Gipfel steil zum Mittelmeer hin abfällt, eine Grenze markiert, die sich für Walter Benjamin letztlich als unüberwindlich erwiesen hat …
***
Auch für den chilenischen Dokumentarfilmer Patricio Guzmán wurde ein Gebirge zu einem unüberwindlichen Hindernis – in diesem Fall die Anden, die sich als eine natürliche Barriere durch ganz Südamerika ziehen und dabei Chile, das sich auf der Pazifikseite ganz im Westen befindet, vom restlichen Kontinent – mithin der Welt – abgrenzt, geradezu isoliert, vielleicht aber auch schützt. Chile ist durchschnittlich nur 175 Kilometer breit, aber über 4.200 Kilometer lang – und scheint wie eingezwängt zwischen den riesigen Wassermassen des Pazifik im Westen und dem mächtigen Andengebirge im Osten, das sich über die gesamte Länge des Landes erstreckt. Es besteht eigentlich aus mehreren nebeneinander aufgereihten Bergketten, weshalb die Anden bisweilen auch einfach nur „Cordillera“ (spanisch für „Bergkette“) genannt werden. Etwa achtzig Prozent der Landfläche Chiles befindet sich in diesem Gebirge.
Ungeheure Kräfte sorgten für die Entstehung der Anden, denn hier treffen im Untergrund zwei gewaltige Lithosphärenplatten aufeinander: die pazifische Nazca-Platte schiebt sich hier nämlich unter die Südamerikanische Platte, wobei die eingeschmolzene Erdkruste der Nazca-Platte die zahlreichen noch aktiven Vulkane Chiles kontinuierlich mit Magma versorgt. Fast 3.000 erloschene und aktive Vulkane gibt es in den chilenischen Anden, darunter auch den 5.592 Meter hohen Láscar, einen der gefährlichsten Vulkane des Landes. Sie alle gehören zum Pazifischen Feuerring – einer Kette von Vulkanen, die sich um den gesamten Pazifik erstreckt und entstanden ist, weil sich die gewaltige Pazifische Platte überall in den Randgebieten unter die Kontinente schiebt und so entlang dieser Kette ihre zerstörerischen Kräfte entfaltet. Auch in Chile kommt es deshalb immer wieder zu heftigen Erdbeben und Vulkanausbrüchen.
Will Patricio Guzmán nun den weiten Weg über den Pazifik vermeiden, bleibt ihm keine andere Möglichkeit, als die mächtigen Gebirgsketten der Anden mit ihren in Chile über 6.000 Meter hohen Gipfeln zu überwinden, um in das Land seiner Herkunft zu gelangen. Denn wie zehntausende andere Chilenen und Chileninnen musste auch er nach dem Militärputsch unter General Augusto Pinochet 1973 aus dem Land fliehen.
Die Wahl des Sozialisten Salvador Allende zum Präsidenten war 1970 insbesondere für die armen Bevölkerungsschichten Chiles zunächst mit der großen Hoffnung auf eine gerechtere Gesellschaft verbunden, Guzmán erzählt davon in seiner Dokumentation Das erste Jahr (1971). Er war sein erster Dokumentarfilm und er wollte dort, wie er rückblickend in Salvador Allende (2004) erklärt, die „Gesichter des Volkes filmen. Allende war da“, sagt Guzmán, „er war Teil jener Menschenlandschaft, aber mir war nicht bewusst, dass es ohne ihn keine Geschichte gab.“ Denn was auch für Guzmán als Traum begann, endete nach wenigen Monaten abrupt und traumatisch im gewaltsamen und blutigen Sturz Allendes und einer 17 Jahre währenden Schreckensherrschaft.
Guzmán, der die Ereignisse damals auf der Straße mit seiner Kamera dokumentierte und die Aufnahmen später als Der Kampf um Chile (1975-1979) veröffentlichte, berichtet: „Die ersten Tage nach dem Putsch hatte ich echt Panik. (…) Ich wagte es nicht, hinauszugehen.“ Planlos durchforstete er seine Unterlagen, konnte sich aber nicht dazu durchringen, auch nur irgendetwas von dem, was sich angesammelt und was er bis dahin aufgezeichnet hat zu vernichten. „Ich wusste nicht, was tun. So vergingen drei oder vier Tage, bis die Polizei kam, um mich festzunehmen.“ Gemeinsam mit tausenden anderen politischen Gefangen wird Guzmán in einem Stadion in Santiago eingepfercht: „Wir waren hier mehrere Tausende. Ich war 15 Tage in Haft, ohne dass die Militärs wussten, wo sich meine Filmrollen befanden. Ich erinnere mich genau …“ Nur, dass er auch einen spanischen Pass hat, rettete ihn schon nach relativ wenigen Tagen aus den Fängen des Militärs. Gleichwohl muss Guzmán nun das Land verlassen. Über Umwege gelangte er nach Paris ins Exil, wo er noch heute lebt. Nach Chile ist er nie mehr dauerhaft zurückgekehrt.
Von seiner Heimat bleiben Guzmán im Exil in Paris nur Erinnerungen, was sich fortan vor Ort in Chile ereignet unklar. Richtet er den Blick zurück in seine Heimat, so versperren ihm die Anden die Sicht. Was mag aus dem Land seiner Herkunft inzwischen geworden sein? Während der Zeit des Exils, so erklärt Guzmán in Die Kordillere der Träume (2019), „erträumten (wir) uns Chile aus der Ferne. Die Kordillere ist mit ihrer Kraft und ihrem Charakter die Metapher dieses Traums.“ Die Kordillere – sie wird im Exil gewissermaßen zu seinem Heiligen Berg.
Inzwischen ist Guzmán 83 Jahre alt. Er hat länger im Ausland gelebt als zuvor in seiner alten Heimat. Die Diktatur ist seit über dreißig Jahren vorbei, Pinochet in der Zwischenzeit gestorben. Guzmán kann nach einem langen Leben im Exil, wo er mehr Zeit verbrachte als in seiner ursprünglichen Heimat, nun zwar wieder zurück in das Land seiner Herkunft und sich persönlich ein Bild vor Ort machen; Heute jedoch „(d)ie Gebirgskette zu überqueren, heißt an einen Ort zu kommen, der in tiefer Vergangenheit liegt“, erklärt Guzmán. Die Zeichen der Zeit standen damals auf friedliche Revolution, gemeinsam strebte man nach einer gerechteren und lebenswerteren Zukunft. Wenn er aber heute nach Santiago zurückkehrt, so Guzmán, sieht er nichts davon realisiert. „Eigentlich weiß ich nicht, wo ich bin“, sagt er. „Mir erscheint alles irreal. Ich fühle mich ein wenig wie ein Außerirdischer“ – wie in einem Albtraum.
Von den Träumen und Hoffnungen von damals ist nichts geblieben – sie sind zerborsten wie die Steine jenes Hauses, von dem er damals losgezogen ist, um Der Kampf um Chile zu realisieren: „Wir waren ein kleines Team von fünf Personen. Wir filmten alles: zuerst den Enthusiasmus, der uns sehr weit forttrug, uns alle und das ganze Volk. Danach die Spannungen, die zum Staatsstreich führten. Jeden Morgen gingen wir von hier aus los. Am Tag es Putsches kam ich zum letzten Mal hierher, mit der letzten Filmrolle. Ich hätte nie gedacht, dass `La Batailla de Chile´ bis heute überleben würde. Der Film ist wie der Spiegel einer Vergangenheit, die mich verfolgt.“
Blickt Guzmán auf den Ort seiner Herkunft, sieht er nichts als Verwüstungen: Das Haus, in dem, wie er sagt, „alle meine Erinnerungen“ festgehalten sind, ist heute nur noch eine verfallene Ruine, die Altstadt von Santiago gleiche einem Ruinenfeld, das Gedankengebäude von damals eingestürzt, ein Trümmerhaufen, die Hoffnungen und Träume der Vergangenheit darunter begraben. „Der Putsch war ein gewaltiges Erdbeben, das unsere Leben für immer verändert hat“, sagt Guzmán. Deshalb dieses bedrohliche Donnern, dass den Bildern immer wieder unterlegt ist – und dessen Bedeutung sich erst erschließt, als er später auf einen gewaltigen Vulkanausbruch schneidet, dessen dunkle Aschewolken den Himmel verdunkeln. –
„Nie sprach ich von der Einsamkeit, die mich seit jenem 11. September 1973 begleitet“, sagt Guzmán am Ende von Die Kordillere der Träume. „Es ist eine verborgene Angst, als wäre unter meinen Füssen etwas eingestürzt, wie bei einem Erdbeben. (…) Auf meiner Seele liegt noch immer die Asche meines zerstörten Hauses.“
***
„Rede ich von der Schönheit der Kordillere, meine ich eine umfassende, dramatische, wunderschöne … ich rede von Kraft. Auch von Sanftmut. Es gibt nichts Zärtlicheres als die Täler, die berühmten Feuchtzonen. Nichts Sanftmütigeres … Wie sich das Gras bewegt. Das Gras, insbesondere die Yareta [eine in den Anden heimische Wüstenpflanze], wie sie seit Jahrtausenden wächst und diese grünen Hügel formt“, schwelgt der Steinbildhauer Francisco Gazitúa geradezu in romantischer Schwärmerei. Für ihn ist klar, dass hier, in den Anden, „die wichtigsten Gesetze der Poesie“ lagern. Schon vor langem hat er sich deshalb hierher, in die Berge, zurückgezogen, wo er aus dem Material seines Steinbruchs, diesen Gesetzen folgend, mächtige Skulpturen herausarbeitet. „Als Bildhauer hat mir die Kordillere meinen Platz zugewiesen“, sagt er.
Die Gesetze der Poesie – auch Jacint Verdaguer (1845-1902), dessen Epos Canigó (1886) den Berg erst zum „heiligen Berg“ der Katalanen verklärte, erkannte sie in der Landschaft seiner Heimat – und ursprünglich vielleicht sogar ganz konkret in jenen Steinen aus den Pyrenäen, durch die er von der Arbeit seines Vaters, eines Steinklopfers, vertraut war. Verdaguer gilt jedenfalls als bedeutendster Dichter der Renaixenca (Renaissance), also der Wiederbelebung der seit dem Mittelalter langsam vergessenen katalanischen Sprache und Kultur im 19. Jahrhundert. Dabei war Verdaguer eigentlich Priester – aber ist es nicht bezeichnend, dass er sich der Renaixenca zuwandte, nachdem er als 28-jähriger ab 1873 drei Jahre lang als Bordseelsorger auf einem der zahlreichen Auswandererschiffe zwischen Spanien und Amerika tätig war? „Süßes Katalonien / Heimat meines Herzens / wenn es sich von dir entfernt / stirbt es vor Sehnsucht / (…) Oh Seeleute, der Wind der mich fortträgt, / er lässt mich leiden! / Ich fühle mich so krank! Bringt mich an Land, / dort möchte ich sterben!“, schreibt Verdaguer in „L`Emigrant“ (Der Auswanderer). Nun, glücklicherweise war ihm der Rückweg in die Heimat nicht versperrt …
Die Renaixenca war eine durch und durch romantische Bewegung, schon damals aber stellte man, wie heute wieder, auch die Forderung nach politischer Autonomie, sodass hier Natur, Politik und Poesie untrennbar miteinander verknüpft wurden, indem die heimatliche Landschaft nun in der Poesie mit politischer Bedeutung aufgeladen wurde: Ähnlich wie der Wald in Deutschland zur Zeit der Romantik wurde der Canigó so zu einem wichtigen Symbol für das kulturelle Selbstverständnis der Katalanen und von Veraguer in seinem Epos mit zahlreichen identitätsstiftenden Mythen und Ritualen, wie etwa der Flama del Canigó (wo alljährlich an Sant Joan das Johannisfeuer von seinem Gipfel in alle Katalanischen Länder getragen wird – lange auch als Zeichen des Widerstands gegen die franquisitische Diktatur), verwoben.
So werden Landschaft und Natur in der Romantik letztlich symbolisch – und an die identitäts- und gemeinschaftsstiftende Bedeutung des Canigó als Heiligen Berg zu glauben, fällt Veraguer als Priester sicherlich genauso leicht, wie im Wein das Blut Christi zu erblicken. Was aber, wenn die „Konsistenz der Wahrheit“, wie Benjamin sagt, fragwürdig geworden ist, wie etwa im Barock, wo der Glaube nach Reformation, Gegenreformation und dem fürchterlichen Gemetzel des Dreißigjährigen Krieges erschüttert wurde wie die Welt für Patricio Guzmán mit dem Putsch – als wäre unter den Füssen etwas eingestürzt, wie bei einem Erdbeben?
Im Barock, so erklärt uns Walter Benjamin, ist das Verhältnis der Menschen zur Welt kein symbolisches, sondern ein allegorisches: wo sich der Zusammenhang zwischen Zeichen und Bezeichnetem im Symbol wie gottgegeben offenbart, ist er hier, in der Allegorie, auseinander gefallen, zu Asche zerbröselt wie Guzmáns zerstörtes Haus gewissermaßen, nur ein Trümmerhaufen ist von ihm geblieben. Geschichte zeigt sich hier nur noch als unaufhaltsamer Niedergang, alles ist Verfall und Tod geweiht: In der Allegorie, schreibt Benjamin, „liegt die facies hippocratica [der Gesichtsausdruck eines Sterbenden] der Geschichte als erstarrte Urlandschaft dem Betrachter vor Augen. Die Geschichte in allem was sie Unzeitiges, Leidvolles, Verfehltes von Beginn an hat, prägt sich in einem Antlitz – nein in einem Totenkopfe aus“. Die Welt verwandelt sich hier in eine versteinerte, leblose Ruinenlandschaft, der Blick auf sie ist ein trostloser – wie bei Veraguers Auswanderer, dem mit der Heimat auch der Sinn des Lebens verloren scheint und der die Seeleute bittet: Ich fühle mich so krank! / Bringt mich an Land, / dort möchte ich sterben! Es ist ein melancholischer Blick, der der allegorischen Haltung zugrunde liegt. Von Schönheit, Kraft, Sanftmut und Zärtlichkeit ist hier keine Rede.
Den Gesetzen der romantischen Poesie unterlegen, kann Veraguer gar nicht anders, als dem Heimatlosen dieses Schicksal zuzuschreiben. Der Protagonist bei Benjamin hingegen hat sich dem Tod noch nicht ergeben, sondern sich nur aus dieser Welt des Leidens, schwermütig zwar, in die kontemplative Versunkenheit, die Reflexion, zurückgezogen. Unablässig sucht er dort in der Trümmerlandschaft, die er vor Augen hat, nach jenem Sinn, der sich schon lange nicht mehr von selbst offenbart. Er will wissen, verstehen, begreifen, und nimmt sich deshalb einzelne Trümmer heraus, um sie genauer zu betrachten, um sie miteinander zu vergleichen und Ähnlichkeiten zu entdecken. Er greift, wie Benjamin über den Allegoriker schreibt, „bald da bald dort aus dem wüsten Fundus, den sein Wissen ihm zur Verfügung stellt, ein Stück heraus, hält es neben ein anderes und versucht, ob sie zu einander passen: jene Bedeutung zu diesem Bild oder dieses Bild zu jener Bedeutung. Vorhersagen läßt das Ergebnis sich nie; denn es gibt keine natürliche Vermittlung zwischen den beiden.“
Da die Trümmer von sich aus keinen Sinn mehr ausstrahlen, kommt ihnen an Bedeutung nur zu, was der Allegoriker ihnen in der Reflexion verleiht. Die Allegorie wird so, wie Susan Sontag in ihrem Essay über Walter Benjamin schreibt, zu einem „Vorgang, der die Bedeutungen aus dem Versteinerten … hervorlockt“. Anders, und mit Benjamin gesagt: „Die Melancholie verrät die Welt um des Wissens willen. Aber ihre ausdauernde Versunkenheit nimmt die toten Dinge in ihre Kontemplation auf, um sie zu retten“, und zwar – wie Benjamin selbst die barocke Allegorie – vor dem Vergessen, in die Gegenwart.
Die toten Dinge in die Kontemplation aufnehmen, um sie zu retten – damit diktiert Benjamin gewissermaßen das neue Gesetz der Poesie, das Patricio Guzmán dann für seine sogenannte Trilogie der Heimat aufgreifen wird, die er 2010 mit Nostalgie des Lichts beginnt, auf das 2015 Der Perlmuttknopf folgt und die schließlich mit Die Kordillere der Träume 2019 endet. Auf der Suche nach dem, was Heimat ist, verknüpft Guzmán hier – nach zahlreichen Dokumentationen zu den politischen Ereignissen in Zusammenhang mit dem Putsch – in drei philosophischen Essays jeweils eine andere charakteristische Landschaftsformation mit der Vergangenheit und Politik Chiles zu einem einzigartigen Gewebe aus allegorischen Verweisen. Gerade aber weil er in allen diesen filmischen Essays die Geschichte in allem was sie Unzeitiges, Leidvolles, Verfehltes von Beginn an hat ins Zentrum rückt, ermöglicht Guzmán einen völlig neuen Blick auf sein Heimatland – und letztlich auch weit darüber hinaus.
***
Aufgrund seiner enormen Länge ist Chile ein klimatisch und landschaftlich ungeheuer kontrastreiches Land: Im Norden, am Südlichen Wendekreis, liegt die etwa 100.000 Quadratkilometer große Atacamawüste, eine der trockensten Wüsten der Welt, wo es an manchen Stellen seit der Zeit der spanischen Konquistadoren nicht geregnet haben soll. Die versalzten Hochebenen hier in den Anden weisen geradezu unwirkliche Landschaften mit ocker- und sandfarbenen Felsen und Schluchten auf. Das regenreiche Patagonien im Süden des Landes hingegen ist vom Wasser geprägt – hier erstreckt sich eine ausgedehnte Gletscherlandschaft über Feuerland weiter bis zum windumtosten Kap Hoorn.
Dazwischen, unweit der Hauptstadt Santiago, liegt eine weite, flache Senke – das Valle Central –, eigentlich eine Trockensteppe, die aber von mehreren Flusstälern von Ost nach West durchzogen wird, deren Flüsse zum einen die Niederschlagswasser aus den Anden in den Pazifik abführen, umgekehrt aber auch eine Art „Belüftungsschächte“ für kühle Winde und Nebel vom Pazifik darstellen. Neben diesen auflandigen Meerwinden ist der „Raco“ genannte kühle Fallwind aus den Anden der zweite wichtige Luftstrom in Chile. „Er kommt“, so erklärt es der Steinbildhauer Francisco Gazitúa in Guzmáns Die Kordillere der Träume, „am Abend und bringt einen andern Duft. Es ist der Duft der Felsen, des ersten Hügelzugs, ein säurehaltiges Gestein. Um die Anden kennen- und lieben zu lernen muss man den Ursprung des Windes kennen, der sie durchquert und uns etwas mitteilt über seine Musik, seinen Duft, über sein Aroma. Das Aroma von Stein, von Vegetation“.
„Heute riecht es anders“, sagte Guzmán schon zuvor – während das Bild gleichzeitig langsam von einem Stadtplan Santiagos auf strukturell identisch verlaufende Risse in einem Felsbrocken überblendet –, es ist „nicht dieselbe Luft, die ich damals einatmete“, der Wind aus den Bergen weht offenbar gerade nicht. Nun mag es in diesem Moment zwar windstill sein, in der Ferne sieht man vielleicht ein paar Wolken am Himmel, es muss aber ein gewaltiger Sturm gewesen sein, der hier unten alles zum Einsturz brachte und diese Trümmerlandschaft hinterlassen hat, in der sich Guzmán gerade befindet … – Es kann kein Zweifel darüber bestehen, dass es jener Sturm war, der auch Walter Benjamins Engel der Geschichte erfasst hat. Dieser Engel sitzt nicht weich und bequem auf einer der Wolken und stimmt dort, an den Saiten seiner Harfe zupfend, pausbäckig ein Halleluja an, sondern „(s)eine Augen sind aufgerissen, sein Mund steht offen und seine Flügel sind ausgespannt. Der Engel der Geschichte muß so aussehen. Er hat das Antlitz der Vergangenheit zugewendet. Wo eine Kette von Begebenheiten vor uns erscheint, da sieht er eine einzige Katastrophe, die unablässig Trümmer auf Trümmer häuft und sie ihm vor die Füße schleudert. Er möchte wohl verweilen, die Toten wecken und das Zerschlagene zusammenfügen. Aber ein Sturm weht vom Paradiese her, der sich in seinen Flügeln verfangen hat und so stark ist, daß der Engel sie nicht mehr schließen kann. Dieser Sturm treibt ihn unaufhaltsam in die Zukunft, der er den Rücken kehrt, während der Trümmerhaufen vor ihm zum Himmel wächst …“
Walter Benjamins Denkbild vom Engel der Geschichte entspringt den geschichtsphilosophischen Thesen (IX.) in „Über den Begriff der Geschichte“, die er kurz vor seinem Tod im Juni 1940 verfasst hat. Eigentlich handelt es sich dabei um eine Bildbeschreibung von Paul Klees „Angelus Novus“ (1920), eine aquarellierte Zeichnung, die Benjamin 1921 erworben hat und die ihn bis ins Pariser Exil begleitet hat. Klees Titel bezieht sich nun allerdings auf die jüdische Vorstellung nach der Gott in jedem Augenblick „eine Unzahl neuer Engel schafft, die jeder nur bestimmt sind, ehe sie ins Nichts zergehen, einen Augenblick das Lob von Gott vor seinem Thron zu singen“, wie Benjamin in „Agesilaus Santander“ noch 1933 erklärt. Im Elend des Exils aber, aus seiner Heimat vertrieben und im Angesicht der Trümmer seiner Existenz, verdunkelt sich Benjamins Blick auf diesen Engel – in dessen Augen sich für Benjamin nun die Kehrseite des vermeintlichen Fortschritts und das Entsetzen darüber widerspiegeln sowie die Trauer angesichts der kohlrabenschwarzen Erkenntnis, dass die gesamte Menschheitsgeschichte seit der Vertreibung aus dem Paradies wohl nichts anderes gewesen sein könnte als eine unsägliche Anhäufung menschlichen Leids.
Paul Klees Engel wird bei Walter Benjamin insofern zu einem Vexierbild, je nach Perspektive kann man seine Geschichte so oder so erzählen: mal singt er vor Gott ein Loblied darauf, wie sich alles entwickelt hat, mal ist ihm der Schrecken über die Ereignisse ins Gesicht geschrieben. Das aber bedeutet, dass Geschichte immer auch eine Kehrseite hat und jeder Erfolg auch seine Opfer fordert: „Es ist niemals ein Dokument der Kultur, ohne zugleich ein solches der Barbarei zu sein“, erklärt Benjamin die geschichtliche Dialektik in der VII. seiner geschichtsphilosophischen Thesen und ergänzt: „Und wie es selbst nicht frei ist von Barbarei, so ist es auch der Prozeß der Überlieferung nicht, in der es von dem einen an den anderen gefallen ist.“
Vae victis! Wehe den Besiegten! – Für Benjamin wird die Geschichtsschreibung von den Siegern diktiert. In der tradierten Überlieferung hat sich insofern Herrschaftsgeschichte eingeschrieben – während das Schicksal der Opfer bisweilen verdrängt wird, unerwähnt bleibt oder dem Vergessen anheimgefallen ist. Aber nur im „Eingedenken“ dessen, was diesen Menschen – den namenlosen Opfern der Gewalt, den Unterdrückten, der Masse der vom Fortschritt ausgeschlossen, den Benachteiligten, den Elenden, denjenigen, die Benjamin in einer Übersetzung von Baudelaires „Alte Frauen (IV)“ als „Menschenschutt“ (débris d`humanité) bezeichnet hat – an Unglück widerfahren ist, ist auch Erlösung vom erlittenen Leid als Voraussetzung zur Wiedererlangung persönlicher Würde oder auch von Glück möglich. Um es mit Benjamins Worten zu sagen: „Die Reflexion führt darauf, daß das Bild von Glück, das wir hegen, durch und durch von der Zeit tingiert ist, in welche der Verlauf unseres eigenen Daseins uns nun einmal verwiesen hat“, wie er in der II. geschichtsphilosophischen These schreibt. „Es schwingt, mit anderen Worten, in der Vorstellung des Glücks unveräußerlich die der Erlösung mit. Mit der Vorstellung von Vergangenheit, welche die Geschichte zu ihrer Sache macht, verhält es sich ebenso. Die Vergangenheit führt einen zeitlichen Index mit, durch den sie auf die Erlösung verwiesen wird. Es besteht eine geheime Verabredung zwischen den gewesenen Geschlechtern und unserem. Wir sind auf der Erde erwartet worden. Uns ist wie jedem Geschlecht, das vor uns war, eine schwache messianische Kraft mitgegeben, an welche die Vergangenheit Anspruch hat. Billig ist dieser Anspruch nicht abzufertigen.“
Eine schwache messianische Kraft – Hier kommt die Wirksamkeit eines jüdischen Messianismus bei Benjamin zum Ausdruck, dem zufolge erst der Messias selbst alles historische Geschehen vollendet und die Menschheit von ihrem Unglück befreit. Benjamin war nie völlig unbeeinflusst vom Judaismus. Während die jüdische Theologie aber im Messias „das Telos der historischen Dynamis“ sieht, betont Benjamin, dass das mit dem Messias kommende Gottesreich „nicht Ziel, sondern Ende“ der Geschichte sei. Daher habe „die Theokratie keinen politischen sondern allein einen religiösen Sinn“, während sich die „Ordnung des Profanen“ an der „Idee des Glücks“ aufzurichten habe. Und das sieht Benjamin mit der zunehmenden Hinwendung zum Marxismus in den Jahren des Exils mehr und mehr in der klassenlosen Gesellschaft verwirklicht, materialisiert. Benjamin assoziiert so jüdischen Messianismus mit historischem Materialismus, säkularisiert ihn gewissermaßen.
Insbesondere in seinem letzten, kurz vor seinem Tod verfassten Text, den geschichtsphilosophischen Thesen, wo er das Verhältnis von Judaismus und Marxismus schon in der I. These erläutert, greift Benjamin auf diesen Gedanken zurück. Das Glück aber – es existiert für Benjamin genauso wie das Unglück. Und diesem Unglück – den sozialen Katastrophen der Menschheit – wendet sich Benjamin zu. Erst in der Negation dieser Erfahrung, im Kampf dagegen, wird ihr Widerpart frei – oder wie Benjamin schreibt: „Nur um der Hoffnungslosen willen ist uns die Hoffnung gegeben.“ Die „letzte Hoffnung“ sei niemals dem eine, „der sie hegt, sondern jenen allein, für die sie gehegt wird.“
Die Erfahrung, die Benjamin hier fordert, soll den dem Vergessen anheim gegebenen Opfern der Geschichte gerecht werden. Im Bruch mit der Vorstellung eines kontinuierlichen, seine eigene Gewalt verleugnenden Geschichtsverlaufs schaffe die Erinnerung an diese Menschen nämlich einen geschichtlichen Ort, von dem auch der Anbruch einer neuen, gerechteren Zeit – als noch verborgenes revolutionäres Potential gewissermaßen – spürbar ist. In der Katastrophe oder in der Gefahr können Kräfte freigesetzt werden, schwache messianische Kräfte, die die Geschichte erlösen (oder das Volk befreien) können – Hölderlin gemäß: „Wo aber Gefahr ist, wächst / Das Rettende auch.“ Oder wie Benjamin selbst es in der VI. geschichtsphilosophischen These formuliert: „Vergangenes historisch artikulieren heißt nicht, es erkennen `wie es denn eigentlich gewesen ist´. Es heißt sich einer Erinnerung bemächtigen, wie sie im Augenblick einer Gefahr aufblitzt. Dem historischen Materialismus geht es darum, ein Bild der Vergangenheit festzuhalten, wie es sich im Augenblick der Gefahr dem historischen Subjekt unversehens einstellt. (…) In jeder Epoche muß versucht werden, die Überlieferung von neuem dem Konformismus abzugewinnen, der im Begriff steht, sie zu überwältigen. Der Messias kommt ja nicht nur als der Erlöser; er kommt als der Überwinder des Antichrist.“
***
Zu der die Geschichte rettenden Kraft muss aber auf der anderen Seite auch die Würdigung kommen. Sie ist, wie Benjamin schreibt, „Einfühlung in die Katastrophe. Geschichte hat nicht nur die Aufgabe, der Tradition der Unterdrückten habhaft zu werden, sondern auch, sie zu stiften …“ Was Benjamin hier fordert, gilt erst recht bei so traumatischen Erfahrungen, wie sie die Opfer des Terrorregimes in Chile machen mussten. Dort allerdings hat bis heute keine ernsthafte Aufarbeitung der Ereignisse stattgefunden, genauso wenig wie eine Würdigung der Opfer. Insbesondere das Militär verhinderte bislang die Etablierung einer neuen Erinnerungskultur.
In Chile wurden während der Diktatur grundlegende Menschenrechte missachtet. Der Staat war mit seinem gesamten Gewaltapparat – Armee, Polizei und Geheimdienste – über die komplette Dauer der Militärdiktatur an systematischen Folterungen und Misshandlungen von Gefangenen beteiligt, wie die beiden 1990 und 2001 eingesetzten Wahrheitskommissionen festgestellt haben. Allerdings hat die zuletzt eingesetzte Comisión Nacionál sobre Prisión y Tortura (die wegen des Vorsitzenden Bischof Sergio Valech Aldunate auch Valech-Kommission genannt wird) lediglich die Zahl von 27.255 politischen Gefangenen anerkannt, fast alle von ihnen (94 Prozent) auch Folteropfer, während die tatsächliche Zahl der Opfer vermutlich doch um mehrere Zehntausend höher liegt. Inzwischen wurde die Zahl der anerkannten Opfer zumindest auf 40.000 erhöht – bis heute aber wird ein gesellschaftlicher Versöhnungsprozess dadurch verhindert, dass die Zahl der tatsächlichen Opfer nicht ermittelt und die Verbrechen nicht rückhaltlos aufgeklärt sind.
Das hierüber bis heute Ungewissheit herrscht, liegt daran, dass die Aufklärung der Verbrechen der Diktatur staatlicherseits – insbesondere vom Militär – von Beginn an blockiert oder sabotiert wurde, wie Beatriz Brinkmann von der Menschenrechtsorganisation Centro de Salud Mental y Derechos Humas (Cintras) erklärt. Trotz der bereits 1988, nach dem Rücktritt von Pinochet, initiierten Transition in Chile (vom spanischen transición für Übergang), also der Rückkehr zur Demokratie und einer parlamentarischen Gesetzgebung sowie der Abschaffung der bis dahin verfassungsrechtlich garantierten Sonderrechte des Militärs 2005, konnten die Täter bis heute einen Mantel des Schweigens über die Ereignisse legen, sprechen allenfalls von „Auswüchsen“ oder „vereinzelten Exzessen“, die stattgefunden hätten. Ein ehrliches Mea culpa gab es jedenfalls nie.
Selbst wenn es ohnehin „keine Wiedergutmachung für die in unendlichen Foltersitzungen erlittenen Demütigungen, Angst und Schmerzen, und auch nicht für die Entwurzelung der Exilierten“ geben kann, wie Beatriz Brinkmann, selbst eine Überlebende der Folter, bemerkt, so haben Opfer von Menschenrechtsverletzungen doch zumindest ein Recht darauf, wie die Vereinten Nationen unter anderem in Artikel 14 des Übereinkommens gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (1984) festgelegt haben. Davon aber ist in Chile keine Spur: das Militär, das als einzige die ganze Geschichte kennt, aber lange alles abgestritten hat, weigert sich bis zum heutigen Tag, Verantwortung für ihre Menschenrechtsverletzungen zu übernehmen und ist dabei bis heute durch das Amnestiegesetz von 1978 geschützt, das eine effektive Strafverfolgung verhindert, sieht man von Einzelfällen ab, bei denen es auch zu Verurteilungen kam.
So kann von einem Versöhnungsprozess nach dem Vorbild der südafrikanischen Wahrheits- und Versöhnungskommission (oder wie das zuletzt auch Milo Rau mit seinem „Kongo Tribunal“ (2017) demonstrierte) in Chile also keine Rede sein. Im Gegenteil, selbst die wenigen, völlig unzureichenden Erkenntnisse, die man bisher zu den Menschenrechtsverletzungen gewinnen konnte, sollen nicht an die Öffentlichkeit und bleiben aufgrund einer Verfügung des Präsidenten von 2004 noch bis Mitte des Jahrhunderts unter Verschluss.
Damit bleibt die Wahrheit also weiterhin im Dunkeln – obwohl es inzwischen sogar ein Recht auf Wahrheit gibt. Und dieses Recht, so zitiert Brinkmann aus einem Bericht von Louis Joinet an die Menschenrechtskonvention der Vereinten Nationen, ist nicht nur ein individuelles, sondern „auch ein kollektives Recht, das historisch begründet ist und darauf abzielt zu vermeiden, dass sich in Zukunft diese Menschenrechtsverletzungen wiederholen. Gleichzeitig besteht von Seiten des Staates die `Pflicht der Erinnerung´, um geschichtlicher Desinformation vorzubeugen, die sich auf Revisionismus und Verleugnung gründet. Das Wissen um die Geschichte seiner Unterdrückung gehört, in der Tat, zum historischen Erbe eines Volkes und sollte als solches auch bewahrt werden.“
Gerade auch für die Geschichtsschreibung geht insofern eine große Verantwortung einher, gilt es doch, Geschichte in ihrer ganzen dialektischen Widersprüchlichkeit festzuhalten, die ganze Wahrheit in allen ihren Facetten. Oder wie Benjamin seine geschichtsphilosophischen Thesen fortsetzt (III. These): „Der Chronist, welcher die Ereignisse hererzählt, ohne große und kleine zu unterscheiden, trägt damit der Wahrheit Rechnung, daß nichts, was sich jemals ereignet hat, für die Geschichte verloren zu geben ist. Freilich fällt erst der erlösten Menschheit ihre Vergangenheit vollauf zu.“ – Wer also schreibt die Geschichte?
***
Für seinen Dokumentarfilm Salvador Allende (2004) kehrte Patricio Guzmán das erste Mal nach seiner Flucht vor dreißig Jahren aus dem Exil nach Chile zurück. Den Auftakt seiner Heimkehr sollte die Begegnung mit dem Mann bilden, der damals sämtliche Wände Chiles mit dem Namen Allendes bepinselte, „Mono“ Gonzales, der erzählt: „Die Wände gehörten dem Volk. In Chile gehörten die Medien der Rechten, also war die Straße für uns, was die Schlagzeile für die Zeitungen ist. Während der Kampagne der Unidad Popular [für die Präsidentschaft Salvador Allendes 1970] waren die Straßen wichtig, um das Volk zu gewinnen. Sämtliche Mauern und Wände sollten den Namen Allendes tragen.“
Sofort nach Pinochets Machtübernahme wurden diese Mauern dann jedoch übermalt – der Name Allendes sollte aus der Geschichte gestrichen werden, die Erinnerung an ihn ausgelöscht, ausradiert werden, wie das Haus Allendes, das die Luftwaffe mit einigen abgeworfenen Bomben in die Luft sprengte. „Der Linke wurde zum Feind, an dem sich dieser Feuersturm entzündete“, erklärt der Schriftsteller Jorge Baradit in Die Kordillere der Träume. „Für die Rechte war er kein Mensch. (…) Er wurde zu einem Dämon, den man eliminieren musste. Wie schon kommentiert kommt man auf eine Logik ganz im Sinne der Nazi-Ideologie. (…) In Chile gab es einen Sturm, den man archetypisch nennen könnte, das Gute gegen das Böse … Eine Erblindung, eine mythologische Blindheit: `Wir kämpfen gegen Dämonen´, die den Weg freimachte, den Anderen zu entmenschlichen und ihm mit Strom zu misshandeln, ihn zu zerstückeln, zu vergiften, zu zerstümmeln, zu verstümmeln, explodieren und verschwinden zu lassen. Ein wütiger Wahn …“, die Verblendung wagnerianisch geradezu: „Wahn! Wahn! Überall Wahn! / Wohin ich forschend blick in Stadt- und Weltchronik, / den Grund mir aufzufinden, / warum gar bis aufs Blut die Leut sich quälen und schinden / in unnütz toller Wut?“
Die Militärs installierten eine Schreckensherrschaft: Tausende Regimegegner wurden in Konzentrationslagern eingesperrt, grausam gefoltert und umgebracht, Hunderttausende waren zur Flucht ins Exil genötigt. Pinochets Diktatur etablierte ein rigides System der politischen Unterdrückung in dem jede öffentliche Kritik an der Gewaltherrschaft von den Miltiärs brutal unterbunden wurde. War man innerhalb der Bevölkerung zunächst vielleicht nur perplex ob der Gewalt, so machte sich bald eine Art Angsstarre breit. Wie eine übermächtige Drohkulisse jedenfalls ragen die Anden in Guzmáns Die Kordillere der Träume über Santiago und stehen so sinnbildlich für eine Art Mauer des Schweigens angesichts der Angst, die sich im Land ausgebreitet hat. „Wir waren Millionen, die eine tiefe Angst verspürten, wie wir sie nie zuvor gekannt hatten“, erklärt Guzmán. „Während Jahren verschwiegen wir (…) was geschehen war und was weiterhin geschah.“
Nachdem das Volk gewaltsam zum Schweigen gebracht und die Demokratie damit erstickt war, erfolgte die Umstellung der Wirtschaft auf einen radikalen Kapitalismus mit einem 1980 sogar in der Verfassung festgeschriebenen neoliberalen Wirtschaftsmodell, bei dem sämtliche Bereiche des gesellschaftlichen Lebens allein der Rentabilität untergeordnet wurden. Alles wird nun zur Ware, für alles muss bezahlt werden, selbst die Grundversorgung ist seither nicht mehr staatlich gesichert. Gewerkschaftsorganisationen und andere Verbände wurden verboten, jeder ist nun im Hinblick auf sein Überleben auf sich allein gestellt – aber nur wenige Privilegierte profitieren auch von diesem System. Alles dient nur noch der Selbstvermehrung des Kapitals, vom erwirtschafteten Reichtum der Volkswirtschaft jedenfalls kommt kaum etwas bei der arbeitenden Bevölkerung an.
So wurde die soziale Spaltung in Chile erheblich forciert, der Riss in der Gesellschaft immer breiter, sodass sich heute – lange nach dem Ende der Diktatur 1990 – noch immer zwei politische Lager praktisch unversöhnlich gegenüber stehen. Zwar gibt es heute keine Folter mehr, an der Ungerechtigkeit jedoch – dem ausbeuterischen Wirtschaftssystem und den institutionell festgeschriebenen Strukturen, die es stützen – hat sich nichts geändert seither. Der Schriftsteller Jorge Baradit bemerkt in diesem Zusammenhang in Die Kordillere der Träume: „Bis heute ist der Putsch erfolgreich. Man muss bedenken, dass der Staatsstreich zwei Dinge umfasst: das Errichten eines Wirtschaftssystems und die institutionelle Struktur, die es stützt. Also der Neoliberalismus und die Verfassung von 1980. Und das ist alles noch da. (…) Wie erreicht man diese Stabilität? Seit Anbeginn, seit den Anfängen der Republik, wird diese Stabilität durch Gewalt erzwungen.“
***
Gerade auch, weil er das „Passagen-Werk“ ursprünglich als eine Geschichte der Stadt Paris im 19. Jahrhundert plante, beschäftigte sich Walter Benjamin im Exil intensiv mit Charles Baudelaire (1821-1867), einem der wichtigsten Schriftsteller dieses Jahrhunderts. Eine Passage aus „Die Blumen des Bösen“ (1857) nimmt Benjamin dabei zum Anlass, sich ab Mitte der 1930er Jahre – inmitten der Weltwirtschaftskrise – erneut mit der barocken Allegorie auseinanderzusetzen und sie nun als eine moderne Kategorie der Welterfahrung zu aktualisieren. Baudelaire schreibt dort: „Paris verändert sich! Mir bleibt Melancholie! / (…) – alles wird Allegorie, / und schwer wie Fels muß ich Erinnerung tragen.“ (Benjamin selbst übersetzt die entsprechende Passage aus „Der Schwan (II)“ so: „Paris wird anders, aber die bleibt gleich / Melancholie. Die neue Stadt die alte / Mir wirds ein allegorischer Bereich / Und mein Erinnern wuchtet wie Basalte.“)
Baudelaire war – ähnlich wie Benjamin im Exil – ein verarmter Bohemien, der inmitten des Paris des Second Empire, der Epoche des „Hochkapitalismus“, wie Benjamin sagt, lebte. Daraus ergebe sich ein wesentlicher Unterschied zu Schriftstellern vorangegangener Zeiten: Zwar ist auch die moderne Allegorie mit der Erfahrung eines umfassenden Sinnverlusts verbunden, die aber hat nun nichts mehr mit dem Glauben zu tun, sondern eher mit der modernen Erfahrung der Entfremdung des Menschen, mit einer Art Naturverlust: „Baudelaires Ingenium, das sich aus der Melancholie nährt, ist ein allegorisches. (…) Diese Dichtung ist keine Heimatkunst, vielmehr ist der Blick des Allegorikers, der die Stadt trifft, der Blick des Entfremdeten“, schreibt Benjamin. Bei Baudelaire werde die Melancholie zum Ausdruck der Entfremdung inmitten der Verwandlung von Paris zur kapitalistischen Metropole, durch die die Stadt ihre Seele verliere, weil nun alles zur Ware werde. Benjamin schreibt diesbezüglich: „Die allegorische Anschauungsweise ist immer auf einer entwerteten Erscheinungswelt aufgebaut. Die spezifische Entwertung der Dingwelt, die in der Ware daliegt, ist das Fundament der allegorischen Intention bei Baudelaire.“
Die Entwertung beziehungsweise „Entseelung“, wie er es auch bezeichnet, besteht für Benjamin insbesondere in der gewachsenen Bedeutung des ökonomischen Werts (Tauschwert) und der damit verbundenen Verwandlung der Erscheinungswelt in die Universalität der Warenform. Im Kapitalismus kann alles gegen Geld getauscht und damit zur Ware werden. Als Ware, und durch das Geld gegeneinander verrechenbar geworden, verliere alles seine ganz spezifische Besonderheit (Gebrauchswert), das heißt die Erscheinungen der Wirklichkeit werden Benjamin zufolge nur noch als käufliche Ware wahrgenommen, ihre einzige Bedeutung sei der Preis: „In der Tat heißt die Bedeutung der Ware: Preis; eine andere hat sie, als Ware, nicht. Darum ist der Allegoriker mit der Ware in seinem Element“, erklärt Benjamin. Der Preis besetzt hier denselben Ort wie die Bedeutung in der Allegorie, das heißt sowohl zwischen Zeichen und Bedeutung als auch zwischen Ware und Preis ist jede natürliche Vermittlung ausgelöscht. Im Hinblick auf ihre abstrakte Bedeutungs- beziehungsweise Preisgestaltung sind Allegorie und Ware insofern strukturell miteinander verwandt: Der Allegoriker, so setzt Benjamin fort, „erkennt im `Preisetikett´, mit dem die Ware den Markt betritt, den Gegenstand seiner Grübelei – die Bedeutung – wieder. Die Welt, in der diese neueste Bedeutung ihn heimisch macht, ist keine freundlichere geworden. Eine Hölle tobt in der Warenseele, die doch scheinbar ihren Frieden im Preise hat.“
Die Hölle, von der Benjamin hier spricht, betrifft die Arbeit, wie sie unter kapitalistischen Verhältnissen organisiert ist. Definierte die Sozialdemokratie die Arbeit noch „als `die Quelle allen Reichtums und aller Kultur´“ – sie wolle dabei allerdings „nur die Fortschritte der Naturbeherrschung, nicht die Rückschritte der Gesellschaft wahrhaben“, wie Benjamin in seiner XI. geschichtsphilosophischen These im Hinblick auf ein sozialdemokratisches Parteiprogramm schreibt –, entgegnete Marx darauf, bereits Böses ahnend, „daß der Mensch kein anderes Eigentum besitze als seine Arbeitskraft, `der Sklave der andern Menschen sein muß die sich zu Eigentümern … gemacht haben´.“ Dieses ungleiche Verhältnis drückt sich dann auch im Warenwert aus. Denn wie Karl Marx in „Das Kapital“ (1867) ausführt, fließt die Arbeit als wertbildende Substanz immer in den Gebrauchswert einer Ware ein, dessen Wert sich wiederum aus Gebrauchs- und Tauschwert zusammensetzt: Der Wert einer Ware ist gewissermaßen die Kristallisation menschlicher Arbeit für den gesellschaftlichen Austausch, wobei der Gebrauchswert entsteht, wenn ein Naturstoff durch Arbeit in ein Produkt umgewandelt wird, das nützlich für die Befriedigung eines bestimmten Bedürfnisses ist, während der Tauschwert – seine Realitätsform ist der Preis – wiederum entsteht als das Verhältnis, worin sich Gebrauchswerte einer Art gegen Gebrauchswerte anderer Art auf dem Markt austauschen.
Im Kapitalismus nun, so Benjamin, fallen – wie die Bedeutung und das Zeichen bei der Allegorie – der Gebrauchs- und der Tauschwert bei der Ermittlung des Werts einer Ware auseinander, das heißt es zähle nur der Preis: der Gebrauchswert werde hier völlig irrelevant insofern, als seine Bedeutung vom Tauschwert, also dem Preis, komplett ausgehöhlt wird. Dadurch aber werde die Ware, Marx folgend, zum Fetisch, zu einem übersinnlichen, seelenlosen, toten Ding gewissermaßen: Ein hergestelltes Produkt wie beispielsweise ein Tisch, erklärt Marx, ist zunächst einmal nichts anderes als „ein ordinäres sinnliches Ding. Aber sobald er als Ware auftritt, verwandelt er sich in ein sinnlich übersinnliches Ding.“ Die Produkte der Warentauschgesellschaft werden nun dadurch zu übersinnlichen Mystifikationen, Fetischen, dass das an ihnen Menschliche, mithin das Sinnliche, Lebendige, getilgt ist. In dem Augenblick, wo Produkte zu käuflichen Waren werden, verschwindet der Gebrauchswert hinter dem Preis, schiebt sich das Preisetikett zwischen das Subjekt und das Produkt, sodass es in der Ware nicht mehr die Signatur seiner menschlichen Arbeit erkennt. Genau hierin, so Erich Fromm, liegt auch die Erfahrung der Entfremdung begründet: „Natürlich hat Marx niemals eine systematische Psychopathologie entwickelt, doch spricht er von einer Form der seelischen Verkrüppelung, die für ihn eine ganz grundlegende Äußerung von seelischer Krankheit ist und deren Überwindung der Sozialismus anstrebt: die Entfremdung“, erklärt Fromm. Das Wesentliche dieses Begriffs sei, „daß die Welt (die Natur, die Dinge, die anderen Menschen und der Mensch selbst) dem Menschen fremd geworden ist, er erlebt sich selbst nicht als Subjekt seiner eigenen Handlungen, als denkende, fühlende und liebende Person, sondern nur in den von ihm geschaffenen Dingen, als Objekt der veräußerlichten Manifestationen seiner Kräfte.“
Nun wird für Benjamin im Kapitalismus alles zur Ware: „Die gegenständliche Umwelt des Menschen nimmt immer rücksichtsloser den Ausdruck der Ware an“, schreibt er. „Gleichzeitig geht die Reklame daran, den Warencharakter der Dinge zu überblenden“, ihn zu ästhetisieren und gleichsam zu verhüllen. Wie ein undurchdringlichen „Schleier“, so Benjamin, der „die Gesetze der Ausbeutung“ des kapitalistischen Arbeitsprozesses – und damit den Blick in die Hölle – verhüllt, schiebt sich so ein Art schöner Schein zwischen die Ware und die Menschen. Die Ästhetisierung der Ware diene so der Verschleierung der Tatsache, dass die unmittelbaren Lebensbedürfnisse der Menschen hier eben nicht der bestimmende Zweck der Produktion sind, sondern allein der Verkauf, wie Wolfgang Fritz Haug in seiner „Kritik der Warenästhetik“ (1971) erklärt: „Die Warenproduktion setzt sich zum Ziel nicht die Produktion bestimmter Gebrauchswerte als solcher, sondern das Produzieren für den Verkauf. (…) (B)is zum Abschluß des Verkaufsaktes … spielt der Gebrauchswert nur insofern eine Rolle, als der Käufer ihn sich von der Ware verspricht. Vom Tauschwertstandpunkt aus kommt es bis zum Schluß, nämlich dem Abschluß des Kaufvertrags, nur aufs Gebrauchswertversprechen seiner Ware an. Hier liegt von vornherein ein starker, weil ökonomisch funktioneller Akzent auf der Erscheinung des Gebrauchswerts, der, den einzelnen Kaufakt betrachtet, tendenziell als bloßer Schein eine Rolle spielt. Das Ästhetische der Ware im weitesten Sinne: sinnliche Erscheinung und Sinn ihres Gebrauchswerts, löst sich hier von der Sache ab. Schein wird für den Vollzug des Kaufakts so wichtig – und faktischer wichtiger – als Sein. Was nur etwas ist, aber nicht nach `Sein´ aussieht, wird nicht gekauft. Was etwas zu sein scheint, wird wohl gekauft. Mit dem System von Verkauf und Kauf tritt auch der ästhetische Schein, das Gebrauchswertversprechen der Ware als eigenständige Verkaufsfunktion auf den Plan.“
Die Zerstörung des schönen Scheins – besonders hierin verortet Benjamin das Potenzial der Allegorie bei Baudelaire: „Die trügerische Verklärung der Warenwelt widersetzt sich ihre Entstellung ins Allegorische“, schreibt Benjamin in diesem Zusammenhang. Insbesondere die „poetische Isolierung“ und die „Überblendung“ erkennt er dabei als Techniken, mit denen Baudelaire die Dinge aus ihrer Warenförmigkeit entreißt. Die „poetische Isolierung“ erkennt Benjamin daran, dass die allegorische Abstraktion bei Baudelaire nicht allein inhaltlich geschieht, sondern auch formal, durch die Verwendung von Majuskeln, hervorgehoben ist. Wo im Französischen alle Substantive klein geschrieben werden, versperrt sich in den Gedichten Baudelaires das Vokabular – le Mal (das Böse), la Mort (der Tod), la Prostitution, le Souvenir, l`Ennui (die Langeweile), mon Désir (mein Begehren), la Nature (die Natur) oder auch le Soleil (die Sonne) tauchen unvermittelt auf – dem Sprachfluss und damit auch jeder zeitlichen Kontinuität, mithin dem geschichtlichen Fortschritt. „Plötzlich und durch nichts vorbereitet“, wie Benjamin schreibt, erscheint dann eine Allegorie inmitten des geläufigen Vokabulars. Ihre Verwendung geschieht, „ohne System“, wie bei einem durcheinander geratenen Wörterbuch, wo die Begriffe – ohnehin schon isoliert und aus ihrem Zusammenhang gerissen – völlig disparat neu angeordnet werden.
Die Allegorie als „Überblendung“ setzt Baudelaire – wie später der Film – ein, um Phänomene aus ihrem ursprünglichen Kontext heraus zu reißen und sie in ein zeitlich anderes, aber ähnliches Bedeutungsumfeld zu setzen. So lassen sich frappante Analogien beziehungsweise „unsinnliche Ähnlichkeiten“ zwischen verschiedenen Epochen darstellen, die einen neuen Blick auf die Geschichte zulassen (weshalb man in diesem Zusammenhang auch von allegorischer Geschichtsschreibung spricht).
Neben diesen progressiven Techniken der allegorischen Abstraktion gibt es bei Baudelaire aber auch noch eine allegorische Figur, an der Benjamin eine regressive Tendenz aufzeigt – wie sich in der Ware fortwährend auch Mythologie materialisiert, wie die Geschichte unentwegt mythologisch aufgeladen wird: die zur Ware gewordene Frau, die Prostituierte. Sie ist, wie Benjamin schreibt, „Verkörperung der Ware“ und „menschgewordene Allegorie“, das heißt „(i)m entseelten, doch der Lust noch zu Diensten stehenden Leib vermählen sich Allegorie und Ware“. Die Prostitution ist ein ökonomischer „Massenartikel“ und unterliegt insofern auch der nivellierenden Warenform, wie Benjamin schreibt: „Unter der Herrschaft des Warenfetischs tingiert sich der sex-appeal der Frau mehr oder minder mit dem Appell der Ware.“
Vielleicht nirgends deutlicher als an der Prostituierten zeigt sich insofern zunächst, welche menschenverachtenden Implikationen der kapitalistischen Warenwirtschaft innewohnen, indem die Warenform sogar den Körper kolonisiert. Die Prostitution steht für Benjamin dabei stellvertretend für das Proletariat, wenn er schreibt: „Die Prostitution kann in dem Augenblick den Anspruch erheben als `Arbeit´ zu gelten, in dem die Arbeit Prostitution wird.“ Nun geht es Benjamin hierbei allerdings nicht darum, die Prostituierte für den Klassenkampf zu mobilisieren. Entscheidender ist für ihn nämlich vielmehr, dass sie gerade „nicht ihre Arbeitskraft verkauft; ihr Gewerbe führt aber die Fiktion mit sich, daß sie ihre Genußfähigkeit verkaufe.“ Über die Kolonialisierung und Ökonomisierung des weiblichen Körpers hinaus, gehört zur Prostitution insofern auch die Evokation von so etwas wie Genuss bei den auf diesen Körper gerichteten Fantasien – das ist ihr Gebrauchswertversprechen sozusagen, mit dem dann gewissermaßen auch die Mythologie in der Moderne wieder kehrt. Denn dieses Versprechen übersteigt die reine Warenförmigkeit der Beziehung zwischen der Prostituierten und ihrem Kunden – und es zeigt sich, dass in die Ware immer auch die Traum- und Wunschpotenziale einer Gesellschaft, ihre Phantasmagorien, eingearbeitet wurden.
Benjamin greift hier auf einen Gedanken von Karl Marx über das Verhältnis von Warenseele und Liebesblick zurück, demzufolge das Erlebnis der Ware und das Erlebnis des Kunden exakt ineinandergreifen. Wolfgang Fritz Haug bemerkt in diesem Zusammenhang: „Wenn Marx einmal bemerkt, `die Ware liebt das Geld´, dem sie mit ihrem Preis als `mit Liebesaugen winkt´, so bewegt die Metapher sich auf sozialgeschichtlichem Grund. Denn eine Gattung der starken Reize, mit denen die Produktion von Waren zum Zwecke der Verwertung operiert, ist die der Liebesreize. Dementsprechend wirft eine ganze Warengattung Liebesblicke nach den Käufern, indem sie nichts anderes nachahmt und dabei überbietet, als deren, der Käufer, eigne Liebesblicke, die die Käufer wiederum werbend ihren menschlichen Liebesobjekten zuwerfen.“
Für den Kunden geht es darum, sich Liebe oder wenigstens Genuss zu kaufen, für die Prostituierte darum, sich in den Kunden als Geld einzufühlen, indem sie Einfühlbarkeit verkauft. Benjamin greift diesen Gedanken von Marx auf und arbeitet ihn seinerseits zu einem dialektischen „Schema der Einfühlung“ um, über das er in einer Anmerkung schreibt: „Es ist ein doppeltes. Es umfaßt das Erlebnis der Ware und das Erlebnis des Kunden. Das Erlebnis der Ware ist die Einfühlung in den Kunden. Die Einfühlung in den Kunden ist die Einfühlung in das Geld. (…) Das Erlebnis des Kunden ist die Einfühlung in die Ware. Einfühlung in die Ware ist die Einfühlung in den Preis (den Tauschwert).“
Benjamin geht es hier darum, zu zeigen, dass bei Baudelaire die Prostituierte „als (die) die allegorische Anschauung am vollkommensten erfüllende Ware“ erfasst wird, wie Benjamin schreibt. Er rückt dabei das Psychologische der Marx`schen Bemerkung auf die Prostituierte als Ware: von ihrem Begehren geht es aus. Es ist also nicht so, wie es scheint, dass nämlich die Menschen sich Waren aneignen, sondern vielmehr umgekehrt so, dass diese sich über den Umweg des Geldes den Menschen aneignen, indem sie ihm als phantasmagorisches Gebrauchswertversprechen zu Diensten stehen. So findet die Warenform im Sexualobjekt schließlich ihre fetischistische Personifikation, oder wie Benjamin bemerkt: „Die Ware sucht sich selbst ins Gesicht zu sehen. Ihre Menschwerdung feiert sie in der Hure.“
Die Ware, die sich selbst ins Gesicht sieht – Ist das Schema der Einfühlung vom Augen-Blick bestimmt, so besitzt die Frau als Ware bei Baudelaire Augen, denen das Vermögen zu blicken verloren gegangen ist: „Er ist blicklosen Augen verfallen und begibt sich ohne Illusion in ihren Machtbereich“, schreibt Benjamin über Baudelaire, der sich in diesem Sinn der Warenförmigkeit ausliefert. Hierin liegt auch Baudelaires Melancholie begründet – und begreift man diese blicklosen Augen als jenen bodenlosen Abgrund, der sich vor Baudelaire auftut, dann fehlt diesen Augen insbesondere der Blick in die Sterne im Sinne einer „träumerischen Verlorenheit an die Ferne“, wie Benjamin schreibt. „In der Symbolik der Völker kann die Ferne des Raumes für die der Zeiten stehen. Daher die Sternschnuppe, welche in die unendliche Ferne der Zeiten stürzt, und zum Symbol des erfüllten Wunsches geworden ist.“ Baudelaires Abgrund, so Benjamin, „ist der sternenlose. In der Tat ist die Lyrik von Baudelaire die erste, in der die Sterne nicht vorkommen.“
In den Augen der Prostituierten, in der Phantasmagorie der Waren, wie sie von Baudelaire immer wieder beschworen wird – in ihnen ist aller „Zauber der Ferne“ erloschen. Genau deshalb aber bleibe Baudelaire letztlich – trotz des subversiven Potentials der poetischen Allegorie – im kapitalistischen System der Warenproduktion verhaftet und ziele nicht auf dessen revolutionäre Sprengung: „Der destruktive Impuls Baudelaires ist nirgends an der Abschaffung dessen interessiert, was ihm verfällt“, schreibt Benjamin über den Verfasser der „Blumen des Bösen“ und ergänzt in der IV. geschichtsphilosophischen These: „Der Klassenkampf, der einem Historiker, der an Marx geschult ist, immer vor Augen steht, ist ein Kampf um die rohen und materiellen Dinge, ohne die es keine feinen und spirituellen gibt. Trotzdem sind diese letzteren im Klassenkampf anders zugegen denn als die Vorstellung einer Beute, die an den Sieger fällt. Sie sind als Zuversicht, als Mut, als Humor, als List, als Unentwegtheit in diesem Kampf lebendig, und sie wirken in die Ferne der Zeit zurück. Sie werden immer von neuem jeden Sieg, der den Herrschenden jemals zugefallen ist, in Frage stellen. Wie Blumen ihr Haupt nach der Sonne wenden, so strebt, kraft eines Heliotropismus geheimer Art, das Gewesene der Sonne sich zuzuwenden, die am Himmel der Geschichte im Aufgehen ist. Auf diese unscheinbarste von allen Veränderungen muß sich der historische Materialist verstehen.“
***
Schon in Zusammenhang mit seiner früheren Auseinandersetzung mit Bertolt Brecht hat Benjamin erklärt, „daß es für den Kapitalismus gut ist, wenn er sich eine gewisse Rückständigkeit bewahrt“. Er tut das insbesondere mit der Ästhetisierung der Ware, wo die Verschmelzung von Kapital und Mythos (im phantasmagorischen Gebrauchswertversprechen) in der attraktiv verhüllten Ware objektiv nicht zur Befriedigung der Bedürfnisse der Arbeiter und Arbeiterinnen, der Verbesserung ihrer prekären Lage, und auch nicht der Realisierung von Humanitätsidealen wie Freiheit oder Gerechtigkeit dient, sondern allein dem Profitinteresse einiger weniger und der Tarnung und Bewahrung der Privilegienstruktur der kapitalistischen Gesellschaftsordnung. Genau gegen diese Diskrepanz richtet sich Benjamins Kritik – und genau dagegen, gegen die ungerechte Verteilung des Wohlstands, richteten sich auch in Chile bereits 2011 erste Proteste.
Schon damals begannen sich erste Risse in der während der Diktatur errichteten Mauer des Schweigens zu bilden, dann jedoch bringt eine Preiserhöhung im öffentlichen Nahverkehr im Oktober 2019 die Unzufriedenheit in der Gesellschaft zur Explosion und sprengt diese Mauer. Die lange aufgestaute Wut und Empörung entfesselten sich nun und eskalierten zu einem Straßenkampf, als die Polizei damit begann, den Protest gewaltsam zu unterdrücken. Patricio Guzmán ist dieses Mal zwar „nicht vor Ort, um die erste Flamme zu filmen“, erklärt er in seinem jüngsten Dokumentarfilm Mein imaginäres Land (2022), als er dann aber mit seiner Kamera in Chile ankommt, liegen überall auf der Straße „die Steine der Kordilleren. Sie sind überall zerstreut, und es sind viele, als hätte es hier Steine geregnet.“ Die Fotografin Nicole Kramm, die bei diesen Kämpfen ein Auge verloren hat, erklärt: „Das waren die Waffen des Volkes, Steine. Sie zerschlugen den Asphalt mit dem Hammer, schlugen drauf, bis sich die Steine lösten, denn sie waren ihre einzige Waffe.“
Als der Präsident erklärte, man befinde sich in „einem Krieg“, schlossen sich dem Protest über eine Million Menschen an, die sich in diesen Tagen im Stadtzentrum von Santiago versammelten – der Protest wurde zum Volksaufstand. Auch die Studentin Catalina Garay hatte sich auf den Weg gemacht: „Es war sehr seltsam in einer U-Bahn-Station zuzusteigen und in einem ganz anderen Chile wieder auszusteigen. (…) Wir kämpfen für das, was uns zusteht, nämlich die Würde.“ Rasch wurde der Versammlungsort im Zentrum der Stadt in „Platz der Würde“ umbenannt – und aus dem Kampf entwickelte sich der größte Volksaufstand in der Geschichte des Landes. Die Schriftstellerin Nona Fernández sagt dazu in Guzmáns Dokumentation: „`Ausbruch´ trifft es nicht genau, es war wie eine Erlösung: rausgehen, sich ausdrücken, es hinausschreien. (…) Wie wenn die Seele in den Körper zurückkehrt: Wow, wie eigenartig, ich bin entflammt. Wir sind entflammt.“
Wir – das sind insbesondere die Frauen. Sie sind es – es gibt weder eine organisierende Instanz noch eine Hierarchie – die den Protest tragen: „Diese Bewegung trägt das Gesicht und die Stimme der Frau“, sagt die Jounalistin Mónica González. Entsprechend kommen in Guzmáns Dokumentarfilm auch nur sie zu Wort – zum Beispiel Sibila Sotomayor vom Colectivo Las Tesis: „In Chile dauert der soziale Aufstand schon ein Jahr. Er ist massiv. Eine Revolte (…)Wir wollen mit dem System brechen, das uns in eine zutiefst unmenschliche, prekäre Lage gebracht hat. Die Menschen auf der Straße verlangen … eine verfassungsgebende Versammlung. (…) Symbolisch gesehen ist das ein wichtiger erster Schritt, weil es wirklich hart ist, immer noch in einem Land zu leben, das nach Gesetzen einer Militärdiktatur regiert wird und wir die direkten Konsequenzen tragen von jener schrecklichen Zeit in unserer Geschichte. (…) Es geht um einen soziokulturellen Wandel. Deshalb sagen wir auch immer, dass die Forderungen des sozialen Aufstands, der Revolte, auch feministisch sind. Weshalb die Lösungen aus einer feministischen Perspektive heraus angegangen werden sollten.“
Für Benjamin ist klar, wie er in der XII. geschichtsphilosophischen These schreibt: „Das Subjekt historischer Erkenntnis ist die kämpfende, unterdrückte Klasse selbst. Bei Marx tritt sie als die letzte geknechtete, als die rächende Klasse auf, die das Werk der Befreiung im Namen von Generationen Geschlagener zu Ende führt.“ Er lässt hier offen, wen genau er im Sinn hat, Hauptsache man hat „den Haß wie den Opferwillen“ nicht verlernt. Dezidiert nicht ausgeschlossen sind jedenfalls die Frauen, auch wenn es sich bei ihnen per definitionem nicht um eine soziale Klasse handelt. Am Ende steht bei Benjamin ohnehin die befreite, klassenlose Gesellschaft, ganz abgesehen davon , dass Sibila Sotomayor solche Spitzfindigkeiten sowieso egal sind: „Wir möchten endlich leben, statt nur überleben. (…) Also wenn es nach uns geht, soll das neoliberale System lichterloh brennen, soll das Patriarchat licherloh brennen und all die üblen Institutionen, die die Situation zementiert haben, in der wir heute sind. (…) Solange nicht alle Unterdrückungsmechanismen ausgemerzt sind, werden wir immer die gleichen Probleme haben. So einfach ist das. Weil es ein sehr perverses System ist …“
… dessen kolonisierenden Blicken sich die Frauen des Colecitvo Las Tesis, wie Justitia, mit schwarzen Augenbinden entziehen, emanzipieren, die sie bei der Aufführung ihres Gedichts „Der Vergewaltiger bist du!“ tragen: „Das Patriarchat ist ein Richter, / der uns bei unserer Geburt verurteilt. / Und unsere Strafe ist die Gewalt, die du nicht siehst. // Das Patriarchat ist ein Richter, / der uns bei unserer Geburt verurteilt. / Und unsere Strafe ist die Gewalt, die du bereits siehst: // Die Strafe ist der Femizid, die Straffreiheit für meinen Mörder, / sie ist das Verschwinden, sie ist die Vergewaltigung. // Und schuld war weder ich, / noch wo ich war / oder wie ich angezogen war! // Der Vergewaltiger warst du! // Es sind die Bullen, / die Richter, / der Staat, / der Präsident! // Der Unterdrückerstaat ist ein vergewaltigender Mann! / Der Vergewaltiger bist du!“
Die erste Aufführung des Gedichts wurde von der Polizei mit Tränengas aufgelöst, wie man im Abspann der Aufzeichnung noch sehen kann; bei der Wiederholung ein paar Tage später haben sich bereits hunderte(!) Frauen vor dem Estadio Nacional de Chile – dem Stadion in Santiago, das nach dem Putsch für mehr als drei Monate als Konzentrationslager und Folterstätte genutzt wurde (mehr als 40.000 Gefangene, auch Patricio Guzmán, wurden hier festgehalten) – versammelt. Gerade auch wegen diesen ungeheuren Menschenmassen auf der Straße, setzte der Präsident nun das Militär ein, das die Demonstrant*innen dann mit Kriegswaffen attackierte.
„Ich hatte es außer unter der Militärregierung nie erlebt, dass ein Staatschef auf die Armee zurückgreift, um einen sozialen Konflikt zu lösen“, kommentiert Guzmán die Situation. „Als Chilene erinnert mich das Militär auf den Straßen an den Staatsstreich.“ Wieder setzt der Staat also auf brutale Gewalt – und wieder gibt es Tote und etwa 12.000 Verletzte, darunter etwa 2.000 mit Schussverletzungen. Wieder tut man den Menschen „Leid fürs Leben“ an, wie Nicole Kramm im Hinblick auf ihre Verletzung sagt. Als ob sich nichts geändert hätte: „Die Unterdrückung ist so brutal, dass sie Wut und Verzweiflung auslöst“, sagt Guzmán. „Ich sorge mich um den Ausgang dieses Kampfes. Wer wird zu den Verlierern und wer zu den Siegern gehören?“
***
„Es herrscht immer noch ein Ausmaß an Gewalt, das vorher nicht an die Oberfläche kam“, sagt die Politikwissenschaftlerin Claudia Heiss in Guzmáns Dokumentation dazu. „Ich glaube, es zeigt auch klar unser Problem mit der Polizei, das nicht neu ist. Das hat nichts mit der Revolte zu tun, sondern ist ein altes Problem. Sichtbar an der militärischen Art, mit der der Protest unterdrückt wird. (…) Es gibt eine komplette Spaltung zwischen Streitkräften und ziviler Bevölkerung. Es gibt keine staatliche Kontrolle, des Staates Chile, über das, was in der Militärakademie gelehrt wird oder bei der Polizei. Da sind noch Probleme von der Diktatur begraben. Ich glaube, dass wir heute, mit der Revolte und dem Polizeigebaren den Preis dafür zahlen, die geerbten Probleme der Diktatur nicht anerkannt und geregelt zu haben.“
Von der Diktatur begraben – Tatsächlich wurden zahllose Folteropfer während der Diktatur in der Atacamawüste verscharrt. Es handelt sich um die sogenannten Desaparecidos, die Verschwundenen, die von den Militärs heimlich verhaftet oder entführt und anschließend gefoltert und ermordet wurden. Offiziellen Zahlen der Regierung zufolge sind 1.094 Personen während der Diktatur verschwunden, vermutlich aber sind es wesentlich mehr. Die Leichen von mehr als 3.000 Opfern, so erklärt jedenfalls Guzmán in Nostalgie des Lichts, wurden beseitigt, indem man sie anonym irgendwo in der Wüste verscharrte und dem Vergessen anheim gab. Bewusst ließ man die Angehörigen über das Verschwinden dieser Menschen und ihr Schicksal im Unklaren – das gehörte als Teil des Unterdrückungssystems zu einer Strategie, die den zu vernichtenden Feind als inmitten der Gesellschaft (enemigo interno) definierte, sodass dieser Begriff letztlich abgelöst von einem klar definierten Gegner auf praktisch die gesamte Bevölkerung ausgedehnt wurde und sich entsprechend niemand mehr sicher fühlen konnte.
Da die Ermordung in der Regel streng geheim gehalten wird und staatliche Behörden jegliche Beteiligung bis heute abstreiten, verbleiben die Verwandten oft jahrelang in einem verzweifelten Zustand zwischen Hoffnung und Resignation, obwohl die Opfer häufig bereits kurze Zeit nach ihrem Verschwinden getötet wurde. Damit man ihre Leichen nicht findet, wurden sie später allerdings aus ihrem ursprünglichen Grab exhumiert und dann in der Weite der Atacamawüste ein zweites Mal verscharrt. Noch heute suchen die Angehörigen– auch hier sind es vor allem Frauen – verzweifelt nach den Überresten der Verschwundenen, um sie ordentlich bestatten zu können. Sie wollen eine letzte Ruhestätte für sie.
Viele konnte man tatsächlich schon finden, aber über 1.200 sind noch immer Verschwunden. Oft allerdings findet man von den Opfern überdies nur noch Bruchstücke, die nicht mehr einzelnen Menschen zugeordnet werden können – und die deshalb bis heute in hunderten Kartons in irgendwelchen Archiven in Santiago lagern. Ein Archäologe, der die Hinterbliebenen bei der Exhumierung der Knochen unterstützt, erklärt in Guzmáns Nostalgie des Lichts: „Bei ihrer Suche in der Wüste entdeckten sie etwas sehr Merkwürdiges … winzige Teile menschlicher Knochen. Ein Experte bestätigte ihnen, dass es menschliche Knochen waren. Aber es waren keine Skelette. Es waren Bruchstücke von einem Schädel, von einem Fuß, vielleicht Splitter von einem langen Knochen. Als sie uns an den Fundort brachten, wurde uns Archäologen klar, dass die Erde [mit einem Bagger] umgegraben worden war. (…) Die Körper von Calama wurden auf höchsten Militärbefehl ausgegraben. Aber es fielen auf der rechten Seite [der Baggerschaufel] die Schädelreste herunter und auf der linken Seite die Füße. (…) Die Körper wurden dann weggeschafft und man weiß bis heute nicht, wo sie sind. Aber dieser LKW hatte einen Fahrer. Dieser LKW hatte Soldaten, um die Körper auszuladen. Und am allerwichtigsten, der LKW war Teil eines Kommandos, einer Militärabteilung mit militärischen Befugnissen. Es ist an ihnen, die Informationen herauszugeben, damit die Freunde von Calama ihre Toten begraben können, wie es sich gehört.“
Bis heute aber finden die Knochensucherinnen der Atacamawüste – an vielen Orten gab es Gruppen suchender Frauen – keine gesellschaftliche Unterstützung, noch nicht einmal wirklich Verständnis. Gerade weil noch immer stets neue Opfer auftauchen – und mit ihnen alte Wunden aufgerissen werden. Bei Guzmán kommen sie zu Wort. Auch ohne explizite Bilder ist die Gewalt der Diktatur so ständig präsent. Sie wirkt bis heute tief bei diesen Frauen nach – ist nach wie vor unabgeschlossen und unverarbeitet, bewältigt ohnehin nicht. Violeta Berrios erzählt: „Ich habe viele Fragen und kann sie mir nicht beantworten. (…) In meinem Alter, ich bin 70, fällt es mir schwer, an etwas zu glauben. Sie haben mich gelehrt, an nichts zu glauben. (…) Manchmal denke ich, ich bin eine Idiotin, die nur Fragen über Fragen stellt. Und niemand gibt mir am Ende die Antwort, die ich erwarte. (…) Aber die Hoffnung gibt viel Kraft (…) und der Wunsch sie zu finden ist noch stärker.“
Eigentlich obliegt dem Staat die Verantwortung für die Suche nach den Verschwundenen – und tatsächlich hat Gabriel Boric, der seit März 2022 Präsident in Chile ist und sich in der Tradition Allendes sieht, erstmals einen Plan de Búsqueda angekündigt, eine staatliche Suchaktion. „Uns treibt nicht der Groll an, sondern die Überzeugung, dass wir nur eine freiere Zukunft aufbauen können, die das Leben und die Menschenwürde respektiert, wenn wir die ganze Wahrheit kennen“, sagte er bei der Vorstellung des Suchplans. Es ist das erste Mal, dass eine Regierung offiziell die Umstände des Verschwindens der Opfer aufklären und Wiedergutmachung betreiben will. Aber die Widerstände dagegen sind groß, denn auch Jahrzehnte nach der Diktatur ist der kritische Blick auf diese Zeit keineswegs Konsens in einer chilenischen Gesellschaft, in der die Rechte erneut erstarkt ist und auch rechtsextreme Parteien an der aktuellen Regierung beteiligt sind. Umfragen von 2023 zufolge sind tatsächlich ein Drittel der Chilenen und Chileninnen der Meinung, dass die Militärs damals „im Recht“ waren – während die Angehörigen der Opfer bis heute unter der Geschichte leiden und bislang vergeblich auf eine klare Benennung der Täter warten, selbst wenn die bereits gestorben sind.
Und so bleiben die Desaparecidos wohl eine Narbe im kollektiven Gedächtnis des Landes, die bis heute schmerzt. Denn, wie der Archäologe sagt, „wenn mein Kind erschossen worden wäre (…) ich könnte das nicht vergessen. Ich wäre moralisch verpflichtet, das Andenken zu bewahren. Es ist nicht möglich, unsere Toten zu vergessen. Man muss sie in Erinnerung behalten. Die Justiz muss ihre Arbeit machen können. Sämtliche Menschenrechtsorganisationen müssen ihre Arbeit tun dürfen. (…) Aber eine Tragödie dieser Art vergessen? Das ist absolut unmöglich.“ Wie für Antigone, deren Brüder sich beim Kampf um die Herrschaft gegenseitig getötet haben und der König Kreon nun verbietet, den Leichnam des Angreifers zu bestatten, wie Sophokles schreibt: „Das Brüdergrab – was hat uns Kreon draus gemacht? / Gewährt`s dem einen und versagt`s dem anderen! / Eteokles, so heißt es, hat er beigesetzt (…) / Des Polyneikes armer Leichnam aber darf – / ja, dies Verbot soll in der Stadt verkündet sein – / niemand im Grabe bergen, hell bejammern gar; / nein, keine Träne ihm, kein Grab! (…) – jedem Täter droht / Mord durch den Volkszorn: öffentliche Steinigung! (…) Ob du wohl Hand in Hand mit mir den Leichnam trägst? (…) er bleibt für mich und dich, sträubst du dich auch, / der Bruder! Niemand nenn mich je Verräterin! (…) Nein, denke, was du willst! Ihn aber werde ich begraben. Schön dünkt mich für solches Tun der Tod. Einander lieb ruhn wir vereint (…) Erst wenn die Kräfte mir versagen, geb ich`s auf.“
Wer Gerechtigkeit will, der darf bei seinem Kampf dafür die Hoffnung nicht verlieren – und muss versuchen, „die Überlieferung von neuem dem Konformismus abzugewinnen, der im Begriff steht, sie zu überwältigen“, wie Benjamin in seiner VI. geschichtsphilosophischen These schreibt. „Nur dem Geschichtsschreiber wohnt die Gabe bei, im Vergangenen den Funken der Hoffnung anzufachen, der davon durchdrungen ist: auch die Toten werden vor dem Feind, wenn er siegt, nicht sicher sein. Und dieser Feind hat zu siegen nicht aufgehört.“
***
In dem Gedanken, dass nur die Rückwendung in die Vergangenheit die Zukunft befördere, liegt der geschichtsphilosophische Impuls von Benjamin. Er betont in diesem Zusammenhang jedoch die Notwendigkeit, sich insbesondere auch das in der bisherigen Geschichtsschreibung Unabgegoltene zu vergegenwärtigen – die Würdigung der dem Vergessen anheimgegebenen namenlosen Opfer der sozialen Katastrophen, der Toten der Vergangenheit. Ansonsten werde weiterhin nur jene Geschichte erzählt und tradiert, die ihre Gewalttätigkeiten verdrängt oder beschwichtigend in ihren Fortschrittsglauben eingearbeitet hat. Das meint Benjamin, wenn er schreibt: „Der Begriff des Fortschritts ist in der Idee der Katastrophe zu fundieren. Dass es `so weiter´ geht, ist die Katastrophe. Sie ist nicht das jeweils Bevorstehende, sondern das jeweils Gegebene.“
Die Geschichtsschreibung, die Benjamin im Sinn hat, drängt auf eine Unterbrechung des weiter so – und genau auf eine solche Unterbrechung zielt auch, auf einer individuellen Ebene, sein Begriff des Eingedenkens. Wie bei der Geschichtsschreibung auf sozialer Ebene, geht es Benjamin beim Eingedenken darum, in der Vergangenheit das geschichtlich Unabgegoltene aufzuspüren – und zwar, wie die Knochensucherinnen der Atacamawüste, durchaus grabend: Das Eingedenken gleicht für Benjamin der archäologischen Ausgrabung, wie er schreibt, denn „(d)ie Sprache hat es unmißverständlich bedeutet, daß das Gedächtnis nicht ein Instrument für die Erkundung des Vergangnen ist, vielmehr das Medium. Es ist das Medium des Erlebten wie das Erdreich das Medium ist, in dem die alten Städte verschüttet liegen. Wer sich der eignen verschütteten Vergangenheit zu nähern trachtet, muß sich verhalten wie ein Mann, der gräbt. (…) Und gewiß ist’s nützlich, bei Grabungen nach Plänen vorzugehen. Doch ebenso ist unerläßlich der behutsame, tastende Spatenstich in’s dunkle Erdreich.“ Das vergebliche Suchen gehört dazu so gut wie das glückliche.
Erinnerung wird so zu einer Art Archäologie. Anders allerdings als bei ausgegrabenen Artefakten, die womöglich dauerhaft in einem Museum ausgestellt werden, sind die beim Akt des Eingedenkens unvermittelt auftauchenden Bilder immer vergänglich, wie Benjamin in der V. geschichtsphilosophischen These schreibt: „Das wahre Bild der Vergangenheit huscht vorbei. Nur als Bild, das auf Nimmerwiedersehen im Augenblick seiner Erkennbarkeit eben aufblitzt, ist die Vergangenheit festzuhalten. (…) Denn es ist ein unwiederbringliches Bild der Vergangenheit, das mit jeder Gegenwart zu verschwinden droht, die sich nicht in ihm gemeint erkannte.“
In ihm gemeint – Anders als die bloße Erinnerung, die einem plötzlich und ungeplant widerfährt, ist das Eingedenken stets mit einem persönlichen Interesse verbunden, weshalb die Intention – die immer auch eine These über den inneren Zusammenhang der geschichtlichen Ereignisse ist – auch am Beginn des Eingedenkens steht. Zu behaupten, man gebe die Geschehnisse der Vergangenheit objektiv wieder, ist immer schon ideologisch – gerade deshalb aber es geht es auch gar nicht um die Erfassung einer „Masse von Daten“, nicht darum, zu erkennen „wie es denn eigentlich gewesen ist“, wie Benjamin in seinen geschichtsphilosophischen Thesen schreibt, sondern um einen Akt, in den eigene Erfahrungen in die Erinnerung einfließen.
Die Bedeutung dessen, auf was man bei der Grabung stößt, erschließt sich erst im Hinblick auf das persönliche Interesse. Denn „der betrügt sich selber um das Beste, der nur das Inventar der Funde macht“, schreibt Benjamin. Umso wichtiger aber ist es dann, zu erklären, von welchem Standpunkt aus man auf die Vergangenheit blickt: Man müsse, so Benjamin, „im heutigen Boden Ort und Stelle bezeichnen (können), an denen er das Alte aufbewahrt. So müssen wahrhafte Erinnerungen viel weniger berichtend verfahren als genau den Ort bezeichnen, an dem der Forscher ihrer habhaft wurde. Im strengsten Sinne episch und rhapsodisch muß daher wirkliche Erinnerung ein Bild zugleich von dem der sich erinnert geben, wie ein guter archäologischer Bericht nicht nur die Schichten angeben muß, aus denen seine Fundobjekte stammen, sondern jene andern vor allem, welche vorher zu durchstoßen waren.“
Benjamin spricht in Zusammenhang mit dem interessegeleiteten Blick auf die Geschichte auch von einer kopernikanischen Wendung. Er richtet sich damit gegen das Prinzip der Kausalität, mit dem Geschichte von der persönlichen Erfahrung der Subjekte abgetrennt wurde – und lässt sie so erst zu ihrem Recht kommen. Benjamin schreibt: „Die kopernikanische Wendung in der geschichtlichen Anschauung ist diese: man hielt für den fixen Punkt das `Gewesene´ und sah die Gegenwart bemüht, an dieses Feste die Erkenntnis tastend heranzuführen. Nun soll sich dieses Verhältnis umkehren …“ Im Eingedenken wird ihm zufolge die Gegenwart durch die Vergangenheit hergestellt, wie sie umgekehrt aber diese Vergangenheit erst herstellt.
Darin liegt der Unterschied: Während die traditionelle Geschichtsschreibung versucht „das `ewige´ Bild der Vergangenheit“ zu schreiben, kommt hier „eine Erfahrung mit ihr, die einzig dasteht“ zum Ausdruck. Geschichte wird gewissermaßen persönlich – je nach These wird eine bestimmte Vergangenheit als relevant erkannt. Und gerade dies, dass in einem bestimmten Moment eine bestimmte Vergangenheit Bedeutung erhält, markiert ihn in seiner Einmaligkeit. Diese Erfahrung nun in ihrer Einmaligkeit festzuhalten, ist Aufgabe des Eingedenkens. Denn, wie Benjamin in der XVI. geschichtsphilosophischen These schreibt: „Auf den Begriff einer Gegenwart, die nicht Übergang ist, sondern in der Zeit einsteht und zum Stillstand gekommen ist, kann der historische Materialist nicht verzichten. Denn dieser Begriff definiert eben die Gegenwart, in der er für seine Person Geschichte schreibt.“
War Geschichte bislang, wie Benjamin in der XIII. geschichtsphilosophischen These schreibt, von „der Vorstellung ihres eine homogene und leere Zeit durchlaufenden Fortgangs nicht abzulösen“, und wurde die Gegenwart in diesem Verständnis einfach in einen anonymen, endlos fortschreitenden Geschichtsverlauf eingeschrieben, so wird Geschichte hier nun persönlich, wie Benjamin seine Thesen fortsetzt, und zum „Gegenstand einer Konstruktion, deren Ort nicht die homogene und leere Zeit, sondern die von `Jetztzeit´ erfüllte bildet“. Bedeutung hat die Vergangenheit im Hinblick auf jenes Unrecht, dass fortan aufgehoben werden soll. Im vergegenwärtigenden Eingedenken fallen Vergangenheit und Gegenwart insofern in eins – sie koexistieren in der Jetztzeit, die Benjamin nun auch als messianische Zeit bezeichnet: So wie Gott der jüdischen Vorstellung nach mit dem Angelus Novus in jedem Augenblick „eine Unzahl neuer Engel schafft, die jeder nur bestimmt sind, ehe sie ins Nichts zergehen, einen Augenblick das Lob von Gott vor seinem Thron zu singen“ – ein Loblied darauf, wie sich alles entwickelt hat –, so erschafft sich Geschichte in dieser Vorstellung in der Jetztzeit jenen Zeitraum, in dem sich der Funke der Hoffnung entzündet – in dem die Engel ein Loblied auf das Kommende singen.
Die Zeit ist hier für einen Augenblick zum Stillstand gekommen, aber eine neue Zeitrechnung – und mit ihr die Einführung eines Revolutionskalenders – steht unmittelbar bevor. Womöglich hat Benjamin hier König Josua vor Augen – auch wenn er seine XV. geschichtsphilosophische These formuliert: „Das Bewußtsein, das Kontinuum der Geschichte aufzusprengen, ist den revolutionären Klassen im Augenblick ihrer Aktion eigentümlich.“ Josua war der König, unter dem die Israeliten nach dem Exodus aus Ägypten dem Alten Testament zufolge das Gelobte Land, Kanaan, erobert haben. Die Schilderungen im 10. Kapitel des Buches Josua (10,12-15) könnten Benjamin nun das Modell für seine These geboten haben. Zu dem Zeitpunkt, als sich dort nämlich der Sieg über die kanaanitischen Könige als rächende Gerechtigkeit der Israeliten abzeichnete, „redete Josua mit dem Herrn und sprach vor den Augen Israels: Sonne, steh still in Gibeon, und Mond, im Tal von Ajjalon. Und die Sonne stand still, und der Mond blieb stehen, bis die Nation Rache genommen hatte an ihren Feinden (…) fast einen ganzen Tag lang.“
Wie der Legende nach die Stillstellung der Zeit in der Jetztzeit hier der Funke war, der das Kommende initiierte, so war es für Konstantin an der Milvischen Brücke das signum crucis, das ihm in einer Vision als untrügliches göttliches Siegeszeichen am Himmel erschien. Das Kreuzzeichen enthielt das Christusmonogramm (Chrismon), bei dem der Name „Christus“ mit seinen griechischen Anfangsbuchstaben: einem „X“ für „Chi“ über einem „P“ für „Ro“, abgekürzt war – und erschien Konstantin insofern als Abbreviatur, die Gottes Anwesenheit anzeigte und ihm nun zum schützenden Feldzeichen wird. So zieht Konstantin also im Namen Gottes, im Zeichen des Kreuzes, in den Kampf …
Juden, Christen – Liest man beide Passagen mit Benjamin geht es um die eine Geschichte: den in der Jetztzeit empfangenen Funken der Hoffnung als Initialzündung für den Befreiungsschlag der gesamten unterdrückten Menschheit – den Urknall der Geschichte sozusagen. Denn für Benjamin ist das eine Universalgeschichte, wenn er in der XVIII. geschichtsphilosophischen These schreibt: „`Die kümmerlichen fünf Jahrzehnte des homo sapiens´, sagt ein neuerer Biologe, `stellen im Verhältnis zur Geschichte des organischen Lebens auf der Erde etwas wie zwei Sekunden am Schluß eines Tages von vierundzwanzig Stunden dar. Die Geschichte der zivilisierten Menschheit vollends würde, in diesen Maßstab eingetragen, ein Fünftel der letzten Sekunde der letzten Stunde füllen.´ Die Jetztzeit, die als Modell der messianischen in einer ungeheuren Abbreviatur die Geschichte der ganzen Menschheit zusammenfaßt, fällt haarscharf mit der Figur zusammen, die die Geschichte der Menschheit im Universum macht.“
***
„Woher kommen wir? Wo sind wir, und wohin gehen wir?“ fragt der Astronom Gaspar Galaz in Patricio Guzmáns Nostalgie des Lichts, und fährt fort: „`Woher kommen wir?´ ist dann eine zentrale Frage, die sich natürlich mit der Frage nach menschlicher Kultur überhaupt stellt. Auch wenn Religion zum Beispiel heute in der Wissenschaftskultur etwas ist, das streng von der Wissenschaft getrennt wird, sind die grundsätzlichen Fragen der Menschheit ihrem Ursprung und ihrer Motivation nach religiöser Natur. (…) Am Ende geht es doch darum, den Ursprung der Menschheit zu finden und des Planeten und des Sonnensystems. Und wie eine Galaxie entsteht, und wie ein Planet, und wie ein Stern. All diese Fragen nach den unterschiedlichen `Geburtsstufen´ versuchen wir, die Astronomen, zu beantworten. Eine unendliche Geschichte. Die Herausforderung der Astronomen ist `der Ursprung von´.“
Gaspar Galaz arbeitet als einer von etwa hundert Astronomen in dem ab 1962 in der schier endlosen Ödnis der Atacamawüste im Norden Chiles errichteten European Southern Observatory (ESO). Etwa 16 europäische Staaten arbeiten dort heute zusammen und betreiben gemeinsam vier verschiedene Beobachtungsstationen in der Wüste: neben dem La-Silla-Observatorium, dem ersten der ESO, dem Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA), einem Radioteleskop, mit dem die Energie aufzeichnet, die beim Urknall entstanden ist, und dem Extremly Large Telescope (ELT), das mit 39 Metern Durchmesser und 978 Quadratmetern Fläche das größte Teleskop weltweit ist, gibt es noch das Very Large Telescope (VLT), mit dem auch Galaz arbeitet. Es ist die zweitälteste der vier Stationen und steht auf etwa 2.600 Meter Höhe auf dem Berg Cerro Paranal. Auf ihm hat man ein Plateau errichtet, auf dem die vier etwa 30 Meter hohen kuppelförmigen Schutzbauten stehen, in denen sich die leistungsstarken, etwa 53 Quadratmeter großen Spiegelteleskope mit einem Durchmesser von jeweils etwa 8,20 Meter befinden.
Die Wahl damals fiel auf Chile, weil die Luft nirgendwo auf der Welt ruhiger, klarer und trockener ist als hier in der Atacamawüste: Nach Westen sind es nur zwölf Kilometer bis zum kalten, praktisch immer unter Wolken liegenden Pazifik. Gen Osten erheben sich die bis zu 7.000 Meter hohen Andengipfel. Dieser Lage – eingezwängt zwischen kaltem Meer und hohen Bergen – verdankt die Atacama ihr weltweit einzigartiges Klima. Aufgrund der Höhe ist es Nachts auch in den Kuppeln des VLT mit zwölf Grad Celsius überraschend kalt. Hat das Teleskop genau die Temperatur der Umgebung, bilden sich Nachts nicht die gefürchteten Blasen wärmerer Luft, die durch die Hallen wabern und die Bilder unscharf machen. Eine Kühlung sorgt deshalb tagsüber dafür, dass das Teleskop dann optimal arbeitet.
Das VLT vergrößert bis zu hunderttausend Mal und sein Blick reicht Milliarden Lichtjahre weit hinaus ins All. Noch leistungsstärker und scharfsichtiger als die Weltraumteleskope Hubble und James Webb erlaubt dieses Teleskop in der Atacamawüste einen Blick in fast jeden Winkel der Milchstraße und weit darüber hinaus – in die Frühphasen des Kosmos. Die Fragen, die es beantworten soll, sind die Grundfragen der Astronomie, der Menschheit – und die haben sich seit Urzeiten kaum verändert: Woraus besteht der Kosmos? Wie ist das Universum entstanden? Welchen Platz nimmt die Menschheit darin ein?
Mit den Teleskopen des ESO wurden immer wieder auch Supernova-Explosionen in Milliarden Lichtjahren Entfernung beobachtet. Was die Teleskope dort verfolgt haben, legt nahe, wie Dirk Lorenzen schreibt, „dass der Stoff, aus dem unser Kosmos größtenteils besteht, ganz anders ist, als bisher vermutet. (…) Die Entdeckung ist im wesentlichen, dass 70 Prozent des Universums in einer Form vorhanden sind, die wir bis jetzt nicht gekannt haben. Das wird oft als Dunkle Energie bezeichnet. Die Dunkle Energie kommt zusätzlich zur Dunklen Materie hinzu.“ Zusammen entsprechen Dunkle Energie und Dunkle Materie, für die die Physik auch noch keine Erklärung hat, etwa 95 Prozent des Universums aus. „Irgend etwas beherrscht den Kosmos – und niemand weiß, was physikalisch dahinter steckt.“ Wie die Beobachtungen von Galileo Galilei vor 420 Jahren das heliozentrische Weltbild von Kopernikus bestätigten und damit das antike Weltbild stürzten, befindet sich die Astronomie heute wieder in einer Umbruchphase.
So unklar immer noch Vieles ist – in den vergangenen Jahren hat das VLT aber auch eine Unmenge an Daten geliefert. Seine Stärke ist dabei seine Vielseitigkeit: Die vier Teleskope verfügen über jeweils drei unterschiedliche Kameras und Messinstrumente. Man kann damit auch die Wellenlängen des eintreffenden Lichts in die Linien eines Spektrums überführen, die Rückschlüsse darüber zulassen, aus welchem Material ein beobachteter Himmelskörper besteht. Auch der Astronom George W. Preston befasst sich mit dieser Stellar-Spektroskopie und untersucht in diesem Zusammenhang insbesondere auch die Zusammensetzung kosmologisch früher Sterne. In Guzmáns Nostalgie des Lichts erklärt er: „Wenn ich Vorlesungen halte, erkläre ich den Leuten immer, wie das Kalzium in ihren Knochen gemacht wurde. Und das ist die Geschichte unserer Anfänge. Ein Teil des Kalzium in meinen Knochen entstand kurz nach dem Urknall. Diese Atome sind immer noch da. Wir leben mit den Bäumen, den Sternen und den Galaxien. Wir sind Teil des Universums. Und das Kalzium in meinen Knochen war von Anfang an dabei.“
Die Geschichte unserer Anfänge – Wäre die Geschichte am Ende angekommen, wenn man die Teleskope umdrehen würde? „Ich hätte gerne, dass die Teleskope nicht nur in den Himmel sehen, sondern auch die Erde durchdringen“, sagt die Knochensucherin Violeta Berrios, „sodass wir sie finden. Wir würden die Wüste mit einem Teleskop durchkämmen. Zuerst dort, dann etwas weiter weg. Und am Ende den Sternen danken, dass wir sie finden. Das träume ich …“
***
Unweit des Observatoriums findet man inmitten der unendlichen Leere der Atacamawüste die Ruinen von Chacabuco. Ursprünglich waren die verfallenen Gebäude eine Siedlung für die Arbeiter eines Bergwerks – dann aber wurde daraus das größte Konzentrationslager der Pinochet-Diktatur. Die Militärs mussten kein neues Lager errichten, weil sie die Zellen aus dem 19. Jahrhundert, „als Bergarbeit praktisch Sklaverei war“, wie Guzmán bemerkt, nutzen konnten. Sie mussten nur noch Stacheldraht anbringen – der aber nicht verhindern konnte, dass es hier eine Gruppe von Häftlingen gab, die verbotenerweise die Sterne beobachteten, die man in den klaren Nächten hier in der Wüste auch ohne Teleskop klar sehen konnte. In Nostalgie des Lichts erinnert sich einer dieser Häftlinge: „Was uns allen passierte, war, dass wir die Freiheit fühlten. Beim Betrachten des Himmels und der Sterne, dem Bestaunen der Sternbilder, haben wir uns vollständig frei gefühlt.“ Er konnte nicht aus dem Lager fliehen, aber der Dialog mit dem Sternen, so Guzmán, „bewahrte ihm seine innere Freiheit …“
***
Alle Energie, die die Teleskope und Antennen in der Atacamawüste empfangen, kommt aus der Vergangenheit. Wer nachts in den Himmel schaut, der blickt zurück in eine Zeit, die längst vergangen ist. Alles Licht, was uns da erreicht, hat mitunter einen Milliarden Jahre langen Weg zurückgelegt, selbst das Sonnenlicht braucht etwa acht Minuten bis es uns erreicht, beim Mondlicht ist es etwas mehr als eine Sekunde. Im Grunde, so erklärt Gaspar Galaz in Nostalgie des Lichts im Gespräch mit Guzmán, passieren „alle Erfahrungen, die man im Leben macht, diese Unterhaltung eingeschlossen, in der Vergangenheit. Auch wenn es nur um eine Millionstel-Sekunde geht. Die Kamera, in die ich blicke, ist zwar nur ein paar Meter entfernt, aber ist zeitlich dennoch um ein paar Milllionstel-Sekunden hinterher … Im Vergleich zu der Zeit auf meiner Uhr. Weil das Signal bis zur Ankunft verzögert ist. Das Licht der Kamera, oder dein reflektiertes Licht erreicht mich den winzigen Bruchteil einer Sekunde später, weil Lichtgeschwindigkeit sehr schnell ist. (…) Die Gegenwart, sie existiert nicht. Wirklich nicht. Die einzige Gegenwart, die existiert, ist die in meinem Verstand, in meinem Bewusstsein. Das kommt für mich der absoluten Gegenwart am nächsten. Und nicht einmal das. Denn im Denken verzögern sich Signale doch auch zwischen meinen Sinnen: Wenn ich sage: `Ich bin ich´ und ich berühre mich … schon da kommt es zu einer gewissen Verzögerung.“
Wie der Astronom Gaspar Galaz hier erklärt, gibt es im Grunde kein Leben außerhalb der Vergangenheit, das heißt die Gegenwart lässt sich nicht von der Vergangenheit abgrenzen – man kann der Vergangenheit nicht entkommen – hierin liegt wohl die Nostalgie des Lichts begründet. Gleichwohl aber birgt die Vergangenheit Benjamin zufolge doch auch ein gewisses Potential für die Zukunft: Im Eingedenken berge „jede Sekunde die kleine Pforte, durch die der Messias treten“ kann, wie er in Anhang B seiner geschichtsphilosophischen Thesen schreibt, oder wie er auch sagt (VI.): den „Funken der Hoffnung“. In der Vergangenheit liegt das Werkzeug zur Reparatur bestehenden Unrechts gewissermaßen. Susan Sontag schreibt in diesem Zusammenhang: „Benjamin betrachtet alles, was er aus der Vergangenheit heraufholt, als vorwärtsweisend in die Zukunft, weil die Gedächtnisarbeit (…) die Zeiten aufbrechen läßt. (…) Das Gedächtnis, das die Vergangenheit auf seine Bühne bringt, läßt den Ablauf der Ereignisse in einem Tableau erstarren. Benjamin versucht nicht, die Vergangenheit zu beherrschen, sondern zu verstehen: sie auf ihren warnenden Nenner zu bringen.“
Da der Blick in die Geschichte in Benjamins Verständnis dabei stets von einem bestimmten historischen Standpunkt aus geschieht, vom Hier und Jetzt aus, entscheidet die vergegenwärtigende Erinnerung immer auch über die zukünftige Einstellung zu einem geschichtlichen Sachverhalt mit. Das Eingedenken ist insofern immer auch mit der Möglichkeit einer Veränderung verbunden, wie Sven Kramer in seiner Einführung zu „Walter Benjamin“ (2003) unterstreicht: „Weil hier keine mythische Wiederholung vorliegt, in der das Vergangene unverändert wieder auflebte, sondern ein verändertes Verhältnis zum Vergangenen mitproduziert wird, zeichnen sich in dem neu strukturierten Bild `die Linien des Kommenden´ ab“, wie Benjamin selbst sagt. So wird das Eingedenken zu einer Art rites de passage, einer Schwellenerfahrung: Diese sei, so schreibt Benjamin, von der Grenze „schärfstens zu unterscheiden. Die Schwelle ist eine Zone. Und zwar eine Zone des Übergangs“ von einem Zustand in einen anderen.
Indem sich jemand vom Interesse motiviert der Vergangenheit zuwendet, begibt er sich in einen Erfahrungsraum, aus dem er verändert hervorgehen kann – und ein solcher Erfahrungsraum kann nun auch die Atacamawüste sein. Denn die Atacamawüste bietet sich aufgrund ihres extrem trockenen Klimas zum Errichten von Teleskopen genauso an, wie sie aufgrund ihres hohen Salzgehalts geradezu dazu prädestiniert ist, die Spuren der Vergangenheit im Boden zu konservieren. Nicht zuletzt deshalb haben Archäologen in Arica im Norden der Atacamawüste auch die ältesten Mumien der Welt gefunden – ganz zu schweigen von den zahlreichen präkolumbianischen Spuren beziehungsweise Felsritzungen, die vor mehr als 1.000 Jahren in den Stein gemeißelt wurden, als nomadische Hirten durch das Land zogen. Denn die Atacamawüste war früher ein Land des Transits: mehrere Routen führten durch die heute ausgetrockneten und versteinerten Flussbetten, die als Verbindungswege zwischen der Hochebene Altiplano und dem Pazifik dienten.
Aus all diesen Gründen ist in der Atacamawüste „die Vergangenheit leichter zugänglich als anderswo“, sagt der Archäologe Lautaro Núnez in Nostalgie des Lichts. Sie sei ein „Tor zur Vergangenheit“, sagt er, „eine Pforte, wo wir hindurchgehen können. Aber unsere Erkenntnisse bei der Rückkehr sind ungewiss. Wie viele davon werden unser Leben verändern? Für mich bleibt das ein Geheimnis.“ Dann aber hakt Guzmán nach: „Und dennoch ist dies ein Land, das seine Vergangenheit nicht aufarbeitet.“ Núnez antwortet: „Ich stimme voll und ganz mit dir überein. Es ist ein enormes Paradox. (…) Wir haben unsere jüngste Geschichte verschleiert. Wir haben sie geheim gehalten. Es ist ein Widersinn. Als ob wir uns der eigenen Geschichte nicht nähern wollen, als ob die Geschichte uns anklagen könnte. Und das, mein lieber Freund, nützt nichts und niemandem: Nicht der Rechten, nicht dem Zentrum, nicht der Linken.“
In der unbewältigten Vergangenheit liegt das Trauma der chilenischen Gesellschaft. Während sich der Blick zu den Sternen richtet und hierfür die weltweit besten Teleskope errichtet wurden, bilden die Verbrechen der Vergangenheit noch immer den blinden Fleck im chilenischen Bewusstsein. Gerade auch dafür stehen Landschaften wie die Atacamawüste und die Anden in Guzmáns Filmen: trotz ihrer enormen Größe sind sie für die Meisten weitestgehend unbekanntes Territorium, terra incognita. Denn klar ist: Je weiter man sich hinein begibt, desto tiefer würde man auch in die Vergangenheit eindringen – das gilt eben nicht nur für den Blick ins Universum, sondern genauso für die Grabungen im Boden der Atacamawüste und für die Geologie der immerhin 80 Prozent der chilenischen Grundfläche ausmachenden Anden, wie der Vulkanologe Alvaro Amigo in Die Kordillere der Träume erklärt: „Wenn ich die Kordillere betrachte, sehe ich Millionen von Jahren, die da ausgestellt sind. So wie man sich hineinbegibt, entdeckt man Gipfel, die man nicht sah von der chilenischen Seite her. Man durchschreitet aber auch die Zeit. Je tiefer man in die Bergkette eindringt und sie durchwandert, desto mehr geht man in der Zeit zurück. Es spiegeln sich Welten, die immer weiter zurückliegen, während man fortschreitet.“
Womöglich sind manche dieser Gegenden in den Anden kaum erreichbar – es gibt aber nun auch Orte, die man gefahrlos über Straßen erreichen könnte, wie jenen, den Guzmán zum Schluß von Die Kordillere der Träume zeigt. Der jedoch ist auf keiner Karte eingezeichnet, was daran liegt, dass er sich in einer Verbotszone befindet, die ohne Bewilligung nicht betreten werden darf: Guzmán zeigt eine gigantische Kupfermine inmitten der Anden, unter Allende verstaatlicht, heute betrieben von irgendwelchen global agierenden Konzernen, die ihren Sitz nicht mehr in Chile haben und die ihre Konzessionen während der Diktatur erhalten haben. „In gewissen Provinzen sind 80 Prozent des Bodens in Privatbesitz“, erklärt Guzmán. (Das liegt daran, dass die Militärs, die jede tiefgreifende Reform bis heute verhindert haben, schon seit dem Kupfergesetz von 1958 direkte Einkünften aus dem Kupferbergbau erhalten. Pinochet legte dann fest, dass zehn Prozent der Exporterlöse des staatlichen Kupferkonzerns Codelco für Investitionen des Militärs bereitstehen.) So ist inmitten der Kordilleren ein immenses Gebiet entstanden, „das nicht chilenisch ist“, wie Guzmán sagt – für das sich die Öffentlichkeit aber nicht interessiert.
Ganz abgesehen vom gesellschaftlichen Unrecht – solche Minen sind überdies ein Sinnbild für den Raubbau an der Natur und für ein ausbeuterisches Wirtschaftssystem, das, wie Benjamin schon damals kritisierte (These XI.), „nur die Fortschritte der Naturbeherrschung, nicht die Rückschritte der Gesellschaft wahrhaben (will)“ und in dem Arbeit nur noch „auf die Ausbeutung der Natur hinaus(läuft), welche man mit naiver Genugtuung der Ausbeutung des Proletariats gegenüberstellt“, wobei die Natur in diesem Verständnis ohnehin „gratis da ist“.
Guzmán lässt offen, wo genau sich das gezeigte Bergwerk befindet, vermutlich aber müsste man gar nicht so weit vordringen, um die Wahrheit ans Licht zu bringen …. wie bei jenem Photoalbum, das Lichtbilder aus der Vergangenheit des damals noch „Chicho“ genannten Salvador Allende zeigt, das seine Amme zwanzig Jahre lang, bis zum Ende der Diktatur, im Garten des während des Putsches zerbombten Hauses vergraben hatte, damit die Schergen es nicht auch vernichteten – und mit ihm die Erinnerung an Chiles „unbeschwerte Zeiten“, wie Guzmán in diesem Zusammenhang in Salvador Allende sagt.
***
Strahler werden in den Schweizer Alpen jene Mineraliensammler genannt, die hier in tiefen Felsspalten und Hohlräumen, sogenannten Klüften, nach Bergkristallen suchen. Bergkristall ist Quarz in seiner strahlendsten Form, das heißt reiner, vollkommen transparenter Quarz wird, wenn er gut ausgebildete Kristalle entwickelt, als Bergkristall bezeichnet. Da man sie oft in Höhlen fand, hielt man Bergkristalle in der Antike für versteinertes Eis. Daher stammt auch sein Name, bedeutet das griechische „Crystallos“ doch „Eis“. Tatsächlich aber entwickelt sich ein Bergkristall bei der Kristallisation von Siliziumdioxid, wobei der formgebende Kristallisationsprozess bei der Entstehung der Alpenkristalle beispielsweise etwa 40.000 Jahre dauerte. Bei der Auffaltung der Alpen entstanden überhaupt erst jene Hohlräume im Gestein, die den Mineralien Raum boten um auszukristallisieren. Und nur bei optimalen Bedingungen, über sehr lange Zeit im Dunkeln, gerät ein Bergkristall rein und transparent – auf jeden Fall aber sind Bergkristalle immer einzigartige Unikate.
Wenn Quarzablagerungen in Trümmerfeldern mit wenig Vegetation nicht ohnehin schon durch die Wanderbewegung des Berges freigelegt wurden, findet man Bergkristalle in den Alpen vor allem in Quarzbändern, die sich durch den Schiefer ziehen. Sie liegen hier aber nicht offen zutage, sondern man muss die Klüfte vorher öffnen, um sie rauszuholen. Dazu dürfen die Strahler in der Schweiz nur einen sogenannten metallenen „Strahlstock“ verwenden, der als Hebeeisen, Brechstange und Meißel dient, den man mit Muskelkraft und einem Hammer in den Fels bohrt, um das Gestein und die Klüfte aufzubrechen und den Bergkristall dann auszubrechen. Kommt der dann nach Millionen Jahren in seiner dunklen Höhle endlich ans Licht, kann er das erste Mal strahlen. Um seine Strahlkraft zu erhöhen können Bergkristalle, wie andere Edelsteine auch, geschliffen werden. Dabei ist jeder Stein anders, und die Anzahl der Facetten, die notwendig sind, um sein individuelles Feuer zur Geltung zu bringen und ihn gleichsam zu veredeln, ist unterschiedlich. Grundsätzlich aber sorgt jede zusätzliche Facette für mehr Lichtbrechung, dafür, dass neue Nuancen freigelegt werden.
Bergkristalle gibt es in jedem Gebirge, auch in den Pyrenäen. Und so ist es womöglich zwar weit hergeholt, aber doch nicht völlig undenkbar, dass Walter Benjamin seine Aktentasche vor seinem Tod vielleicht in einer freigelegten Felskluft versteckt hat. Oder hat er sie unter einem Trümmerhaufen vergraben? Sie ist auf jeden Fall verschwunden – mitsamt ihrem Inhalt. Bis heute weiß man weder wo sie ist, noch was sich wirklich darin befand. Lisa Fittko hat von einem Manuskript gesprochen, das Benjamin unter keinen Umständen in den Händen der Gestapo wissen wollte. Man kann aber mit Hannah Arendt davon ausgehen, dass sich auch seine Notizbücher in der Tasche befunden haben: „Jedenfalls war nichts für ihn in den dreißiger Jahren charakteristischer als die kleinen, schwarz-gebundenen Notizbüchlein, die er immer bei sich trug und in die er unermüdlich in Zitaten eintrug, was das tägliche Leben und Lesen ihm … zutrug“, schreibt sie in ihrem Essay über Benjamin.
Zitate stehen insofern im Zentrum von Benjamins Arbeit(en) in dieser Zeit des Exils und der Flucht, denn wenn das Leben bedroht ist und alles dem Tode geweiht scheint, liegt die einzige Hoffnung in der Vergangenheit, wie Benjamin schreibt: „Erst der Verzweifelnde entdeckte im Zitat die Kraft: nicht zu bewahren, sondern zu reinigen, aus dem Zusammenhang zu reißen, zu zerstören; die einzige, in der noch Hoffnung liegt, daß einiges aus diesem Zeitraum überdauert – weil man es nämlich aus ihm herausschlug.“ Und so entstand in diesen Jahren in Paris auch das „Passagen-Werk“ hauptsächlich aus Zitaten – ein gewaltiges Textkonvolut aus unzähligen fragmentierten Zitatblöcken. Sven Kramer erklärt in diesem Zusammenhang, dass Benjamin in dieser Zeit, nämlich ab 1934, „seiner Material- und Kommentarsammlung eine neue Ordnung (gab), die er dann im Wesentlichen beibehielt. Er gliederte das Korpus nach Konvoluten, die jeweils unter einer Überschrift stehen. Außerdem entwarf er ein System aus unterschiedlichen Farben und Symbolen, mit dem er die einzelnen Einträge kennzeichnete. Wie in den heutigen Datenbanken stellte er die Einträge auf diese Art in unterschiedliche Zusammenhänge. Damit entwickelte er ein kombinatorisches Verfahren, das als prinzipiell offen und tendenziell unabschließbar gelten muss. Die Einträge bilden vor allem Zitate … sowie seine eigenen Kommentare und Gedankensplitter. Das Passagen-Werk existiert nur als ein Steinbruch von Fragmenten unterschiedlichster Herkunft.“
Man kann sich Benjamins Zitatensammlung also Sven Kramer zufolge als Steinbruch von Fragmenten vorstellen – und das Zitat insofern als steingewordene Vergangenheit, als ein Bruchstück der Geschichte. Wie der Engel der Geschichte blickt Benjamin dabei zurück auf die Vergangenheit (Textarchiv, Bibliothek), auf die Trümmerhaufen (Bücher), die er dort erblickt. Manchmal liegen die Steine (Gedanken), die ihn interessieren, einfach so herum, ein anderes Mal muss er vielleicht etwas im Felsgestein nachbohren, bis er an einen Edelstein gelangt, den „Kristall des Totalgeschehens“ (die ganze Wahrheit in allen ihren Facetten), wie Benjamin schreibt, den er dann aus dem Dunkeln der Geschichte ins Licht der Gegenwart holt, damit er strahlen, funkeln kann. – Liegt hierin auch der Funken der Hoffnung?
***
Für Benjamin ist klar, dass „erst der erlösten Menschheit ihre Vergangenheit in jedem Moment zitierbar geworden (ist)“, wie er in seiner III. geschichtsphilosophischen These schreibt: „Jeder ihrer gelebten Augenblicke wird zu einer citation à l`ordre du jour – welcher Tag eben der jüngste ist.“ Erst wenn alles Unrecht aufgehoben ist, tritt an die Stelle der Tradierbarkeit der Vergangenheit ihre Zitierbarkeit – hierauf, auf die „Idee des Glücks“ im Zusammenleben der Menschen, ist Benjamins Auseinandersetzung mit der Geschichte ausgerichtet. Solange diese Idee aber nicht verwirklicht ist, bleibt es eine Utopie – und deshalb gelte es, zumindest auf die Unterbrechung des weiter so zu drängen. Dieser Akzentuierung will er in der Textpraxis seines „Passagen-Werks“ einen Ort geben, wie Sven Kramer bemerkt.
Eine von Benjamin dort genutzte Sprachverwendung, die dem Verfahren der Unterbrechung und Stillstellung entspricht, ist das Zitieren. Benjamin bemerkt in diesem Zusammenhang: „Geschichte schreiben heißt … Geschichte zitieren. Im Begriff des Zitierens liegt aber, daß der jeweilige historische Gegenstand aus seinem Zusammenhang gerissen wird.“ Als komplementäre Verfahrensweise installiert die von Benjamin bei Baudelaire beobachtete literarische Montage der im Zitat stillgestellten Gedanken dann eine neuen Zusammenhang, und zwar – wie beim Facettenschliff – so, „daß sie sich gegenseitig illuminieren und gleichsam freischwebend ihre Existenzberechtigung bewähren können“, wie Hannah Arendt schreibt. Hierin liegt gewissermaßen das „konstruktive Prinzip“ der materialistischen Geschichtsschreibung, von dem Benjamin in der XVII. geschichtsphilosophischen These spricht.
Das aus seinem ursprünglichen Zusammenhang gerissene Zitat erhält so zudem eine neue, persönliche Bedeutung. Anstatt, wie bereits in Zusammenhang mit der kopernikanischen Wendung erläutert, die Erkenntnis an einen fixen Punkt in die Vergangenheit zu führen, kommt hier umgekehrt die Vergangenheit in der Gegenwart zum Stillstand – und zwar idealweise so, dass das Gewesene dialektisch umschlägt und so im Einzelmoment das Totalgeschehen kristallisiert und sichtbar wird. Statt die Epochen in einem kausalen Zusammenhang miteinander zu verbinden, ist der vom Interesse motivierte Rückblick auf die Geschichte vom Gedanken getragen, eine Konstellation sichtbar zu machen, die in beiden Epochen – Vergangenheit und Gegenwart – ähnlich ist, das heißt, hier wird eine geschichtliche Konstellation aus dem homogenen und leeren Verlauf der Geschichte herausgesprengt und in einen Bezug zur Gegenwart gebracht. Sven Krämer schreibt in diesem Zusammenhang: „Die interessegeleitete Rückwendung in die Geschichte wird dort fündig, wo ein Ereignis im Prozess seines Nachlebens zur Lesbarkeit gelangt. In dem Moment der Lektüre kristallisieren sich beide Bewegungen zu einem einzigen Phänomen, das Benjamin als Monade oder dialektisches Bild bezeichnet.“
Beim Lesen formt sich ein Bild – Benjamin ist sich des Problems bewußt, wenn er schreibt: „Ein zentrales Problem des historischen Materialismus, das endlich gesehen werden sollte: Ob das marxistische Verständnis der Geschichte unbedingt mit ihrer Anschaulichkeit erkauft werden muß? Oder: auf welchem Wege es möglich ist, gesteigerte Anschaulichkeit mit der Durchführung der marxistischen Methode zu verbinden. Die erste Etappe dieses Weges wird sein, das Prinzip der Montage in die Geschichte zu übernehmen. Also die großen Konstruktionen aus kleinsten, scharf und schneidend konfektionierten Baugliedern zu errichten. Ja in der Analyse des kleinen Einzelmoments den Kristall des Totalgeschehens zu entdecken.“
Im Gegensatz zu Bertolt Brecht, der versucht hat die Welt episch, in ihrer Entwicklung, darzustellen, den Blick gewissermaßen nach vorne gerichtet, schaut Benjamins Engel zurück auf jene Trümmer der Vergangenheit, in denen die Geschichte steingeworden zum Stillstand kommt. Benjamin fasst diesen Moment des dialektischen Umschlags im Bild des Kristalls. Er ist fasziniert von solchen Bildern, in denen sich ein sprachlicher Gedanke (Überbau), in dem Fall die Idee der ganzen Wahrheit, plötzlich in etwas sinnlich wahrnehmbares (Unterbau) verwandelt, sich Geschichte materialisiert. Da sinnliche Wahrnehmung nicht auf den Begriff zu bringen ist, transportierten Benjamins Texte deshalb sprachlich verfasste Denkbilder, die der unmittelbaren Anschauung verpflichtet sind, wie der Engel der Geschichte, wo Benjamin seine Kritik des Fortschritts sprachlich im Bild des Sturms ausdrückt.
In letzter Instanz geht es Benjamin mit seinen Texten weniger darum, Wissen zu vermitteln, als darum, Erfahrungen anzuregen. Es kommt ihm dabei, so Hannah Arendt, „immer auf das unmittelbar, real nachweisbare Konkrete, auf ein Einzelnes an, das seine `Bedeutung´ sinnfällig in sich trägt; und dieser höchst realistischen Denkungsart dürfte die Überbau-Unterbau-Relation im präzisen Sinn eine `metaphorische´ gewesen sein“, insofern, als Benjamin mit dieser Übertragung ins Bild – und das heißt metapherein schließlich: herübertragen – geistige Begriffe und Ideen auf eine materielle und das heißt immer auch sinnlich wahrnehmbare Ebene holte. In diesem Sinn auch ist die Metapher, Arendt zufolge, seit Homer „das eigentlich Erkenntnis vermittelnde Element des Dichterischen. Mit ihrer Hilfe wird in den Homerischen Epen das sinnlich Entfernteste in die genaueste Entsprechung gebracht – etwa der Aufruhr der Winde, wenn `Nord und West bei jählings nahn mit Gewalt´ (Ilias IX, 4-8) (…) – und durch diese Entsprechung wird dichterisch die Einheit der Welt gestiftet. Was an Benjamin so schwer zu verstehen war, ist, daß er, ohne ein Dichter zu sein, dichterisch dachte, und daß die Metapher daher für ihn das größte und geheimnisvollste Geschenk der Sprache sein mußte, weil sie in der `Übertragung´ es möglich macht, das Unsichtbare zu versinnlichen – `Eine feste Burg ist unser Gott´ – und so erfahrbar zu machen.“
Eine feste Burg – insbesondere auch an dieser Metapher wird deutlich, dass Benjamin solche Denkbilder als Sprachphänomene begreift, die, wie alle sprachlichen Bilder, visuell geprägte Vorstellungen mit sich führen. In Zusammenhang mit dem „dialektischen Bild“ spricht Benjamin dabei auch von einer „von Spannungen gesättigten Konstellation“, und schreibt in diesem Zusammenhang in der XVII. geschichtsphilosophischen These: „Wo das Denken in einer von Spannungen gesättigten Konstellation plötzlich einhält, da erteilt es derselben einen Chok, durch den es sich als Monade kristallisiert. Der historische Materialist geht an einen geschichtlichen Gegenstand einzig und allein heran, wo er ihm als Monade entgegentritt. In einer Struktur erkennt er das Zeichen (…) einer revolutionären Chance im Kampf für die unterdrückte Vergangenheit. Er nimmt sie wahr, um eine bestimmte Epoche aus dem homogenen Verlauf der Geschichte herauszusprengen, so sprengt er ein bestimmtes Leben aus der Epoche, so ein bestimmtes Werk aus dem Lebenswerk. Der Ertrag seines Verfahrens besteht darin, daß im Werk das Lebenswerk, im Lebenswerk die Epoche und in der Epoche der gesamte Geschichtsverlauf aufbewahrt ist und aufgehoben.“
Mit dem Begriff der Monade versucht Benjamin gewissermaßen das Totalgeschehen zu fassen – er übernimmt ihn von Leibniz. Egon Friedell schreibt in diesem Zusammenhang: „Jedes Stück Materie kann als `ein Garten voller Pflanzen oder ein Teich voller Fische´ angesehen werden, und `jeder Zweig der Pflanze, jedes Glied des Tieres, jeder Tropfen Feuchtigkeit ist immer wieder ein solcher Garten und ein solcher Teich´. Jede solche Welteinheit, von Leibniz `Monade´ genannt, ist `un petit monde´, `un miroir vivant de l`univers´, `un univers concentré´: sie hat keine Fenster, durch die etwas in sie hineinscheinen könnte, vielmehr ist sie ein Spiegel, der das Bild des Universums aus eigener Kraft, `actif´ hervorbringt. Diese Monaden bilden ein Stufenreich. (…) In dieser durch unendlich kleine Differenzen ansteigenden Reihe gibt es keinen Sprung und keine Wiederholung. `Wie eine und dieselbe Stadt, von verschiedenen Seiten betrachtet, immer ganz anders und gleichsam perspektivisch vervielfältigt erscheint, so kann durch die zahllose Menge der Monaden der Schein entstehen, als gäbe es ebenso viele verschiedene Welten, die doch nur Perspektiven einer einzigen Welt sind, nach den verschiedenen Gesichtspunkten der Monaden.´“
Anstatt Geschichte als eine kausale Verkettung von Ereignissen zu begreifen, konzentriert sich die Geschichtsschreibung in diesem Verständnis auf einen entscheidenden Punkt, in dem das Totalgeschehen kristallisiert ist, und zwar ganz im Sinne der Leibnizschen Monade – so wie die griechische Polis „solange am Grunde unserer politischen Existenz, auf dem Meeresgrunde also, weiter da sein (wird), als wir das Wort `Politik´ im Munde führen“, wie Hannah Arendt schreibt. Das Wesen der Monade im Zitat freizulegen bedeutet dann, wie Arendt ausführt, den entscheidenden Punkt „nicht sowohl auszuschachten als zu erbohren“.
Arendt überschreibt das letzte Kapitel ihres Essays über Walter Benjamin mit „Der Perlentaucher“ und stellt ihm als Motto ein Zitat aus Shakespeares „Der Sturm“ (I,2) voran: „Fünf Faden tief liegt Vater dein: / Sein Gebein wird zu Korallen; / Perlen sind die Augen sein: / Nichts an ihm, das soll verfallen, / Das nicht wandelt Meereshut / In ein reich und seltnes Gut.“ Sie schreibt dort in diesem Zusammenhang, dass Benjamin die Methode verfolge, „das Wesen im Zitat zu erbohren – wie man Wasser aus der unterirdischen, in der Tiefe verborgenen Quelle erbohrt. Das Bohren ist dasselbe wie das Beschwören, und das so Beschworene, das nun heraufsteigt, ist immer das, was die Shakespearsche `sea-change´ vom lebendigen Auge zur Perle, vom lebendigen Gebein zur Koralle erlitten hat. Das Zitieren ist ein Nennen, und das Nennen, nicht eigentlich das Sprechen, das Wort und nicht der Satz bringen für Benjamin Wahrheit an den Tag. (…) Dies Denken, genährt aus dem Heute, arbeitet mit den `Denkbruchstücken´, die es der Vergangenheit entreißen und um sich versammeln kann. Dem Perlentaucher gleich, der sich auf den Grund des Meeres begibt, nicht um den Meeresboden auszuschachten und ans Tageslicht zu fördern, sondern um in der Tiefe das Reiche und Seltsame, Perlen und Korallen, herauszubrechen und als Fragmente an die Oberfläche des Tages zu retten, taucht es in die Tiefen der Vergangenheit, aber nicht um sie so, wie sie war, zu beleben und zur Erneuerung abgelebter Zeiten beizutragen. Was dies Denken leitet, ist die Überzeugung, daß zwar das Lebendige dem Ruin der Zeit verfällt, daß aber der Verwesungsprozeß gleichzeitig ein Kristallisationsprozeß ist; daß in der `Meereshut´ – dem selbst nicht-historischen Element, dem alles geschichtlich Gewordene verfallen soll – neue kristallisierte Formen und Gestalten entstehen, die, gegen die Elemente gefeit, überdauern und nur auf den Perlentaucher warten, der sie an den Tag bringt: als `Denkbruchstücke´, als Fragmente oder auch als die immerwährenden `Urphänomene´.“
***
Perlmutt ist die innere, perlenartige Schicht der Schale von Weichtieren, insbesondere der See- und Perlenmuschel. Interessant sind diese Muscheln wegen ihrer Perlen, aber da die Perlmutt-Schale bei Lichteinfall ein mattes, irsierendes Strahlen erzeugt, werden daraus bisweilen auch Schmuckstücke und Zierknöpfe hergestellt. Als zu Beginn des 19. Jahrhunderts ein englisches Schiff unter dem Kommando von Kapitän Robert FitzRoy (1831-1836) nach Patagonien kam – es hatte den Auftrag, Karten von der patagonischen Küste zu erstellen –, hatte der Kapitän eine „erstaunliche Idee“, wie Patricio Guzmán in Der Perlmuttknopf erklärt: „vier Indianer nach England mitzunehmen und zivilisierten Menschen aus ihnen zu machen. Einer der Indiander ging an Bord im Tausch für einen Perlmuttknopf. Deshalb nannten die Engländer ihn Jemmy Button.“ (Er wurde zum Vorbild für Michael Endes Jim Knopf – der nun endlich in einer von rassistischen und diskriminierenden Aspekten befreiten Version erscheint.)
Patagonien war zu dieser von mehreren Stämmen besiedelt, die vor etwa 10.000 Jahren als Wassernomaden durch die zahlreichen Forde zogen und so von Insel zu Insel reisten. Es gab fünf Gruppen, erklärt Guzmán: die Kawésqar, die Selk`nam, die Aoniken, die Haush und Yámana – und sie waren alle Seefahrer, und hatten seit jeher eine besondere, spirituelle Beziehung zum Wasser. Man schätzt, dass im 19. Jahrhundert etwa 8.000 Menschen mit 300 Kanus diesen riesigen Archipel befuhren – während die Chilenen trotz der über 4.000 Kilometer langen Küste nie ein Seevolk waren, sondern sich von Beginn an eher im Landesinneren niedergelassen haben.
Wie dem auch sei – Jemmy Button jedenfalls wurde als Matrose gekleidet, später als Engländer. Über ein Jahr lang lebte er in England „wie auf einem unbekannten Planeten“, wie Guzmán sagt. „Er reiste von der Steinzeit bis zur industriellen Revolution. Er reiste tausende von Jahren in die Zukunft. Und dann tausende von Jahren zurück in die Vergangenheit. Nachdem Jemmy Button ein Gentlemen geworden war, brachte der Kaptiän ihn zurück nach Patagonien.“ Es war die zweite Expedition von Robert FitzRoy im Jahr 1830, an der auch Charles Darwin teilnahm. „Als er wieder in seiner Heimat war, zog Jemmy Button seine englische Kleidung aus“, berichtet Guzmán. „Er sprach weiter halb Englisch, halb seine eigene Sprache. Er ließ seine Haare lang wachsen, wurde aber nie wieder derselbe Mensch.“
Die Begegnung mit Kapitän FitzRoy war, so Guzmán, „der Anfang vom Ende für die Völker des Südens. FitzRoys Karten zogen tausende von Siedlern an. 150 Jahre lang herrschte eine Gruppe Weißer mit fester Hand über ein stummes Land.“ Erst Salvador Allendes Revolution sorgte dafür, dass die Indigenen ihr ursprüngliches Land, das ihnen geraubt wurde, wieder zurückerhielten – bevor mit dem Putsch die Landreform wieder rückgängig gemacht wurde.
Über Chile brach die Diktatur herein – und mit ihr ein Terrorregime mit 800 heimlichen Folter-Gefängnissen, betrieben von mindestens 3.500 Militärs. Gefoltert wurde auch auf der Insel Dawson. Hier, wo zuvor schon hunderte Indigene in den katholischen Missionen starben, wurde nun ein Konzentrationslager für Salvador Allendes Minister eingerichtet, die man aus Santiago hierher deportierte. Über 700 Häftlinge waren es allein hier – „sie waren Opfer einer Gewalt, die die Indianer schon erlebt haben“, wie Guzmán sagt.
In dieser Zeit geschah es, dass der Humboldtstrom einen toten Körper an Land spülte, den Körper einer Frau. „Niemand wusste, wer sie war“, erklärt Guzmán. Aber „die Leute schöpften Verdacht, dass der Ozean ein Friedhof war“. Niemand wußte damals etwas von den über 3.000 Desaparecidos, die man auch in der Atacamawüste verscharrte – und es sollte noch etwa dreißig Jahre dauern, bis tatsächlich einige Offiziere eingestanden, dass man vielleicht auch ein Paar Menschen ins geworfen hatte. Eines der Opfer jedenfalls war Marta Ugarte, der tote Körper am Strand, das ließ sich nicht verleugnen. Denn man konnte an ihr rekonstruieren, was geschehen sein musste.
Ein Journalist rekonstruiert in Guzmáns Der Perlmuttknopf was geschehn war: „Mehrere Zeugen sagten, dass sie eine Spritze bekommen hätten. Manche sagen, es war Zyanid, aber viele bezeugen, dass es Pentothal war. So ging man sicher, dass der Häftling tot war. Die [Eisenbahn-]Schiene wurde auf den Brustkorb gelegt. (…) Diese Schiene wiegt mindest 30 Kilo. Der Schienenträger wurde von der DINA [dem chilenischen Geheimdienst] ermordet, weil er zu viel geredet hatte. [Mit einem Draht band man die Schiene an, auf den Brustkorb des toten Häftlings.] Zum Schluss der Verpackung nahemen sie Plastiksäcke, einen über den Kopf, einen über die Füße, die sich in der Mitte trafen. (…) Und Kartoffelsäcke. Genau dieselbe Methode: von den Füßen hoch und vom Kopf runter, damit sie sich in der Mitte trafen. Sie wurden in Helikopter oder Flugzeuge geladen und von dort aus ins Meer geworfen.“
Bei Martha Ugarte allerdings ging etwas schief: „Es war so: Als die Gefangene im Fleugzeug war, fing sie an sich zu bewegen. Daraufhin (…) schnürten (sie) die die Säcke auf und entfernten sie. Sie öffneten das Paket und merkten, dass sie noch lebte. Da nahmen sie diesen Draht hier und erwürgten sie. Das Paket war dann schlecht verschlossen. Das würde erklären, warum ihr Körper an Land gespült wurde.“
Den Gerichtsberichten zufolge warfen die chilenischen Streitkräfte 1.200 bis 1.400 Menschen in den Ozean, „tot oder lebendig“, wie Guzmán anmerkt. Sie wurden von zahlreichen Zivilisten dabei unterstützt, von denen bis heute nur ein einziger angeklagt und verurteilt wurde. Alle beteiligten hofften das Meer würde ihr kriminelles Geheimnis bewahren – und sie sollten auch fast recht behalten: Fünfzig Jahre später hat man bis Marta Ugarte niemanden von den bis zu 1.400 Menschen im Pazifik gefunden – nur zahllose Schienen. Die sind inzwischen „mit Spuren bedeckt“, erklärt Guzmán. „Das Wasser und seine Kreaturen haben diese Nachrichten eingraviert. Hier sind die Geheimnisse, die die Körper hinterlassen haben, bevor sie sich im Wasser auflösten und die Form des Ozeans annahmen.“
Aufgrund einer richterlichen Veranlassung werden die Schienen seit 2004 geborgen, und jede einzelne von ihnen untersucht. Man fand auf ihnen zahlreiche Korallen und andere Meereslebewesen – und schließlich auch einen einzelnen Knopf. Dieser Knopf ist bis heute das einzige Indiz, dass ein Mensch dort war.
„Jemmy Button erhielt einen Perlmuttknopf“, erklärt Guzmán, „dafür nahm man ihm sein Land, seine Freiheit, sein Leben. Als er zu seiner Insel zurückgebracht wurde, erlangte er nie wieder seine Identität zurück. Er wurde ein Fremder im eigenen Land. Beide Knöpfe erzählen dieselbe Geschichte – eine Geschichte der Vernichtung. / Es liegen vermutlich viele andere Knöpfe im Ozean …“
***
„Vor kurzem“, so schließt Patricio Guzmán Der Perlmuttknopf ab, „wurde sehr weit weg ein Quasar voller Wasserdampf entdeckt. Er enthält 120 Millionen Mal mehr Wasser, als alle unsere Meere. Wie viele irrende Seelen könnten Zuflucht finden in dem riesigen Ozean, der in der Leere treibt?“
Correctiv enthüllt: Rechtsextremer Geheimplan gegen Deutschland
In einer szenischen Lesung am 17. Januar 2024 im Berliner Ensemble hat die Rechercheplattform Correctiv über ihre bereits veröffentlichten Erkenntnisse hinaus weitere Details zu dem jüngsten Treffen von Politikern und Rechtsextremisten in Potsdam präsentiert …
„Alsdie Nazis die Kommunisten holten, / habe ich geschwiegen, / ich war ja kein Kommunist. // Als sie die Gewerkschaftler holten, / habe ich geschwiegen, / ich war ja kein Gewerkschaftler. // Als sie die Juden holten, / habe ich geschwiegen, / ich war ja kein Jude. // Als sie mich holten, / gab es keinen mehr, / de protestieren konnte.“
Martin Niemöller (1892-1984), Theologe
Wie Adorno bereits 1967 in einem Vortrag zu „Aspekte des neuen Rechtsradikalismus“ in Zusammenhang mit der Gründung der Nationaldemokratischen Partei Deutschlands (NPD) 1964 feststellte, scheinen die Menschen in Deutschland „in einer immerwährenden Angst um ihre nationale Identität zu leben, eine Angst, die zu der Überwertigkeit des Nationalbewußtseins sich das Ihrige beiträgt.“ Was ist Heimat? Was ist Nation und Patriotismus? – dieses „Geraune“, wie der Schriftsteller Michael Köhlmeier es in „Wenn ich WIR sage“ (2021) nennt.
Es sind in der Vergangenheit vor allem Konservative, die beanspruchen, die richtigen Antworten auf diese Fragen zu haben. Entsprechend ist eine politische Haltung lange Konservativ und Rechts – das gehörte zum Grundkonsens der demokratischen Gesellschaft. Inzwischen allerdings hat sich das politische Koordinatensystem verschoben, das heißt, wer sich heute demonstrativ Rechts verortet – wie die Neue Rechte um Patrioten wie Martin Sellner – zieht die demokratische Grundordnung und mit ihr verbundene universale Grundwerte wie Menschenrechte, Rechtsstaatlichkeit, Pluralismus oder Demokratie offen in Zweifel oder lehnt sie rundweg ab. Ausdruck findet diese Ablehnung in Begriffen wie Enthnopluralismus, Umvolkung oder eben auch Remigration. Alles relativ neue Begriffe, die aber allesamt zur Rückeroberung Deutschlands von der muslimischen Bevölkerung aufrufen und eine längst überholt geglaubte fremdenfeindliche, völkische Ideologie propagieren. Allesamt also Begriffe, hinter denen sich ehemals eindeutig extrem rechte Positionen und Haltungen verbargen – eine „Blut und Boden“-Ideologie, bei der der Begriff Rasse inzwischen einfach durch ethnokulturelle Identität ersetzt wird. Die Nähe zum biologistischen Denken der Nazis aber ist offensichtlich.
Längst haben diese Begriffe Eingang in den konservativen politischen Diskurs gefunden, wie Correctiv nun beweist. Genau das zeigt, folgt man der Politikwissenschaftlerin Natascha Strobl, dass das Erstarken der Neuen Rechten „zu Erosionsprozessen innerhalb der konservativen Milieus“ geführt habe, wie sie in „Radikalisierter Konservatismus“ (2021) schreibt. Konservatismus, so ihre These, sei inzwischen vom Rechtsradikalismus kaum noch zu unterscheiden. Ein Teil der Konservativen „popularisierte sukzessive Positionen, die zuvor nur in der extremen Rechten zu hören waren“, so Strobl.
Aber so hohl und leer die von den Nationalisten dabei beanspruchten Begriffe auch sein mögen – dass sie es sind, zeigt Michael Köhlmeier beispielhaft am Wir auf –, so anachronistisch und unzeitgemäß diese Positionen im Zeitalter des Anthropozän auch erscheinen mögen – Adorno warnte bereits 1967: „Man sollte diese Bewegungen nicht unterschätzen wegen ihres niedrigen geistigen Niveaus und wegen ihrer Theorielosigkeit. Ich glaube, es wäre ein völliger Mangel an politischem Blick, wenn man deshalb glaubte, daß sie erfolglos sind. Das Charakteristische für diese Bewegungen ist vielmehr eine außerordentliche Perfektion der Mittel, nämlich in erster Linie der propagandistischen Mittel in einem weitesten Sinn, kombiniert mit Blindheit, ja Abstrusität der Zwecke, die dabei verfolgt werden. Und ich glaube, daß gerade diese Konstellation von rationalen Mitteln und irrationalen Zwecken … in gewisser Weise der zivilisatorischen Gesamttendenz entspricht, die ja überhaupt auf eine solche Perfektion der Techniken und Mittel hinausläuft, während der gesamtgesellschaftliche Zweck dabei eigentlich unter den Tisch fällt. Die Propaganda ist vor allem darin genial, daß sie bei diesen Parteien und diesen Bewegungen die Differenz, die fraglose Differenz zwischen den realen Interessen und den vorgespiegelten falschen Zielen ausgleicht. Sie ist wie einst bei den Nazis geradezu die Substanz der Sache selbst. Wenn Mittel in wachsendem Maß für Zwecke substituiert werden, so kann man beinahe sagen, daß in diesen rechtsradikalen Bewegungen die Propaganda ihrerseits die Substanz der Politik ausmacht. Und es ist ja kein Zufall, daß die sogenannten Führer des deutschen Nationalismus … eben in erster Linie Propagandisten waren und daß ihre Produktivität und Phantasie in die Propaganda hereingegangen ist.“
Wie bereits in einem anderen Essay ausgeführt, ist für Adorno „Rechtsradikalismus kein psychologisches und ideologisches Problem, sondern ein höchst reales und politisches“. Das sich daran offensichtlich nichts geändert hat – das haben die Investigativjournalistinnen und -journalisten der Plattform Correctiv heute in einer szenischen Lesung im Berliner Ensemble gezeigt, bei der sie über ihre jüngst veröffentlichten Recherchen zu einem Treffen von Politikern und Rechtsextremisten hinaus weitere erschreckende Details bekannt gemacht haben. Eine Aufzeichnung des Abends sowie eine gekürzte Textfassung stellen sie auf ihrer Webseite zur Verfügung.
Tokajer
Tokaji, wie er geschrieben wird, ist ein bisweilen süßer Wein aus edelfaulen Trauben, der in der Region Tokaj wächst. Tokaj liegt im Nordosten Ungarns in den Ausläufern der Karpaten, etwa 200 Kilometer östlich von Budapest, nahe der slowakischen Grenze, und ist sowohl der Name eines Dorfes, als auch der Weinregion. Das Weinbaugebiet besteht aus 27 Gemeinden und wurde bereits um 1700 klassifiziert und in Crus unterteilt, die sich dort am Rand des Zemplén-Gebirges befinden, das vulkanischen Ursprungs ist und dessen Kegel am Nordrand der ungarischen Tiefebene stehen.
Grundsätzlich wird das Geschmacksbild eines Tokaji vom vulkanischen Tuffboden geprägt und den drei zugelassenen weißen Rebsorten, die auf nicht ganz 6.000 Hektar wachsen und am Drahtrahmen erzogen werden, wo sie ein breites „V“ bilden:
- Furmint: 70 Prozent entfallen auf diese säurereiche Rebsorte, die spät reift, dünnschalig ist und insofern anfällig für Botrytis cinerea. Sie ist die Hauprebsorte für Aszú-Weine und hat Aromen von Apfel und gereift nussige Noten sowie Honig.
- Hárslevelü: Die „Lindenblättrige“ bringt Duft in die Cuvée und ist reich an Zucker und Aromen. Furmint und Hárslevelü werden oft miteinander gelesen, gepresst und vergoren.
- Sarga Muskotály: 5 bis 10 Prozent macht die Muscat Blanc à petits grains aus. Sie wird entweder wie in Sauternes als Würze beigemischt oder als üppige Spezialität für sich verarbeitet.
Die besten Weinberge für diese drei Rebsorten liegen an nach Süden ausgerichteten, leicht ansteigenden Hügeln an den beiden Flüssen Bodrog und Tisza (Theiß), die an der Südspitze der Kette zusammenfließen. Das Klima ist gemäßigt und zeichnet sich durch trockene, wenig heiße Sommer und lange, sonnenreiche Herbste aus. Von der Ebene strömen warme Sommerwinde herein, die Karpaten schützen im Nordwesten und Osten vor kalten Winden und die von den Flüssen heranziehenden Nebel – am frühen Morgen steigt die Feuchtigkeit auf – begünstigen das Entstehen des Botrytispilzes (Botrytis cinerea), der für die Tokaji so essentiell ist.
Die Edelfäule aber entsteht nicht jedes Jahr, man kann daher verschiedene Stile, insbesondere im Hinblick auf den Restzuckergehalt, unterscheiden. Je nachdem, wie stark sich die Edelfäule entwickelt hat, werden die Trauben bei der Lese, die traditionell am 28. Oktober beginnt, nach drei Kategorien getrennt gelesen:
- Trockene Weine: Weine ohne Botrytis, die in 0,75-Liter-Flaschen sortenrein abgefüllt werden.
- Tokaji Szamorodni („wie er gewachsen ist“): Hier sind die Trauben nur teilweise von Botrytis befallen. Je nachdem kann Szamorodni trocken (szaras) sein, oder süß (édes), wobei auch die trockenen Weine Charakterzüge von Edelfäule aufweisen. Unabhängig davon müssen beide mindestens zwei Jahre reifen, davon mindestens ein Jahr im Holzfass.
- Tokaji Aszú („Ausbruch“): Dieser Wein unterscheidet sich von den trockenen Stilistiken, denn seine Trauben sind von Botrytis cinerea befallen, einem auch als Edelfäule bezeichneten Grauschimmel. Nur die edelfaulen Beeren (diese werden „aszú“ genannt) werden für ihn von Hand gelesen. Sie werden einzeln aussortiert und in großen Tanks zur weiteren Verarbeitung bewahrt. Die gesunden Trauben werden in ein bis zwei Tagen normal trocken vergoren, die selektierten Aszú-Beeren werden hingegen zu einer Paste verarbeitet, von Hand geknetet oder von Maschinen püriert. Diese Paste wird dem trockenen Grundwein in dosierten Mengen beigegeben. Als Maß gelten die sogenannten Puttonyos beziehungsweise Butten à 25 Kilogramm, die den traditionellen 136-140-Liter-Fässern („gönci“) hinzugefügt werden. Meist sind es vier bis sechs Butten, die hineingerührt werden und 1 bis 5 Tage drin bleiben (das heißt mit sechs Butten ist das Fass voll. Der trockene Grundwein wird nur genutzt, um den Zucker aus der Paste zu waschen). In dieser Zeit führt der Zuckergehalt zu einer neuerlichen Gärung, die sich je nach Zuckergehalt und Kellertemperatur richtet: Je süßer der Wein und je kälter der Keller, desto langsamer verläuft der Fermentationsprozeß (die Gärung). Die feinsten Gewächse haben einen Süßegrad mit wenig Alkohol – meist 10,5 Volumenprozent Alkohol -, einfachere 12 bis 13 Volumenprozent.
Die Weine aus Tokaj sind für Ungarn enorm wichtig und werden sogar in der Nationalhymne des Landes erwähnt: „Und du fülltest unsere Becher mit süßem Nektar aus Tokaj“, heißt es darin. In ihrer Nationalhymne danken die Ungarn insofern Gott dafür, dass er ihre Gläser mit Tokaji füllt. Der honigfarbene Likörwein entsteht aus der Spätlese und ist seit über fünfhundert Jahren das Symbol eines Landes, das sich nur mühsam aus den Fängen seiner Besatzer befreien konnte: Osmanen, Österreicher und Sowjets. Als Ungarn im 16. Jahrhundert von den Osmanen beherrscht wird, spielte der Weinanbau aufgrund des Alkoholverbots im Islam nur eine kleine Rolle. Doch in dieser abgelegenen Region wird die schon damals 600jährige Tradition um jeden Preis aufrechterhalten.
Tokaj wird in dieser Zeit, in der Mitte des 16. Jahrhunderts, für den süßen Tokaji Aszú berühmt. Er entsteht aus edelfaulen Trauben – was allerdings eher zufällig entdeckt wurde: Die Legende besagt, dass es in jenem Jahr sehr heiß war, doch die Leute, die für die Weinlese verantwortlich waren, konnten sie nicht zur gewohnten Zeit durchführen, da sie sich vor türkische Truppen verstecken mussten, die seit 1650 im Land waren. So wurde verfügt – 125 Jahre früher als auf Schloss Johannisberg, wo die Spätlese „erfunden“ wurde -, die Trauben zunächst hängen zu lassen und erst später zu lesen: Erst Ende November konnten sie aus ihren Verstecken kommen und mit der Lese beginnen – da waren die Trauben jedoch schon voller Botrytis. Als man die befallenen Trauben allerdings probierte, stellten die Leute fest, dass die Beeren wunderbar süß waren und überaus köstlich. Also mischten sie sie einfach mit dem Wein aus dem Vorjahr – und stellten so den ersten Tokaji Aszú her. Früher war der Aszú aufgrund seiner natürlichen Restsüße unglaublich wertvoll, weil Zucker in jener Zeit Mangelware war. Noch heute aber werden die Trauben einzeln und von Hand gelesen und in die Puttonyos genannte Masse umgewandelt, die mit Weißwein der aktuellen Saison vermischt wird. Diese Keltermethode von vor 400 Jahren hat man insofern bis heute beibehalten, weil sie noch immer sehr gut funktioniert.
Zum Ende des 17. Jahrhunderts wird Ungarn zwar von den Osmanen erlöst, doch es muss sich nun seinen Befreiern beugen und steht fortan unter österreichischer Herrschaft. Der liebliche Tokaji entwickelt sich schnell zum Instrument der Emanzipation: In jener Zeit befindet sich die Burg in Sárospatak inmitten des Tokajer Weinbaugebietes im Besitz der Rákóczi, einem der namhaftesten Adelsgeschlechter in der Geschichte Ungarns. Ihnen gehören immense Ländereien und etwa zwei Drittel des Weinanbaugebietes. Am Aufstieg des Likörweins sind sie maßgeblich beteiligt.
Sigismund II. Rákóczi ahnte schon Ende des 16. Jahrhunderts von der großen Entwicklung der Tokajer Weinregion. Also erwarb er Weinberge für seine Familie. (In dem „Oremus“-Weinberg der Rákóczis wurde der erste Aszú-Wein gemacht, heute gehört das Weingut allerdings zum spanischen „Vega Sicilia“ von Pablo Alvarez.) Über die ungarischen Landesgrenzen hinaus bekannt wird der Tokajer dank seine Nachfahren, Franz II. Rákóczi. Der transsilvanische Prinz wird in Ungarn als Nationalheld gefeiert. Zu Beginn des 18. Jahrhunderts übernimmt er die Führung im Aufstand gegen die Habsburger. Einen Verbündeten findet er in Ludwig den XIV., der ebenfalls gegen die österreichische Macht kämpft. Der ungarische Prinz nutzt seinen Wein als diplomatisches Mittel: Franz II. erwies Ludwig XIV. offenkundig seine Ehre, als er ihm einen Tokaji einschenkte. Als Ludwig den edlen Wein getrunken hat soll er gesagt haben: „Das ist der König der Weine, ein Wein für Könige.“ Und so verbündeten sich die beiden gegen die Habsburger. Doch der Aufstand scheitert und Ungarn bleibt unter habsburgischer Herrschaft.
Die lobenden Worte des französischen Königs stärken den Ruf des Tokaji, der dann bald von allen europäischen Herrschern getrunken wird. Die Fässer wurden erst nach Polen exportiert, dann in den Westen nach Frankreich und England, und schließlich auch in den Osten an den russischen Zarenhof. Irgendwann kamen dann Bestellungen von allen königlichen Höfen – auch von den deutschen Fürstentümern.
Mit dem großen Erfolg an den europäischen Höfen, musste der Handel mit Tokaji umorganisiert werden. In Tokaj fließt der Bodrog und Tisza (Theiß). Die beiden Wasserläufe sind nicht nur für die Botrytis cinerea wichtig, sondern dienen dem Transport von Weinfässern und verwandeln den kleinen Ort in ein Handelskreuz. Fremde, die bis dahin als Eindringlinge gefürchtet waren, werden mit offenen Armen empfangen. Christen aus den Balkanregionen und Juden gesellen sich zur einheimischen Bevölkerung. Noch heute sind aus dieser Zeit eine orthodoxe Kirche, eine katholische Kirche und eine Synagoge im Dorf vorhanden.
Unter dem Einfluss der fremden Handelsleute, die von den Einwohnern als „Griechen“ bezeichnet werden, nimmt Tokaj neue Gestalt an. Die durch den Wein reich gewordenen Händler ließen repräsentative Steingebäude im Barockstil errichten. Im Erdgeschoss befand sich der Verkaufsladen und im Lager neben standen die Weinfässer. Im Obergeschoss befanden sich die komfortablen, prächtig ausgestatteten Wohnräume.
Im 20. Jahrhundert wird das Schicksal Ungarns erneut herausgefordert. Im Der Vertrag von Trianon – einem der Pariser Vorortverträge, die den Ersten Weltkrieg formal beendeten – muss das Land für seine Allianz mit dem Deutschen Reich im Ersten Weltkrieg büßen und verliert zwei Drittel seines Territoriums. Ein großer Teil des Tokajer Weingebietes geht an die Tschechoslowakei über, weshalb Tokaji neben der Region Tokaj auch heute noch in drei Gemeinden in der Slowakei produziert werden darf.
Im Zweiten Weltkrieg werden dann nicht nur Gebiete zerstört, sondern auch ganze Teile der ungarischen Bevölkerung vernichtet. Mit der Ermordung hunderttausender Juden verliert das Land seine Handelselite. Am Ende des Konflikts wird Ungarn vom Ostblock einverleibt und verliert erneut seine Unabhängigkeit.
Das sozialistische System hat damals das gesamte Wirtschaftsleben des Landes dominiert: Landwirtschaftliche Flächen wurden in Kollektive überführt. Dieser Fehler der Nationalisierung traf auch den Weinhandel: In der kommunistischen Ära wurde der Tokaji ausschließlich an kommunistische Länder verkauft, insbesondere an die Sowjetunion. Für diesen Markt wurde industrielle Mengen an Wein benötigt, worunter die Qualität der Weine litt.
Nach dem Fall der Mauer 1989 versuchen die nun endlich unabhängigen Ungarn als Nation zu existieren und alle Erniedrigungen hinter sich zu lassen. Im Ausland erfreut sich der Tokaji seither wieder großer Beliebtheit und gelangt auch zu neuem alten Ruhm.
Neuerdings wurden die gesetzlichen Vorgaben für die Herstellung von Tokaji geändert: Das Gönci-Fass darf nun nur noch 100 Liter fassen, der Restsüßegehalt beträgt dann bei drei Butten 90 Gramm pro Liter, bei vier Butten 110 Gramm pro Liter et cetera. Daraus ergeben sich auch neue Stilistiken bei den Weinen, wobei fortan folgende Regelungen gelten:
- Tokaji Aszú muss mindestens zwei Jahre im kleinen Holzfass reifen und ein Jahr in der Flasche (früher wurde er noch länger ausgebaut). Dadurch entstehen tiefdunkle, bernsteinfarbene Weine (ähnlich den italienischen Ripasso-Weinen) mit frischen Fruchtnuancen beziehungsweise einer beträchtlichen Säure und Aromen von Orangenschalen, Aprikosen und Honig – als ob er aus Trockenfrüchten hergestellt worden wäre.
- Tokaji Eszencia mit 450 Gramm Restzucker pro Liter darf ausschließlich aus Vorlaufmost des Aszú bestehen, der Jahre braucht bis er vergoren ist und nur circa fünf Volumenprozent Alkohol hat (hier gibt es keinen Mindestalkoholanteil wie bei Beerenauslesen und Trockenbeerenauslesen in Deutschland, die mindestens 5,5 Volumenprozent Alkohol haben müssen). Tokaji Eszencia ist honigartig beziehungsweise wie ein Nektar.
- Late Harvest: Diese Weine werden wie Sauternes auch mit botrytisierten Beeren hergestellt, diese werden jedoch mitvergoren (wie Spätlesen oder Trockenbeerenauslesen) und nicht eingemaischt wie bei Tokaji Aszú.