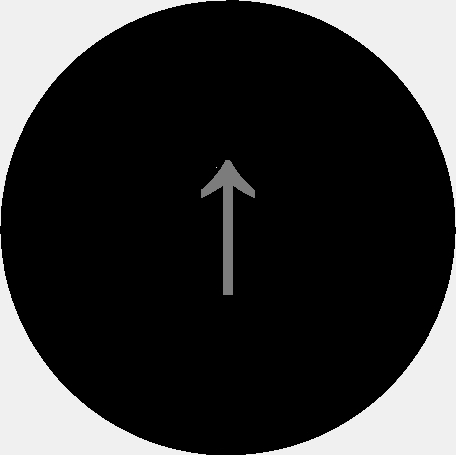„Durch Vernunft (Überzeugung) oder Stärke“, „Por la razón o la fuerza“ – schon in der Maxime des Landes ist angezeigt, dass ein Riss durch Chiles Gesellschaft geht, die seit dem gewaltsamen Sturz des Sozialisten Salvador Allende vor fünfzig Jahren noch immer vom Neoliberalismus der Diktatur unter General Augusto Pinochet geprägt ist. Gerade auch die Landwirtschaft und der Weinbau erzählen von dieser Spaltung …
„Die Arbeiter sollten am Samstag bezahlt werden. Doch bei der Bankfiliale in Temuco lief etwas schief, und das Geld kann erst am Montag ausgezahlt werden. Über 1.500 aufgebrachte Männer bereiten sich auf einen Marsch nach Temuco vor. Es wird ein Blutbad geben. Und wenn die Bahnarbeiter durchkommen, wird die Stadt Plünderungen und Brandschatzungen ausgesetzt sein. Ich erkläre mich bereit, die aufgebrachte Meute zu beruhigen. Gegen 11 Uhr vernehme ich das Gebrüll der Horde, die sich entlang der Bahnlinie nähert. `Na, Kinder, was ist denn los?´ Sie schreien alle durcheinander. Ich hebe die Hand, und es wird auf wundersame Weise still. `Nun, da wir in Ruhe miteinander reden können, sagt mir einfach, was ihr wollt!´ Sie antworten mir einmütig: `Zahltag! Zahltag! Auf zur Bank! Auf zur Bank!´ Die Situation droht zu eskalieren. Ich setze all meine Überzeugungskraft ein und führe an, dass intelligente Menschen wie sie es sicher verstehen, dass die Lohnzahlung auf jeden Fall am Montag erfolgen wird. Es warte ein Mittagessen auf sie, wenn sie zur Arbeit zurückkehren. Bohnen mit einer doppelten Portion Chili und einer zusätzlichen Scheibe Brot. Ich werde die Anweisung geben, dass ihnen gegen Gutscheine Wein und Spirituosen verkauft werden. Allmählich entspannen sich ihre Gesichter. Applaus erschallt. Die Schlacht ist gewonnen. Ich rufe an und drei Lokomotiven mit flachen Ladewaggons kommen. Die Bahnarbeiter springen wie Schulkinder in den Ferien auf die Waggons und rufen aus voller Kehle: `Viva el patron! Es lebe der vieräugige Gringo!´ Nie wieder in meinem Leben wird man mir so zujubeln. Ich reagiere freudig mit einem schallenden `Viva Chile!´, worauf mir ein lautes `Viva Chile, mierda!´ entgegen hallt.“
Der belgische Eisenbahningenieur Gustave Verniory in „Notizen für einen Film“ (2022), ein Film von Ignacio Agüero frei nach Verniorys Aufzeichnungen „Zehn Jahre in Araukanien 1889-1899“
Nachdem sich Chile schon 1818 endgültig von der spanischen Kolonialherrschaft befreien konnte, einigte man sich 1881 schließlich in einem Friedensvertrag auch mit Argentinien über die Grenzziehung zwischen den beiden Ländern. Auch über die Aufteilung Patagoniens konnte man sich verständigen – einer riesigen eisigen Landschaft im Süden des Landes, die sich bis nach Feuerland und zum Kap Hoorn erstreckt. Die Region nördlich von Patagonien hieß Araukanien – es war das angestammte Gebiet der Mapuche (die früher Araukaner genannt wurden), einem indigenen Volk. Die Region etwa 600 Kilometer südlich von Santiago de Chile wurde schon ab den 1860er Jahren nach und nach gewaltsam von chilenischen Soldaten bedrängt und schließlich 1883 auch erobert: Nachdem sich die Mapuche letztlich dreihundert Jahren in unerbittlichen Kämpfen gegen die Eroberung gewehrt haben, wird die Region zwischen dem Rio Malleco im Norden und dem Rio Toltén im Süden nun ins chilenische Staatsgebiet eingegliedert.
Um Aufstände zu verhindern, wurden die verschiedenen Stämme der Mapuche voneinander abgegrenzt und in Reservate umgesiedelt, sodass der chilenischen Regierung nun über zwei Millionen Hektar an fruchtbarstem Boden im Süden des Landes zur Verfügung stehen. Früher reichte das chilenische Staatsgebiet nur bis zum Rio Malleco, nun wird den bislang hier lebenden Mapuche das Land von weißen Siedlern gestohlen, die beginnen sich hier niederzulassen, nachdem die Regierung beschlossen hatte, eine Eisenbahnlinie zwischen Santiago und der neu gegründeten Stadt Temuco zu errichten, für die auch der eingangs zitierte junge belgische Ingenieur Gustave Verniory tätig war.
Doch diese Landnahme lief nicht ohne Widerstand der Mapuche ab, die ihr Land verteidigten: Der deutsche Einwanderer Otto Reich in La Frontera – den Namenszusatz de la frontera bekamen in Andalusien übrigens alle Ortschaften, in denen sich Christen und arabische Eroberer gegenüber standen – berichtet Verniory von Ereignissen im Februar 1881, davon, dass Indios die Siedler, die von ihnen „Huinca“ oder „Wingka“ genannt wurden, angriffen, die Ernte niederbrannten und Siedler in ihren abgelegenen Gehöften töteten. Die Überlebenden schlossen sich in der Stadt zusammen – und vernichteten die Mapuche schließlich mit ihren Winchester-Gewehren. Gegen diese Repetiergewehre mit sechs Schuss Munition ohne nachzuladen waren die Mapuche chancenlos …
Die Siedler nahmen nun die Ländereien der Indios endgültig in Besitz und errichteten darauf riesige Haciendas, oft hunderte Hektar große landwirtschaftlich genutzte Güter, die sie hauptsächlich zum Weizenanbau nutzten, während die Mapuche in ihren Reservaten verelendeten, Hunger litten und wie Sklaven in einem Feudalsystem für die reichen Siedler die Feldarbeit erledigen mussten – auf ihrem eigenen Grund und Boden eigentlich.
Schon bevor die chilenische Regierung die riesigen Gebiete der Mapuche für die Landwirtschaft nutzbar machen konnte, hat sie sich im Norden des Landes ein Gebiet mit einem außergewöhnlichen Reichtum an Bodenschätzen gesichert: Hier kam es aufgrund von Gebietskonflikten zwischen 1879 und 1884 zum sogenannten „Salpeterkrieg“ mit den Nachbarstaaten Bolivien und Peru. Dabei ging es um einen Teil der Atacamawüste mit ihren wertvollen Salpetervorkommen. Nach zahlreichen Seegefechten siegte Chile schließlich und Bolivien büßte seinen Zugang zum Pazifik ein, Peru wiederum musste seine südlichste Provinz an Chile abgeben.
Seither verfügt Chile über zahlreiche natürliche Ressourcen und Rohstoffvorkommen, die vor allem in den im Norden des Landes liegenden Bergwerken abgebaut werden. In der Provinz Arica mit ihren reichen Salpetergruben in der Wüste Atacama regieren dabei zunächst die sogenannten Salpeterbarone. Der kostbare Bodenschatz, entstanden aus Meeresablagerungen, ist ebenso geeignet für die Herstellung von Düngemitteln wie für die Gewinnung von Sprengstoff und beschert den Baronen in den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg ungeheure Gewinne.
Von diesen Gewinnen errichteten sich die reichen Industriellen große Landgüter im Valle Central südlich der Hauptstadt, die man über die Sommermonate nutzte. Zu den ersten Industriellen gehörte auch Don Melchor Santiago de Concha y Torro, ein 1832 geborener Anwalt und Unternehmer aus der ebenfalls sehr bedeutenden Textilindustrie, dessen Eltern ursprünglich aus Spanien kamen. Er errichtete sein Landgut in der Gegend um Pirque, einige Kilometer südlich von Santiago de Chile. Seine repräsentative Hacienda steht dabei sinnbildlich für die chilenische Oligarchie in den 1860er Jahre, liegt es doch inmitten eines sich über tausende Hektar erstreckenden Landguts – in das die Industriellen nun französische Önologen zur Bewirtschaftung ihrer Latifundien holen.
Seit der Zeit der Gründung der katholischen Missionen spielt der Weinbau keine bedeutende Rolle mehr in Chile. Das ändert sich nun, wobei die Önologen nicht nur ihr Wissen, sondern auch französische Rebstöcke mitbringen, insbesondere ursprünglich in Bordeaux beheimatete Rebsorten wie die Carmenère, die im Zuge der Reblauskrise in Bordeaux praktisch ausgerottet wurde und nun in Chile gewissermaßen einen rettenden Hafen fand, weil die Reblaus nie hierher fand.
Im Valle Central, das von der Hauptstadt Santiago 400 Kilometer weiter südlich reicht und aus den Regionen Maipo, Rapel, Curico und Maule besteht, liegen heute 90 Prozent der chilenischen Rebflächen, obwohl es praktisch eine Trockensteppe ist, in der Weinbau nur durch künstliche Bewässerung möglich ist. Gleichwohl hat auch Concha y Torro schon früh französische Rebsorten hierher nach Pirque importiert, insbesondere Cabernet Sauvignon, die sich gut an das sonnige Klima im Tal anpasste. Seinen ersten Wein benannte er „Melchor“ – und legte damit den Grundstein dafür, dass Concha y Torro heute mit über 56 Weinbergen, die sich auf mehrere Tausend Hektar erstrecken, der größte Weinproduzent Lateinamerikas ist. Aber auch andere wohlhabende Großgrundbesitzer, sogenannte Latifundistas, eiferten ihm nach und begannen ebenfalls schon Ende des 19. Jahrhunderts auf ihren riesigen Ländereien Wein anzubauen.
Auf den Bodenschätzen in der Atacamawüste im Norden des Landes beruht Chiles Reichtum – sie sollten nach der Unabhängigkeit im 19. Jahrhundert neben Weizen zu den wichtigsten Exportgütern des Landes werden. Allerdings kam dieser Reichtum nie der ganzen Gesellschaft zugute, sondern seit der spanischen Kolonialzeit waren es immer nur einige wenige, die das Land kontrollierten und nun die Gewinne aus dem Bergbau und der Landwirtschaft unter sich aufteilten. Seit jeher geht insofern ein Riss durch die chilenische Gesellschaft.
Daran änderte sich auch nichts, als Salpeter in der Zeit, in der in Europa der Erste Weltkrieg ausbrach, seine Bedeutung als wichtigste Ressource des Landes verlor. Denn deutsche Chemiker um Carl Bosch und Fritz Haber haben 1910 ein Verfahren zur synthetischen Herstellung von Stickstoff im industriellen Maßstab erfunden, die sogenannte katalytische Ammoniak-Synthese, mit deren Hilfe Stickstoff aus der Luft mit Wasserstoff zu Ammoniak verbunden werden konnte. Ammoniak wiederum dient in der Landwirtschaft als Grundstoff für Kunstdünger, mit dem Verfahren konnte jedoch auch Salpeter produziert werden, der als Grundsubstanz von Explosivstoffen diente – was natürlich die Abhängigkeit der Kriegsindustrie von Salpeterimporten aus Chile deutlich reduzierte.
Von den Salpeterfeldern wechseln zu dieser Zeit viele Mineros einfach in die Kupfergruben in der Atacamawüste. Denn mit einem Anteil von 30 Prozent ist Chile der weltweit größte Kupferproduzent, verfügt nicht nur über große Salpeter-, sondern auch über die weltweit größten Vorkommen dieses Metalls. Die Kupferförderung macht noch heute zehn Prozent der Wirtschaftsleistung des Landes aus (außerdem lagern im Salar de Atacama über 40 Prozent der weltweiten Lithium-Vorkommen).
Der Kupferabbau in Chuciquamata war bis 2019 der größte in der ganzen Welt: fast fünf Kilometer lang, drei Kilometer breit und über einen Kilometer tief ist der Tagebau. Das Kupfererz liegt hier in tiefen Adern längst erkalteter Vulkane, unter denen einst die Erdkruste der sich unter Südamerika schiebenden Nazca-Platte schmolz und in Form von Magma nach Oben drängte. Unter großem Druck und hohen Temperaturen schied Wasser dabei das Kupfer aus dem heißen Gestein ab und konzentrierte es zu Gängen von grünen und türkisblauen Mineralien.
Kupfer bildet insofern schon sehr früh das Rückgrat der chilenischen Wirtschaft – und lockte bald auch nordamerikanische Manager ins Land. Es dauerte nicht lange, bis man US-amerikanisches Kapital in den lukrativen chilenischen Bergbau investierte und Dollar das Land fluteten. Vor allem die Anaconda Copper Mining Company – als ob sie ihrem Namen alle Ehre machen will – schien die kleinen einheimischen Bergbaubetriebe zu erdrücken. Schnell stieg sie zu einer der größten Kupfergesellschaften der Welt auf. Ansonsten machte der intensive und oft maßlose Abbau von Bodenschätzen Chile zu einem der reichsten Länder Lateinamerikas – das führte aber auch zur Zerstörung der Umwelt und sozialer Ungleichheit, die sich aber schon in diesen Jahren bemerkbar machte.
Ende der 1920er Jahre trifft die Weltwirtschaftskrise auch Chile hart und führt dazu, dass das Regime des Obersten Carlos Ibanez del Campo 1931 ins Wanken gerät. Er wollte die Modernisierung des Landes voranbringen, erklärte er, aber im unterentwickelten Chile der frühen 1930er Jahre ist die Ökonomie gelähmt, da nicht nur die Salpeter-, sondern später auch die Kupferpreise in den Keller gefallen sind. So kommt zu ersten sozialen Unruhen und Aufständen, die 1934 in einer großen Rebellion der Mapuche in Ranquil, ziemlich genau zwischen Santiago und Temuco gelegen, münden. Es war der letzte große Aufstand der Indios, der durch Polizeikräfte jedoch niedergeschlagen wurde. Im Management der Kupferkonzerne, insbesondere aber auch in den Herrenhäusern der Großgrundbesitzer atmete man auf: das Gespenst des Sozialismus, das sich hier kurz gezeigt hat – es konnte erst einmal noch vertrieben werden.
Gleichwohl geht die sozialistische Idee nun auch in Chile um – und so wird 1933 die Sozialistische Partei (Partido Socialista de Chile, PS) gegründet, eine nicht Moskautreue Arbeiterpartei. Salvador Allende war einer der Mitbegründer. Soziale Ansprüche, die in Europa in den Arbeiterbewegungen seit den letzten Jahrzehnten des 19. Jahrhundert laut wurden, sprangen nun auch auf die Länder Lateinamerikas über, wo sich viele mit krassen sozialen Widersprüchen konfrontiert sahen. Viele begreifen sich als Marxisten und versammeln sich nun in der neuen revolutionären Partei, die sich den Klassenkampf auf ihre Fahnen geschrieben hat – er sei der „Motor der Geschichte“, wie es in ihrer Deklaration hieß. Für Allende hingegen war schon immer klar, dass es die „Diktatur des Proletariats“ nicht geben sollte. Was er übernahm, war das Engagement für die Arbeiter und die Armen – er wollte ein Klassenbewusstsein schaffen – sowie die Idee der Gleichheit aller. Von Anfang an aber wollte Allende aber einen demokratischen Weg beschreiten – anders als faschistische Bewegungen wie die Nationalsozialistische Bewegung Chiles (Movimiento Nacional-Socialista de Chile, MMNS, oder auch Nacismo), die nun Anfang der 1930er Jahre in Chile ebenfalls enstehen.
Eilig beendete Allende in dieser Zeit in Valparaiso die Arbeit an seiner Doktorarbeit über Mentale Hygiene und Kriminalität, wo sich der junge Arzt mit den Hintergrundfaktoren Alkohol, Drogen und Krankheiten im sozialen Umfeld auseinander setzt. Alkoholismus ist – wie auch Gustave Verniory in seinen Aufzeichnungen immer wieder berichtet – weit verbreitet, vor allem in den überquellenden Elendsquartieren der chilenischen Städte jener Zeit. Seit mehr als drei Jahrzehnten gilt Trunkenheit deshalb als kriminelles Delikt, auch wenn dieses Gesetz kaum Wirkung zeigt. Deshalb wurde 1938 schließlich ein Prohibitionsgesetz eingeführt, dessen verheerende Auswirkungen auf den chilenischen Weinbau sich noch einmal verschärften, als Allende zwei Jahre nachdem er erstmals in den Kongress gewählt wurde, während einer liberalen Regierung, 1939 zum Gesundheitsminister ernannt wurde. Er war damals dreißig Jahre alt – un bringt als junger Minister bis 1942 zahlreiche Gesetzesinitiativen zur Gesundheits- und Sozialpolitik ein, die endgültig den Niedergang des eigentlich noch im Aufbau befindlichen chilenischen Weinbaus in den nächsten Jahrzehnten einläuteten.
1942 wird Allende Generalsekretär der Sozialistischen Partei. Für die nächste Wahl – bei der er 1945 zum Senator gewählt wird – lässt er sich nicht mehr im heimatlichen Valparaiso aufstellen, sondern in einem ländlichen Wahlbezirk im Süden Chiles. Dort, in den rauen Regionen der Provinzen Osorno, Valdivia und Llanquilhue, trifft er erstmals persönlich auf das Elend der indigene Landarbeiter*innen auf den großen Haciendas und erlebt vor Ort, wie vor allem die Mapuche noch immer in feudaler Abhängigkeit leben. Es ist hier jedenfalls – ähnlich wie in Sizilien – üblich, dass Grundherren ihre Güter von Verwaltern beaufsichtigen lassen, während sie selbst in Santiago oder den noblen Küstenorten wohnen.
Allende gründet nun, 1946, die Sozialistische Volkspartei, in der nach dem zeitweiligen Verbot der Kommunistischen Partei Chiles im Jahr 1948 viele Kommunisten „politisches Asyl“ fanden. Diese Entwicklung trug wesentlich dazu bei, dass 1951 eine neue Organisation entstand, die Frente Nacional del Pueblo, eine Volksfrontorganisation, in der sich mehrere kommunistische und sozialistische Parteien zusammenschlossen. Sie nominierten im darauffolgenden Jahr den damals 43-jährigen Salvador Allende als ihren gemeinsamen Präsidentschaftskandidaten für die Wahl 1952.
Allende entfaltete in dieser Zeit sein ganzes Redetalent bei den Mineros in den Kupferbergwerken im Norden, aber auch bei den Campesinos und Landarbeiterr*innen im Süden – scheiterte bei der Wahl aber schließlich doch deutlich, genauso wie bei den beiden nachfolgenden Präsidentschaftswahlen 1958 und 1964. Immerhin konnte er 1954 das Amt des stellvertretenden Senatspräsidenten antreten.
Die soziale Ungleichheit zeitigt in dieser Zeit Folgen: die seit den 1920er Jahren aktiven Landarbeitergewerkschaften (Ligas Campesinas) bekommen Zulauf und linke Parteien wie die Sozialistische Partei finden nun auch zunehmend auf dem Land Unterstützung. So muss die seit 1958 regierende liberal-konservative Koalition von Präsident Jorge Alessandri bei den Parlamentswahlen 1961 große Verluste hinnehmen.
Die Situation eskaliert, als 200 Kilometer südlich von Santiago de Chile, im Valle de Colchagua, ein politischer Machtkampf zwischen den Großgrundbesitzern und den Campesinos ums Wasser ausbricht: Die landwirtschaftlich geprägte Region im Valle Central wird vom Wasser des Flusses Tinguiririca gespeist und ist eines der Epizentren der Auseinandersetzung. Dabei befand sich das Land hier – praktisch alle Hügel und Ebenen der umliegenden Gegend – im Besitz einer einzigen Familie, die auch über die Verteilung des Wassers bestimmte.
Wie überall in Lateinamerika war der Großgrundbesitz auch hier ein Erbe der spanischen Kolonialzeit: In Chile konzentrierten noch Mitte der 1950er Jahre etwa 10.000 Großgrundbesitzer über 80 Prozent aller Agrarflächen, während die Hälfte der Campesinos überhaupt kein Land besaß. Die Mehrheit der Bauern konnte Land allenfalls pachten, während auf den Haciendas selbst eine fest verwurzelte, feudalistische Latifundienstruktur existierte, bei der viele überwiegend indigene Arbeiter*innen die Landarbeit in völliger Abhängigkeit von den wenigen reichen Landbesitzern erledigten.
In der Landwirtschaft manifestierte sich so, über die territoriale Ebene und die Eigentumsverhältnisse hinaus, auch ein politisches Machtgefüge – das nun in den 1960er Jahren aber zu kippen drohte, als das chilenische Volk mit Unterstützung der katholischen Kirche auf eine Bodenreform unter dem Motto: „La tierra para el que la trabaja“ („Das Land denen, die es bewirtschaften“) drängte.
Unter dem zunehmenden Druck der Landbevölkerung konnte die Regierung die soziale Frage auf dem Land nicht länger ignorieren. Und so wurden 1962 schließlich Reformen beschlossen – die dann aber statt zu weitreichenden Veränderungen in erster Linie doch nur zu Absichtserklärungen führten. Zwar machte ein neues Gesetz nun theoretisch auch Enteignungen möglich, es führte praktisch aber doch nur zum Kauf und der Umverteilung von gerade einmal 50.000 Hektar Land – damals ein Prozent der landwirtschaftlichen Nutzfläche, weshalb das Gesetz auch als „Blumentopfreform“ bekannt wurde. Vor allem die Großgrundbesitzer, die oftmals direkt im Kongress vertreten waren, setzten alles daran, echte Reformen zu verhindern.
Trotz aller Unzulänglichkeiten legte das neue Gesetz den Grundstein für das Nationale Institut für landwirtschaftliche Entwicklung (Indap), den Rat für landwirtschaftliche Entwicklung (Consfa) und das staatliche Unternehmen Cora – später, unter anderen politischen Vorzeichen, allesamt wichtige Instrumente einer progressiven Agrarpolitik, gemeinsam mit dem interamerikanischen Komitee für Agrarentwicklung (Cida) – bevor schließlich die christdemokratische Regierung von Eduardo Frei Montalva, er regiert seit 1964, ein Gesetz erlässt, das die Bauerngewerkschaften legalisiert und eine echte Neuaufteilung der Ländereien in Angriff nimmt.
Treibende Kraft hinter dieser Landreform waren Solon Barraclough, der sich zuvor als kritischer Ökonom in den Südstaaten der USA einen Namen gemacht hatte, wo er sich auch für Landlose und Tagelöhner einsetzte –, vor allem aber auch einige katholische Geistliche, die sich schon seit längerem für die Landbevölkerung einsetzten und sie bei arbeitsrechtlichen Forderungen unterstützten. Auch deshalb entschließt sich die Regierung des Christdemokraten Eduardo Frei Montalva 1967 zu einem zweiten Gesetz, mit dem die Agrarreform entscheidend erweitert wurde: Die Enteignung und Umverteilung von Land sollten erleichtert und die Grundversorgung der Landbevölkerung weiter verbessert werden.
Allerdings kommen die Enteignungen nicht so schnell voran wie geplant, bemerkt Allendes Internationale in diesem Zusammenhang in einem ausführlichen Artikel zur Agrarreform: „Auch wenn bis zum Ende von Freis Regierungszeit über drei Millionen Hektar Land sozialisiert werden, macht das insgesamt nur 13 Prozent aller Anbauflächen aus. Die Christdemokraten versuchen sich in einem schwierigen Spagat: sie wollen die Forderungen der Bauern nicht der politischen Linken überlassen und es sich zugleich nicht mit der ländlichen Oligarchie verscherzen. Als eine `Revolution in Freiheit´ verkauft Frei diese Idee – doch bei den Großgrundbesitzern kann er damit wenig punkten, schreibt der engagierte Ökonom Solon Barraclough 1968: `Wissen Sie, was viele der traditionellen Grundbesitzer in Chile, die in letzter Zeit durch eine äußerst bescheidene Agrarreform etwas Land verloren haben, am meisten verärgert? Wissen sie, warum sie bereit wären, fast alles zu tun, um das wieder rückgängig zu machen? Es ist nicht so sehr der Verlust von Reichtum oder gar Land, sondern, dass die Campesinos nicht mehr so bescheiden und ehrerbietig sind.´“
Auch für Salvador Allende wird in dieser Zeit die Landreform und, damit verbunden, die Nationalisierung der Bodenschätze zum wichtigsten Anliegen. Dem Lateinamerika-Korrespondenzen der Moskauer Prawda gegenüber beschreibt er den Grund für die wirtschaftliche Misere seines Landes als in den feudalen Eigentumsverhältnissen liegend, wie Waltraud Hagen und Peter Jacobs in ihrem Chronik über das Leben von „Salvador Allende“ (2008) ausführen: Relativ wenige Großgrundbesitzer beherrschen 87 Prozent des Bodens, während die Campesinos unter den miserabelsten Bedingungen leben müssen. Ein Teil des fruchtbaren Bodens werde sogar überhaupt nicht genutzt, weshalb Chile trotz eigentlich bester Voraussetzungen 20 Prozent seines Lebensmittelbedarfs einführen muss.
Auch beim Kupferbergbau sei die Situation nicht besser: Vier Fünftel davon befinden sich demnach im Besitz nordamerikanischer Unternehmen. Seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs hat die Produktion 480.000 Tonnen erreicht, etwa ein Viertel des Weltbedarfs, aber die Verarbeitung erfolgt nach wie vor im Ausland. Es obliegt somit den Monopolen, die Kupferpreise zu diktieren, ohne das der chilenische Staat darauf einen Einfluss hätte. Das selbe gelte für Salpeter, Eisen und den Schwefel. Hinzu komme, dass ein Abkommen mit den USA verhindert, dass Chile seine Förderprodukte in den Ostblock verkaufen kann, da Kupfer als „strategische Ware“ gilt und deshalb auf der Embargoliste steht.
Aus dieser Analyse leitet Allende seinen Auftrag für einen nationalen Befreiungskampf ab, wie er dem Prawda-Korrespondenten mitteilt. Entsprechend auch stützt er seine Programmatik auf die folgenden vier Grundpfeiler: Bodenreform, Nationalisierung (Enteignung) des Bergbaus und der Eisenindustrie, Kontrolle über die Banken und Schaffung eines sozialen Marktsektors – und Allende lässt keinen Zweifel daran, dass er so den Sozialismus in Chile einführen will. In einem Gespräch mit dem französischen Publizist Régis Debray („Salvador Allende – Der chilenische Weg“, 1970) antwortet Allende auf Debrays Frage, wann und wie die Arbeitenden die Macht erobern wollen: „Ich antworte Ihnen, daß wir sie erobern werden, wenn das Kupfer uns gehört, wenn das Eisen uns gehört, wenn der Salpeter uns tatsächlich gehört, wenn wir eine tiefgehende und schnelle Agrarreform verwirklicht haben, wenn wir den Import- und Exporthandel durch den Staat kontrollieren, wenn wir einen großen Teil unserer Produktion kollektiviert haben (…) Also, wenn das alles – die völlige Souveränität herstellen, die Grundstoffe zurückgewinnen, die Monopole angreifen – nicht zum Sozialismus führt, dann weiß ich nicht, was zum Sozialismus führt.“
Gleichwohl aber scheitert Allende bei der Präsidentschaftswahl 1964 damit, trotz 38,6 Prozent der Stimmen. Dass sich bei dieser Wahl die Christdemokraten unter Frei Montalva durchsetzen konnten führt dazu, dass mehrere junge Mitglieder 1965 die Sozialistische Partei verlassen und das Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), die Bewegung der Revolutionären Linken, gründen. Einer der Initiatoren ist Allendes Neffe. Die Miristas wollen Fakten zugunsten der armen Landbevölkerung schaffen, indem sie Länder besetzen, Banken überfallen und das erbeutete Geld an Bedürftige verteilen – sie nennen das „Direkte Aktion“. Dann aber stirbt 1967 Che Guevara und mit ihm gewissermaßen auch der Traum von der schnellen Revolution in Chile. (Allende, der seit 1966 Senatspräsident ist, wird nun zum Rücktritt aufgefordert, da er die Überlebenden von Che Guevaras Guerillatruppe unter seinen persönlichen Schutz stellte.)
Trotz der Ernüchterung, die nun im linken politischen Spektrum einsetzt, zeigen die von der Presse ausführlich kommentierten Aktionen der Miristas doch Wirkung in der Bevölkerung – immer mehr Campesinos drängten auf Veränderungen –, sodass der christdemokratische Interessenausgleich durch die Landreform schließlich als gescheitert angesehen werden musste: „Zwischen 1968 und 1970 nimmt die Zahl der Landarbeiterstreiks um ein zehnfaches zu, auf ganze 1.580 Arbeitsniederlegungen. Die Besetzung von Äckern vervierfacht sich im selben Zeitraum auf fast 2.000. Unter den angeeigneten Flächen befinden sich auch Ländereien im Süden des Landes, die den Mapuche-Indigenas seit dem 19. Jahrhundert von Siedlern europäischer Abstammung gewaltsam geraubt worden“, berichtet Allendes Internationale in diesem Zusammenhang.
So eröffnen sich auch für Salvador Allende neue Chancen bei der nun, 1970, anstehenden Präsidentenwahl – es ist sein vierter Anlauf. Dafür nominiert wurde er von der ein Jahr zuvor gegründeten Unidad Popular (UP), Volkspartei, einem neuerlichen Bündnis der verschiedenen chilenischen Linksparteien. Und tatsächlich: Als deren Kandidat kann Allende zwar nur 36,3 Prozent – und damit weniger als bei der Wahl sechs Jahre zuvor – erringen, das aber reicht, um sich gegen den konservativen Kandidaten durchzusetzen.
Als klar ist, dass der Sozialist Salvador Allende der neue Präsident wird, ist das im konservativen Lager ein Schock und es bricht Panik aus: Am Tag nach der Wahl bilden sich vor den Banken Santiago de Chiles Schlangen – wer Vermögend ist, möchte sein Geld ins Ausland bringen. Die Zahl der Anträge auf Reisepässe schnellt in den folgenden Tagen von 80 auf 500 pro Tag in die Höhe. Der Abfluss von Geld und die Ausreisewelle schlagen auf die Volkswirtschaft durch – schon bald herrscht überall Mangel, der durch Sanktionen der USA noch verstärkt wird.
Salvador Allende war erfüllt von der Vorstellung von Gleichheit, von einer solidarischen und gerechten Gesellschaft. Als er schließlich zum Präsidenten gewählt wurde, bedeutete das den erstmaligen Einzug des Sozialismus in demokratische Institutionen. Sein Ziel jedenfalls war eine sozialistische Revolution auf dem Boden der bestehenden demokratischen Verfassung Chiles: Sofort begann er, wie angekündigt, mit der Durchführung von Sozialreformen und auch der Verstaatlichungen wichtiger Wirtschaftsbereiche, allen voran der Kupferförderung, die sich überwiegend im Besitz nordamerikanischer Unternehmen befand.
Für Allende ist klar, „daß unser Feind Nummer Eins der Imperialismus ist, und deswegen gestehen wir, und das machen wir auch im Augenblick, der nationalen Befreiung die erste Priorität zu“. Man müsse verhindern, dass das „fremde Kapital weiterhin die wichtigsten Reichtümer kontrolliert“, weshalb er noch 1970 den Entwurf einer Verfassungsreform unterzeichnet, die Voraussetzung für die Nationalisierung des Kupfers – der Bodenschätze insgesamt – ist. Vorgesehen ist, dass sowohl Lagervorkommen als auch die Minen verstaatlicht werden. Kupfer macht Chiles größten Reichtum aus, das Land verfügt über enorme Vorkommen, hat aber weder beim Abbau, noch beim Verkauf, noch beim Preis etwas zu sagen. Hinzu kommt, dass die ausländischen Bergbaufirmen zwar Steuern zahlen, deren Höhe sich aber nach von den Unternehmen selbst gemachten Angaben zur Produktion richtet. Die Verluste beim Kupfer beziffert Allende auf 3,7 Milliarden Dollar seit dem Jahr 1930. Eisen- und Salpeterabbau sowie andere Industrien hinzugerechnet, steigt die Summe auf 9,6 Milliarden Dollar, die im chilenischen Etat fehlen. Deshalb kommt es nun zur Grundgesetzänderung für die Nationalisierung der Kupferminen. Den Minenarbeitern erklärt er: „Ich erinnere euch daran, dass das Kupfer Chile Reichtum schenkt, so wie sein Boden uns ernährt. Die Zukunft des Landes, der Reichtum Chiles, liegt in euren Händen.“
Allende geht es dabei nicht allein darum, den nordamerikanischen Imperialismus zu beenden, sondern auch um etwas, das man mit Frantz Fanon als „Dekolonialisierung des Denkens“ der Arbeiter bezeichnen kann. Im Gespräch mit Debray jedenfalls sagt Allende: „Das Leben der Kupferarbeiter ist hart, ein hoher Prozentsatz wird Opfer von Berufskrankheiten, wie der Silikose, aber diese Wirklichkeit wird mit hohen Löhnen, die die ausländischen Unternehmen, die das chilenische Kupfer ausbeuten, ihnen zu zahlen in der Lage sind, weil dieser Bodenschatz den Investoren große Gewinne bringt, abgegolten. Jahrelang haben die nordamerikanischen Unternehmen ihnen gesagt, daß am Tage, an dem sie aus Chile verschwänden, ihre Situation sich verschlechtern werde … Wir verfügen kaum über Mittel der Kommunikation, um diesen Geisteszustand zu zerstören, den die herrschende Klasse einer großen Bevölkerungsmasse aufgezwungen hat, die sehr isoliert lebt. (…) Wir müssen kämpfen, um diesen Arbietern zu Bewußtsein zu verhelfen; es genügt nicht, daß die Arbeiter gewerkschaftlich organisiert sind, es ist notwendig, daß ihre Organisation von revolutionärer Ideologie durchdrungen ist. (…) Wir kämpfen auch dafür, daß das Volk sich organisiert.“
Auf die Enteignungen und Verstaatlichungen in der Kupferindustrie reagieren die USA unmittelbar, indem sie die Devisen einfroren und den Export von Kupfer boykottierten. Durch diese und weitere Interventionen Washingtons gerät die chilenische Wirtschaft schnell in Schwierigkeiten: Der Übergang privater Großbetriebe in die Hand des Staates führt verschiedenen Orts zu Produktionsrückgängen, was wiederum zur Inflation führt.
Zwar wurden die Löhne der Arbeiter und Arbeiterinnen um 66 Prozent erhöht, aber es machen sich bald erste Versorgungsschwierigkeiten bemerkbar. Chile hat immer Grundnahrungsmittel importieren müssen, jährlich für etwa 200 Millionen Dollar, obwohl es eigentlich genügend Boden gibt und die Landwirtschaft vom Klima begünstigt ist. Nun hat die höhere Kaufkraft der Arbeiter einen Sturm auf die Lebensmittelgeschäfte ausgelöst und das Angebot wird knapp. Außerdem frisst die Inflation die Kaufkraft der Arbeiter*innen langsam auf.
Auch deshalb wird mit Hochdruck an einer Reform der Landwirtschaft gearbeitet, das heißt die von der Vorgängerregierung eingeleitete Agrarreform wird schnellstmöglich umgesetzt. Im Gespräch mit Debray erläutert Allende diesbezüglich: „Den Ausdruck `feudale Sektoren´ benutzen wir normalerweise, um das zu bezeichnen, was wir genauer als rückständige Formen des `chilenischen Agrarkapitalismus´ charakterisieren müßten. Diese Rückständigkeit bezieht sich auf die Tatsache, daß die angeführten kapitalistischen Verhältnisse immer noch Eigenheiten ehemaliger Dienstbarkeit widerspiegeln, die ständig an Bedeutung verliert; eine große Konzentration des Landbesitzes, die sich zum größten Teil aus der Eigentumsstruktur des vergangenen Jahrhunderts herleiten läßt.“
Bei der von ihm avisierten sozialistischen Bodenreform geht es nun nicht darum, „den Kapitalismus auf dem Lande zu entwickeln, sondern den Agrarbereich auf dem Charakter unserer historischen und sozialen Entwicklung entsprechendsten Wege auf den Marsch zu setzen. Es ist einsichtig, daß diese Formen in einzelnen Fällen die fortschrittlichsten sein werden, etwa Eigentum der gesamten Dorfbevölkerung; in anderen unterschiedliche Kooperativmodelle; und schließlich wird man auch das Weiterbestehen von Sektoren kleinen Privatbesitzes ins Auge fassen müssen.“
Landlose Bauern und Indigene sollen als erste von Enteignungen profitieren: Allende reagiert so kurz nach seinem Amtsantritt schnell auf die Proteste und Vorschläge der Mapuche und bringt ein neues Indigenen-Gesetz auf den Weg. Zudem ordnet er die beschleunigte Enteignung von indigenem Land an. Mehr als 1.000 landwirtschaftliche Betriebe werden zerschlagen und neu verteilt. Allein von Dezember 1970 bis März 1971 werden so 150.000 Hektar rückübertragen. Ein halbes Jahr nach dem Amtsantritt Allendes hat die Regierung bereits 750.000 Hektar Land für die Agrarreform enteignet.
Das Gesetz weiß Allende bei diesen Enteignungen auf seiner Seite – er profitiert hier von einer Regelung, die einst die Siedler schützen sollte: Das traditionelle chilenische Gesetz bestraft nicht denjenigen, der Land besetzt, sondern den, der es sich zurückholen will. Es wurde einst zum Schutz derer formuliert, die den Mapuche-Indianern den Boden genommen haben, und sollte die ursprünglichen Besitzer daran hindern, sich das Gestohlene zurückzuholen. Jetzt wendet sich dieses Gesetz gegen die Erben der einstigen Landräuber – die Großgrundbesitzer werden nur ihrerseits enteignet. Allende bemerkt in diesem Zusammenhang: „Es gibt ein Gesetz, und dieses Gesetz wird uns unbestreitbar dazu verhelfen, den Großgrundbesitz zu enteignen, alle Güter, die das vom Gesetz bestimmte Minimum überschreiten, das heißt also 80 Hektar bewässertes Land in der Zentralregion. Aber es zeigt sich, daß wir daran interessiert sind, die Reform Zone für Zone voranzutreiben, um für diese Zeit die Produktion aufrechtzuerhalten, die Chile braucht, wenn man Klima, Gegend und Boden berücksichtigt. Wenn das auf anarchistische Weise vor sich geht, besteht keine Möglichkeit, die Produktion zu planen.“
Gegen Allendes Pläne regt sich der Widerstand der bisherigen Besitzer: Zu den ohnehin schon herrschenden wirtschaftlichen Schwierigkeiten kommen nun noch Sabotageschäden, indem die Latifundisten große Teile ihrer Ländereien brach liegen lassen, wodurch die landwirtschaftliche Produktion massiv zurückgeht. Hinzu kommt, dass auch die Beschlagnahmungen und Übergaben der Flächen nicht konfliktfrei verlaufen: Es kommt zu Sabotageschäden, manchmal werden mutwillig Bewässerungsanlagen oder Produktionsmittel zerstört, ein anderes mal waren es die Campesinos, die sich das Land gewaltsam holten, wobei es sogar Tote gab.
Zu den gewaltigen politischen Spannungen kamen bürokratische Probleme. Die Landverteilung verbesserte vielleicht die soziale Lage der bislang benachteiligten Bevölkerungsschichten, aber sie ist nicht automatisch mit einer Produktionssteigerung verbunden, im Gegenteil: Oftmals können die Latifundisten einen Teil ihres Landes behalten, wobei sie dann natürlich die fruchtbarsten Flächen wählen und dort alle mobilen Gerätschaften und Maschinen zusammentragen, um sie vor der Verstaatlichung zu schützen. Auch deshalb kann die Agrarreform ihre angestrebtes Ziel einer Produktionssteigerung nicht erfüllen – ohne Maschinen wirft die Landwirtschaft kaum Erträge ab. Letztlich bremsen auch hier fehlende Investitionen das Wirtschaftswachstum aus.
Auch einfach neue Traktoren im Ausland zu kaufen, entpuppt sich als wenig hilfreich. Zwar gelingt es, ein von Präsident Richard M. Nixon verhängtes Exportverbot von landwirtschaftlichen Maschinen nach Chile zu unterlaufen, indem man 10.000 rumänische Traktoren bestellt, doch sind die meisten Campesinos mit dem Einsatz des unbekannten Gefährts nicht vertraut. Allendes Internationale zitiert in diesem Zusammenhang einen Bauern: „Sie kamen, um den Traktor abzuholen, und als sie auf ihrem Feld ankamen, blieb er stehen. Die Treckerfahrer wussten wohl nicht, wie sie ihn Instand halten mussten und hatten vergessen genug Öl nachzufüllen.“
Ungleich schwieriger als solche technischen Probleme zu beheben ist es aber, die Campesinos zu einer kollektiven Produktionsweise zu gewinnen – auch hier zitiert Allendes Internationale einen Landarbeiter: „Das Problem in einem kollektiven Unternehmen ist, dass viele Menschen dort nicht unbedingt fanatisch der Arbeit nachgehen, ganz im Gegenteil. Wie bringt man also Menschen dazu, zu arbeiten? Mit ideologischen Argumenten funktioniert das nicht. Am besten lief es dort, wo unter den neu angesiedelten Bauern auch ein früherer Vorarbeiter lebte. Dann war es sehr einfach, der Vorarbeiter legte z.B. fest, 600 Meter Salat pro Stunde zu jäten. Das war eine klare Ansage, die alle verstanden.“
Solche Probleme überstrahlt auch ein prominenter Besucher zum ersten Jahrestag der Regierung nicht wirklich: 1971 kommt Fidel Castro nach Chile, der Held der kubanischen Revolution von 1961, und betritt damit zum ersten Mal südamerikanischen Boden. Anders als Allende verdankt Castro seine Macht einem gewaltsamen Umsturz – und gerade deshalb ist er für die konservative chilenische Opposition ein Tabu. Erst recht, als Castro die Chilenen und Chileninnen dazu auffordert, ihre sozialistischen Errungenschaften gegebenenfalls auch mit Waffen zu verteidigen. Das ist eine Provokation zu viel für die rechten Parteien, sie sprechen sogar – ganz im Sinne der Propaganda der CIA – von einer drohenden „Sowjetisierung“ des Landes. Allende hat damit das ganze bis dahin womöglich noch vorhandene Vertrauen der politischen Mitte des Landes verloren. Sie schließen sich nun der Opposition an, womit der politische und soziale Zusammenhalt des Landes vollends zerfällt.
Im Parlament hat die Vertiefung der Agrarreform viele politische Gegner, auch in Reihen der Christdemokraten. Sie sind fortan in der Opposition aktiv, die Allende von nun an in seiner Arbeit systematisch behindert, indem sämtliche Initiativen im Kongress durch eine einfache Mehrheit der Opposition blockiert werden und neue sozialistische Minister ständig abgewählt werden. Außerdem leitet der Kongress als Antwort auf die Enteignungen eine Verwaltungsreform ein, die praktisch alle bis dahin ausgesprochenen Verstaatlichungen für ungültig erklärt. So entzieht die Opposition Allende Kompetenzen, die seinen Vorgängern zukamen. Für die Regierung ist das eine Anmaßung des Kongresses, es zeigt aber auch, wie gespalten das Land ist – und wie unversöhnlich bald auch die Atmosphäre.
Der Riss vertieft sich, als Regierungskritiker paramilitärische Verbindungen wie „Patria y Libertad“ („Vaterland und Freiheit“) bilden, die den Widerstand gegen Allendes Politik nun auch auf die Straße tragen. Es kommt zu ersten Anschläge von paramilitärischen Gruppen, um Produktion und Versorgung zu sabotieren. So zerstören Unbekannte bei einem Brandanschlag im November 1971 Tausende Tonnen Lebensmittel, die für den Einzelhandel in Valparaiso bestimmt waren.
Die faschistische Gruppe „Vaterland und Freiheit“ ist nur eine winzige Gruppe innerhalb der Rechten, eine „Kampfschwadron“, die finanziert wird von den großen Arbeitgeberverbänden des Landes, darunter die Nationale Gesellschaft für Landwirtschaft, die von der Rechten kontrolliert wird (und auch vom State Departement in Washington). Der institutionelle Konflikt, die Fundamentalopposition im Kongress, allein reicht nicht, um einen Staatsstreich zu provozieren – es braucht auch Gewalt auf der Straße und soziales Chaos. Finanziell und ideologisch unterstützt von der CIA, die verhindern will, dass Chile den Weg Kubas einschlägt, beeinflussen die Faschisten bestimmte Kreise in der Rechten und den Streitkräften immer stärker. Edward Korry, der damalige Botschafter der USA in Chile spricht in der Dokumentation „Salvador Allende“ (2004) von Patricio Guzmán von insgesamt 2,7 Millionen Dollar, die allein schon in die Wahlen von 1964 geflossen sind. „Dazu kamen noch viele Millionen, die auf Anregung der USA von Leuten in Europa“ gespendet wurden, unter anderem auch „von den deutschen Christdemokraten“. Das Geld diente Korry zufolge „einer riesigen Propaganda-Kampagne … aber auch zur Warnung vor der kommunistischen Gefahr, die Allende darstellte. (…) Das Ziel war die Schaffung eines Pfeilers der demokratischen Stabilität als Gegengewicht zu dem von Castro verfochtenen Sozialismus, Marxismus und Leninismus.“
1972 steigt der Druck auf Allende enorm, weil ihm nun auch die extreme Linke die Unterstützung entzieht: Das Ideal des Pazifismus gilt für sie nicht mehr – ihre Aktivisten rufen zum bewaffneten Kampf auf. Nun radikalisiert sich auch die rechtsextreme „Patria y Libertad“. Der Revolution folgt nun die Konterrevolution, schon bald eskaliert die Spirale der Gewalt. Chile steht am Rande eines Bürgerkriegs.
Streiks der Lastwagenfahrer versetzen Allende und den Sozialisten dann praktisch den Todesstoß: Im Herbst 1972 rufen vom US-Geheimdienst CIA finanzierte Arbeitgeberverbände zur unbefristeten Arbeitsniederlegung auf. Auf betreiben des Verbands der Spediteure bleiben 70.000 LKWs und Tausende von Autobussen stehen. Chile kommt praktisch komplett zum Stillstand: Rohstoffe gelangten nicht mehr in die Fabriken, Benzin und Nahrungsmittel wurden in der Folge knapp. Die Versorgungslage ist desaströs, als die Sozialisten beginnen, die Lebensmittelverteilung über 3.000 Verteilungszentren zu organisieren, was mehr schlecht als recht gelingt. Wie dramatisch die Lage ist berichtet das Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“ im Oktober 1972 in dem Artikel „Wer fragt schon, ob es genug zu essen gibt?“.
Nichtsdestotrotz konnte sich die konservative Opposition aus Christdemokraten und Nationalpartei bei den Parlamentswahlen im März 1973 nicht gegen die Sozialisten durchsetzen. Das Scheitern aber verdeutlichte ihr und auch der CIA, dass man mit den Mitteln der repräsentativen Demokratie das angestrebte Ziel nie erreichen wird. Denn trotz Milliarden von Dollar aus den USA haben die Sozialisten ihren Stimmenanteil auf über 43 Prozent vergrößern können. Das zeigt, dass der Wunsch nach sozialer Veränderung da ist – die Opposition kommt zu dem Schluss, dass es keinen Ausweg gab, der mit der Verfassung vereinbar war. So wurde der Ruf langsam laut, das Militär sollte den Präsidenten durch einen Staatsstreich absetzen. Um Allendes Politik zu verhindern, dachte man seitens der CIA von Anfang an auch an einen Putsch, erklärt der damalige Botschafter der USA in Guzmáns bereits erwähnter Dokumtation „Salvador Allende“ und erklärt: „Sie wollten mich sogar dazu bringen, mich auf die chilenische Armee zu stützen unmittelbar nach Allendes Wahl. Drei der höchsten Generäle kamen mit unserem Militärattaché Goldman zusammen und fragten, was die USA von ihnen erwarteten. Sie baten um Unterstützung für einen Coup.“
Schon 1970, noch bevor Allendes Präsidentschaft im Kongress offiziell erklärt wurde, ermordete die CIA mit Hilfe einiger chilenischer Offiziere den damaligen Oberbefehlshaber der Armee, General René Schneider, der gegen jegliche Einmischung der Armee in die Politik war. General Schneider war Allendes Hauptstütze in der Armee – sein Tod bedeute für Allende, dass er fortan praktisch keinen Einfluß mehr auf die Armee hatte. Nicht zuletzt auch deshalb holt Allende 1972 angesichts der wachsenden wirtschaftlichen Probleme drei Vertreter des Militärs in seine demokratische Regierung und ernennt General Prats zum neuen Innenminister, um die Ordnung wieder herzustellen. In der Arbeiterschaft warf man ihm daraufhin vor, sich stärker auf die Generäle zu stützen, als auf die Arbeiter und Arbeiterinnen. Man war ihm fehlendes Vertrauen in die „Macht des Volkes“ vor. Aber nach den gewonnen Parlamentswahlen war es ohnehin zu spät – die Entscheidung zum Putsch war bereits gefallen.
So kommt es schließlich zum Militärputsch, dem die unbewaffnete Bevölkerung letztlich machtlos gegenüber steht: Um 7.50 Uhr am 11. September 1973, dem Tag des Coups, melden sich die Generäle zum ersten Mal öffentlich und lassen über den Radiosender Agricultura – dem Sender der von den Rechten und dem CIA finanzierten und kontrollierten Nationalen Gesellschaft für Landwirtschaft – eine Erklärung verlesen, in der sie der chilenischen Landbevölkerung erklären, dass ein Putsch die Regierung der Sozialisten gestürzt und das Militär das Land besetzt hat. Allende sitzt zu der Zeit handlungsunfähig und zur Ohnmacht verdammt im Präsidentenpalast, der Moneda, als General Augusto Pinochet der Luftwaffe den Befehl gibt, den Palast zu bombardieren. Als die Lage aussichtslos wird, nimmt sich Allende in seinem Amtssitz mit einem Kopfschuss das Leben. Binnen weniger Stunden wird die chilenische Demokratie ausgelöscht.
Nun beginnt der Terror: Eine Militärjunta unter der Führung von General Pinochet ergreift die Macht und errichtet eine Militärdiktatur. Sie setzt die Verfassung außer Kraft und löst den Kongress auf, verbietet Parteien und Gewerkschaften – die Maxime des Landes wird brutal wie nie zuvor durchgesetzt. Eine Hexenjagd beginnt: Gezielt greifen die neuen Machthaber politisch aktive Campesinos und Funktionäre der Agrarreform an. Tausende Menschen wurden festgenommen, Folter, Terror und Tod folgen (später geht man von mindestens 30.000 Folteropfern aus). Viele gehen ins Exil, sind aber auch dort nicht sicher. Man will den Marxismus ausmerzen – lässt aber offen, ob und wann man zur Demokratie zurückkehrt: Anders als von den Feinden Allendes gedacht, geben die Militärs die Macht nach dem Putsch nicht an die klassischen politischen Eliten zurück, stattdessen lässt sich Pinochet im Dezember 1973 selbst zum Präsidenten ausrufen.
Die Militärjunta verbreitet Angst und Schrecken, wirtschaftlich aber ist sie weit weniger erfolgreich: 1974 liegt die Inflation bei fast 700 Prozent und es wird deutlich, dass die Verantwortlichen im Wirtschaftsministerium die vielen Probleme nicht lösen können. Daher sollen die Anhänger einer neuen Doktrin den Ausweg aus der Sackgasse aufzeigen: 1975 kommt der Ökonom Milton Friedman aus Chicago zu Besuch nach Chile – und mit ihm der Neoliberalismus (für den Friedman 1976 sogar den Nobelpreis bekommt). Neoliberalismus – das ist, wie Colin Crouch ausführt, die Überzeugung, dass ein freier, unregulierter „Markt, der individuelles Profitstreben ermöglicht, das beste Mittel zur Befriedung unserer Bedürfnisse sei. Dieser Markt sei von Eingriffen insbesondere des Staats und der Politik freizuhalten“. Politik und Wirtschaft sollten hier voneinander getrennt sein, das ist ein Grundprinzip liberaler und neoliberaler Theorien.
Nach dem Zweiten Weltkrieg bildete John Maynard Keynes (1883-1946) dreißig Jahre lang sozusagen die orthodoxe Wirtschaftstheorie der kapitalistischen Staaten, wonach sich in Zeiten geringer Nachfrage und mangelnder Wachstumszuversicht der Staat verschulden solle, um die Wirtschaft mit staatlichen Aufträgen anzukurbeln. „Statt in den Krieg“, so Crouch, „wurden die Mittel nunmehr in den Ausbau der neuen, stetig wachsenden Sozialsysteme gesteckt. Das keynesianische Modell schützte die Bürger vor den Unwägbarkeiten volatiler Märkte …“
Die Verhinderung von Arbeitslosigkeit war ein zentrales Ziel der keynesianischer Wirtschaftspolitik der Nachkriegszeit gewesen – sie hatte allerdings eine Achillesferse, stellt Crouch fest: „die Gefahr, daß das Eingreifen des Staates eine Inflation heraufbeschwor.“ Das oberste Credo des Neoliberalimus lautet nun, dass „optimale Ergebnisse immer dann erzielt werden, wenn sich Angebot und Nachfrage auf dem Markt für Waren und Dienstleistungen durch den Mechanismus der Preisbildung selbst regulieren, ohne staatliche oder sonstige Eingriffe (…) Die Vertreter des Neoliberalismus argumentieren …, daß der Versuch, dies durch direkte Eingriffe in den Markt zu bewirken, mittelfristig scheitern müsse, da er auf einer künstlichen Anregung der Nachfrage beruhe, die zu einer Inflation führen werde.“
Die neoliberale Kritik am Keynesianismus umfasst „sämtliche Bestrebungen von Wirtschaftspolitikern oder Gewerkschaften, Vorgaben für die Arbeitszeit, Arbeitsbedingungen oder die betriebliche Altersversorgung festzuschreiben. Solange solche Regelungen nicht aus dem Wettbewerb selbst hervorgingen, so das Argument, würden die daraus resultierenden Kosten die Preise hochtreiben (..) Der Neoliberalismus befürwortet daher eine vollständige Privatisierung bzw. Ausrichtung dieser Dienste an Marktmechanismen.“
Neoliberalismus steht insofern für ein umfassendes Spektrum wirtschaftspolitischer Ideen – die bislang allerdings noch nie in Reinform umgesetzt wurde. Chile, das inzwischen kein demokratisches Land mehr war, sollte davon nun die Ausnahme bilden. Was das bedeutete, sah Allende schon Ende 1972 in einer Rede vor der Generalversammlung der Vereinten Nationen voraus, wo er die unheilvolle Rolle mulinationaler Unternehmen, denen Pinochet nun die Türen öffnete, und den mit ihrem Einlass verbundenen staatlichen Kontrollverlust anprangert: „Wir stehen vor einem wahren Konflikt zwischen den Multinationalen und den Staaten. Es kommt zu Einmischungen in grundlegende staatspolitische, wirtschaftliche und militärische Entscheide durch globale Unternehmen, die keinem Staat unterstehen und die insgesamt für ihre Tätigkeit keinem Parlament Rechenschaft ablegen. Sie unterstehen keiner Instanz, welche das Gemeinwohl vertritt. Kurzum: die gesamt politische Struktur der Welt wird untergraben. Die grossen transnationalen Unternehmen schaden nicht nur den Interessen der Entwicklungsländer. Durch Unterjochung und mangelnde Kontrolle richten sie auch in den Industrieländern Schaden an, wo sie sich niederlassen.“
In Chile werden die Prinzipien der Liberalisierung der Wirtschaft, ihre marktwirtschaftliche Umgestaltung, und das Ende sämtlicher staatlichen Leistungen und Güter erstmals radikal umgesetzt, das heißt massive Privatisierungen, Abschaffung der Preiskontrollen und Senkung der Einfuhrzölle.
Weil nun auch der Kapitalmarkt dereguliert wird und Schutzzölle abgeschafft, wird Chile wieder zu einem Exporteur preiswerter Rohstoffe für den Weltmarkt. Fast 500 Banken und die meisten der unter Allende verstaatlichten Unternehmen werden an private Investoren veräußert. Die Folge war deshalb zunächst tatsächlich ein Wirtschaftswachstum von fünf Prozent zu Beginn der 1980er Jahre – allerdings um den Preis, das Chiles Wirtschaftswunder von krassen sozialen Gegensätzen geprägt war: Gesundheitswesen, Bildung, Gas-, Wasser- und Stromversorgung sowie Altersvorsorge, das Rentensystem, Nahverkehr et cetera – praktisch alles wurde nun privatisiert, soziale Subventionen für Bedürftige sind gestrichen und Grundbedürfnisse zur Ware geworden. Das Ideal des auf ein Minimum reduzierten Staates wird eingeführt, das heißt der Staat greift nur da ein, wo der private Sektor es nicht tun kann oder will. Für alles muss fortan bezahlt werden – und allein Angebot und Nachfrage bestimmen den Preis dafür.
All diese Maßnahmen helfen also der Wirtschaft – und hier insbesondere den großen Konzernen –, aber nicht den Menschen. Einige wenige profitieren zwar davon, die Zahl der Menschen die verarmten, war aber gewaltig. Letztlich steuert das Land gnadenlos in die Rezession und viele landen im Elend: Im Sommer 1976 ist ein Viertel der Bevölkerung ohne festes Einkommen. Die Einführung des Freihandels zieht eine Flut von Insolvenzen und hunderttausende Arbeitslose nach sich. Ein staatliche Beschäftigungsprogramm für 800.000 Arbeitslose wird ins Leben gerufen, wo sie sich zumindest als Billiglöhner verdingen können.
Im Zuge der Einführung des neoliberalen Modells werden alle Reformen Allendes gestoppt, zuvorderst die Bodenreform. Bis Mitte 1973 hatten die regierenden Sozialisten 6,6 Millionen Hektar Land enteignet – der Grußgrundbesitz war in Chile nahezu Geschichte. Aber der größte Teil davon wurde im letzten Jahr von Allendes Regierung enteignet, die Neuorganisation war noch nicht abgeschlossen, weshalb es nun kein Problem ist, den Prozess rückgängig zu machen – und eine Gegenagrarreform zu initiieren.
Ein Drittel der verstaatlichten Flächen wird in der Folge an die alten Latifundistas rückübertragen, ein anderes Drittel der Flächen tatsächlich unter einigen Campesino-Familien aufgeteilt, um sich deren stille Unterstützung zu erkaufen, während die Indios leer ausgingen. Im Gegenteil, wurde den Mapuche die von den Sozialisten zugesprochenen Ländereien doch entschädigungslos und unter Einsatz von Gewalt fast vollständig wieder entrissen. Das letzte Drittel allerdings wurde an Investoren verkauft – der Grundstein Chiles heutiger exportorientierter Monokulturen auch im Weinbau.
Tatsächlich erholte sich der Weinbau unter der Diktatur Pinochets von seinem Niedergang seit den 1930er Jahren. Zuerst setzte er das auch von Allende unterstützte Prohibitionsgesetz von 1939 außer Kraft, das die Überproduktion von Wein aufgrund des weit verbreiteten Alkoholismusproblems in der chilenischen Gesellschaft verbot. Die Landrückgabe an die Latifundistas führte dazu, dass die Weinbaufläche, die bis auf 50.000 Hektar geschrumpft war, rasch wieder anwuchs. Mit Hilfe von ausländischen Investoren – der Katalane Miguel Torres war 1979 der erste – gelang es, neue Weinberge anzulegen und moderne Kellertechnik zu installieren. Torres führte neue Technologien in die Weinherstellung ein, beispielsweise Edelstahltanks, die eine Temperaturkontrolle während der Gärung erlauben, sodass es fortan auch in warmen Anbaugebieten möglich war, frisch-fruchtige Weine zu erzeugen. Torres baute seine Weine aber auch als erster in französischen Eichenfässern aus.
Nicht zuletzt durch sein Engagement hat der Weinbau in Chile seit den 1980er Jahren eine enorme Entwicklung genommen: Auf 130.000 Hektar stehen heute Rebstöcke zur Herstellung von Wein, über zwölf Millionen Hektoliter Wein werden jedes Jahr produziert. Dass ein Großteil davon, nämlich etwa 70 Prozent, exportiert werden, liegt auch daran, dass Pinochet damals zahlreiche Handelsabkommen unterzeichnete, die das rasante Wachstum der chilenische Weinindustrie beschleunigten, angefangen bei seinem Vorzeigebetrieb Concha y Torro. Dem Weingut gelang es schon durch juristische Tricks, von der Enteignung unter Allende verschont zu bleiben – nun profitiert es von der Freihandelspolitik unter Pinochet. Claudio Gajardo, Guide des Weinguts, erklärt: „Als wir die chilenische Regierung auszuschalten begannen, um uns der Welt mittels Freihandelsabkommen zu öffnen, ging es meist auch um unseren Wein. Das Unternehmen `Concha y Torro´ hat am meisten von diesen Handelsabkommen, vor allem von denen mit Europa, profitiert. 1976 ging der erste Export von `Concha y Torro´ nach Holland, mit unserem Wein `El Casillero Del Diablo´.“
Wie hier im Fall von Concha y Torro führte der Neoliberalismus unter Pinochet in den 1980er Jahren zur Industrialisierung der Weinproduktion und dazu, dass der Weinexport innerhalb von nur 12 Jahren von einem Wert von etwa 10 Millionen Dollar auf 550 Millionen Dollar anstieg, sodass Chile heute sogar der viertgrößte Weinexporteur der Welt ist, noch vor Australien. Zahlreiche international bekannte Weingüter investierten in die chilenische Weinindustrie und gaben auch den einheimischen Produzenten wie Montes oder Cono Sur, wichtige Impulse, die inzwischen selbst zu global operierenden Weingütern geworden sind.
Diese Erfolge aber sind teuer erkauft, denn der Neoliberalismus kennt keine Moral – und auch Pinochets Diktatur nicht. Im September 1976 explodiert in der Nähe des Weißen Hauses in Washington eine Autobombe: Es trifft den ehemaligen sozialistischen Minister Orlando Letelier, der das Attentat des chilenischen Geheimdienstes nicht überlebt. Dass der chilenische Geheimdienst seine Gegner sogar im Ausland tötet, das löst Empörung in den USA aus, die nun mit Sanktionen drohen. Auch die Vereinten Nationen werfen Chile systematische Menschenrechtsverletzungen vor. Chile gerät so ins Abseits und droht von der internationalen Gemeinschaft zunehmend isoliert zu werden, wenn es nicht zur Demokratie zurückkehrt.
Pinochet aber läßt sich von den internationalen Protesten nicht beeindrucken und verabschiedet 1978 sogar ein Amnestiegesetz, dass Militär und Polizei von allen Verbrechen seit dem Putsch freispricht. Erst 1980 verspricht er die Rückkehr zur Demokratie. Grundlage dafür aber ist eine eigens auf ihn zugeschnittene Verfassung, die sich der Diktator in einem Pseudoreferendum bestätigen lässt. Sie sichert Pinochet („Wir haben der Welt bewiesen, wie demokratisch dieses Land ist“) die Macht und erhebt den Neoliberalismus darüber hinaus zur Staatsdoktrin.
Dann aber schlägt die Rezession, in die Chile in den 1980er Jahren rutschte, langsam aber sicher in die Gesellschaft durch – und die Krise entwickelt sich zum Ausnahmezustand: Trotz der unverminderten Repression formiert sich Widerstand in der Bevölkerung und führt tatsächlich zum Aufstand, den das Militär aber brutal niederschlägt. Trotzdem genehmigt Pinochet nun unter Druck die Rückkehr der demokratischen Parteien, mit Ausnahme der Kommunisten. Linke und rechte Parteien schließen sich nun im Kampf gegen die Diktatur zusammen und kämpfen gemeinsam für die Rückkehr zur Demokratie („conertación de partidos po la Democracia“).
1988 initiiert Pinochet schließlich sogar ein Referendum, mit dem er sich weitere acht Jahre an der Macht sichern will – das aber tatsächlich von der Opposition gewonnen wird, die sich gemeinsam dagegen entschieden haben. Auf der Straße feiern die Menschen: „la guerra termina“, „der Krieg ist vorbei“. Zwar macht sich auch Angst vor dem Eingreifen des Militärs breit, aber das Regime bestätigt die Wahl. Es ist der Anfang vom Ende der Diktatur.
Die Allmacht des Militärs schränkt den Handlungsspielraum der Sieger ein. Ein Pakt mit dem Regime soll den Überang zur Demokratie und zu freien Wahlen ebnen, das heißt die Verfasssung von 1980 wurde bestätigt (und damit Pinochet als Oberbefehlshaber des Militärs). Die demokratischen Parteien mussten sich verpflichten, die Regeln der Diktatur zu akzeptieren und das bedeutete auch Straffreiheit, Impunidad, für das Militär.
Unter diesen Voraussetzungen kommt es 1990 nach 17 Jahren Diktatur zur ersten Präsidentschaftswahl, die der Christdemokrat Patricio Aylwin gewinnt. Pinochet gibt zwar sein Amt ab, bleibt aber eine Gefahr als Oberbefehlshaber – die junge Demokratie muss pragmatisch sein. Und so ruft Aylwin das Land zur Versöhnung auf. Er setzt eine Versöhnungs- und Wahrheitskommission ein, die sogenannte Valech-Kommission, die die Menschenrechtsverletzungen aufklären soll: Obwohl es mit Sicherheit wesentlich mehr waren, werden dem Regime immerhin 2.300 Morde angelastet – es ist ein Anfang. Dafür entschuldigt sich Aylwin im Namen des Staates, eine Strafverfolgung aber gibt es nicht. Stattdessen werden die Verbrechen bis heute kollektiv verdrängt.
Dann wird Pinochet 1998 in London verhaftet, wo er sich für eine medizinische Behandlung aufhält. Die Verhaftung führt in Chile zu Empörung, selbst in der Mitte der Gesellschaft. Spanien stellt einen Auslieferungsantrag, weil während seiner Diktatur auch spanische Staatsbürger ums Leben kamen, die britische Premierministerin Margeret Thatcher aber setzt sich gegen die Auslieferung ein. Schließlich kehrt Pinochet nach 17 Monaten nach Chile zurück – und erhält Immunität vom Kongress.
Nach dem Ende der Diktatur führten ab 1990 zunächst die Christdemokraten, später die Sozialdemokraten das Land. Nach und nach etabliert sich in Chile eine stabile Demokratie, auf die das Land stolz ist, ohne dass jedoch das wirtschaftliche Erbe der Ära Pinochet angerührt worden wäre. So wächst die Wirtschaft bis zur Jahrtausendwende zwar, doch nach wie vor gilt das aus der Diktatur übernommene und in der Verfassung von 1980 festgeschriebene neoliberale Wirtschaftsmodell – an der Privatisierung öffentlicher Probleme wird nach wie vor festgehalten. Und so sind trotz prosperierender Wirtschaft ein Erbe der Diktatur auch fünf Millionen Menschen, die in Armut leben (bei einer Gesamtbevölkerung von 13 Millionen im Jahr 2002).
Laut Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) ist Chile das Land mit der drittgrößten sozialen Ungleichheit (hinter Südafrika und Costa Rica): auf ein Prozent der Bevölkerung fallen 26,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Die Gesellschaft ist auch nach dem Ende der Diktatur tief gespalten – und von dieser Kluft erzählen auch nach wie vor die Landwirtschaft und der Weinbau. Doch mit der neuen demokratischen Regierung kommen auch frühere politische Exilanten wieder zurück nach Chile – und mit ihnen eine neue Weinkultur. In Pirque im Valle Central südlich von Santiago de Chile, wo der moderne Weinbau mit Concha y Torro seinen Anfang nahm und sich die größten Weingüter Chiles etabliert haben, entstehen nun auch neue Weingüter auf kleineren Parzellen, mit denen sich auch die Aufmerksamkeit weg von der Exportorientierung hin zum spezifischen Terroir eines Weinberges verschiebt, als dessen Ausdruck Wein wieder verstanden wird. Nicht selten werden diese Güter von Weinbauern bewirtschaftet, die sich vor Pinochet noch für die Agrarreform eingesetzt haben.
Wie hier beim Wein erobert sich das Volk das Land insgesamt nach und nach zurück: Als Pinochet 2006 im Alter von 91 Jahren stirbt hinterlässt er nicht nur zahlreiche offene Verfahren wegen Menschenrechtsverletzungen, die ungesühnt bleiben, einen Skandal wegen Steuerhinterziehung und ein verstecktes Vermögen von 27 Millionen US-Dollar auf hunderten Auslandskonten, sondern auch eine neoliberale Verfassung, gegen die sich die junge Generation nun auflehnt.
Die Regierung billigt die Proteste und gewährt nun auch den Ärmsten Beihilfen – doch in der Sache ändert sich nichts. Fünf Jahre später gehen Studenten erneut auf die Straße – gegen Studiengebühren – und langsam entwickelt sich auch ein Bewusstsein für Ungerechtigkeit. Allmählich bekommt der Neoliberalismus Risse und offenbart die Probleme einer Gesellschaft, die tagtäglich ums Überleben kämpfen muss. Aber auch nach 30 Jahren Demokratie ist die Ungleichheit noch immer nicht besiegt.
2019 bringt dann eine Preiserhöhung im öffentlichen Nahverkehr das Fass der Unzufriedenheit erneut zum Überlaufen: Im Herbst dieses Jahres erschütterte eine neue Protestwelle das Land. Abermals setzt sich die Jugend an die Spitze der Bewegung. Die Frage nach der Verteilung des Wohlstandes taucht wieder auf, die Jahrzehnte keine Rolle spielte. Eine Million Menschen demonstrierte in Santiago de Chile – und einmal mehr setzte der Staat auf Gewalt: Das Militär löste die Demonstration brutal auf, wieder gibt es Tote und 12.000 Verletzte, darunter 2.000 mit Schussverletzungen.
Die Gewalt löste Empörung aus – und irgendwann demonstrieren fast 30 bis 40 Prozent der Bevölkerung des Landes. Man ist sich im chilenischen Volk einig, dass das politische, soziale und wirtschaftliche Modell, wie es die neoliberale Verfassung aus der Zeit der Militärdiktatur Pinochets vorsieht, Schuld an dem immer größeren sozialen und wirtschaftlichen Gefälle im Land ist, nicht die Staatsführung an sich. Nun aber wird mehr Gleichheit gefordert – an einer neuen Verfassung führte kein Weg mehr vorbei.
Präsident Miguel Juan Sebastian Pinera Echenique gibt nach: Eine verfassungsgebende Versammlung, ein Verfassungskonvent, soll gewählt werden – ein demokratischer Prozess mit Beteiligten aus allen sozialen Schichten der Gesellschaft soll eine neue Verfassung erarbeiten. Unter der Leitung einer Indigena geht die Versammlung 2021 ans Werk, ihr gehören 78 männliche und 77 weibliche gewählte Vertreter aus allen Schichten der Gesellschaft an, darunter auch 17 Vertreter der Mapuche. Sie sollen gemeinsam an einer Verfassung arbeiten, die soziale Rechte garantiert und in der die Grundrechte nicht als Konsumgut betrachtet weden. Außerdem sollte ein Recht auf Rente, Zugang zum Gesundheitswesen, Bildung, Frauenrechte (Recht auf Abtreibung), Minderheitenrechte, Umweltschutz (die Natur sollte zu einem Rechtssubjekt werden), die Anerkennung indigener Völker und Elemente direkter Demokratie in die neue Verfassung eingehen.
Der Wunsch nach Wandel brachte 2021 auch Gabriel Boric, einen 36jährigen Sozialdemokraten und ehemaligen Studentenführer der Proteste von 2011, an die Macht. Er gewann die Präsidentschaftswahlen gegen den rechtsextremen Kandidaten mit dem Versprechen, gegen die Ungleichheit anzugehen, die in historischer und geographischer Hinsicht die chilenische Gesellschaft spaltet. Er beruft sich stolz auf Allende und setzt sich auch für sozialen Wandel und den neu entstandenen Verfassungsentwurf ein.
Dann aber wird die von einem überwiegend linken Konvent ausgearbeitete Verfassung 2022 von der Mehrheit der Gesellschaft abgelehnt, vielen ging der äußerst fortschrittliche Entwurf offenbar deutlich zu weit. So wurde eine große Chance auf eine vom Volk geschriebene Verfassung vertan – was zeigt, dass der Schatten Pinochets, ein mächtiger Konservatismus, noch immer über dem Land liegt. Zwar soll es am 17. Dezember dieses Jahres noch einmal eine Abstimmung über eine neue Verfassung geben, sie aber ist von den konservativen Kongressparten erarbeitet worden, nicht mehr vom einem Konvent, und es ist äußert fraglich, ob diese deutlich abgemilderte Version angenommen werden wird.
Ein Jahr nach dem gescheiterten Referendum gibt inzwischen jedenfalls wieder die politische Rechte in Chile den Ton an. An der gesellschaftlichen Spaltung des Landes hat sich nichts geändert …