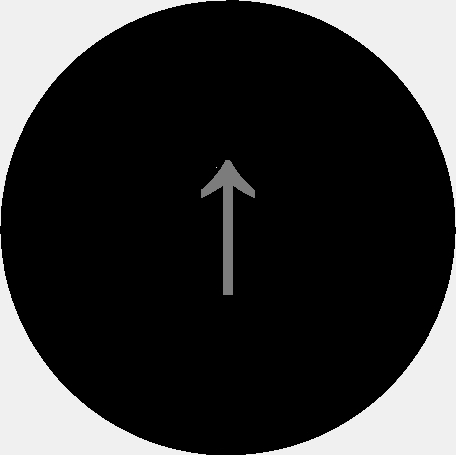Die Violine hat ihren Ursprung im Alpenraum. Seit Jahrhunderten werden hier Streichinstrumente hergestellt. Eine Spurensuche …
„Ein modernes Instrument ist wie ein weißer Canvas, das heißt eigentlich bereitwillig einem folgend, macht alles wie man es will, ist laut, ist da, ist präsent. Aber hat es Mysterium? Nein.“
Die Violinistin Anne-Sophie Mutter in „Stradivari – Mythos und Markt“ (2023)
Ouvertüre
Als sich der schwedische Komponist Ludwig Göransson das erste Mal mit dem Regisseur Christopher Nolan wegen dem Soundtrack für dessen Film Oppenheimer zusammenkommt, sagte Nolan zu ihm nur: „I don’t really know where we’re going to go with this, but I think you should experiment with the violin.“ Die Violine sollte also das Fundament des Films bilden, und Göransson war damit durchaus einverstanden: „Ich hatte noch nie zuvor ein solches Drehbuch gelesen, das dich direkt in den Verstand von Oppenheimer versetzt. Du siehst die Welt durch seine Augen. Oppenheimer ist ein Genie, aber er verbirgt einen Dämonen“, zitiert ihn Dominik Lippe in einem Artikel in diesem Zusammenhang. Die Violine könne dem gerecht werden: „There`s so much in the performance of the violin. Within a second you can go from something beautiful to something completely horrifiying“, kaum ein anderes Instrument habe solche klanglichen Möglichkeiten.
In Oppenheimer verbindet Nolan früh im Film Musik und Mathematik: „Lernen Sie theoretisch zu denken“, erklärt der Physiker Niels Bohr dem jungen Oppenheimer bei dessen erster Begegnung, „Algebra ist vergleichbar mit einer Partitur. Die Frage ist nicht, können Sie Noten lesen, sondern können Sie sie hören?“ Danach setzt eine Kettenreaktion in der Vorstellung Oppenheimers ein, zu der Göransson „Can You Hear The Music“ komponiert hat. Lippe bemerkt dazu: „Es vollzieht sich ein Auf und ab des Gedankenprozesses, zusammengeschnitten mit Bildern von Funken, Sternen und Elementarteilchen. `Can you hear the music´ bringt mit seinen 21 Tempowechseln das Entstehen und Vergehen, Fussion und Fission auf den Punkt.“
Göransson selbst hielt dieses Stück zunächst für unspielbar: vierzig Violinisten und Violinistinnen, die zu den Bildern der rotierenden Atome langsam in eine atemberaubende Raserei geraten … Er wollte das zunächst im Studio einfach Takt für Takt aufnehmen – wurde dann aber von seiner Frau, der Violinistin Serena McKinney, dazu überredet es doch in einem Fort zu versuchen. Nach drei Tagen stand die Aufnahme schließlich: „Am Ende haben wir Musik aufgenommen, die das Übertraf, was ich für menschlich möglich gehalten habe“, zitiert ihn Lippe.
Die Szene zwischen Niels Bohr und Robert J. Oppenheimer, für die Göransson „Can You Hear The Music“ komponierte, hat zwar stattgefunden, aber nicht so, wie sie von Nolan gezeigt wird. In ihrer Biographie „J. Robert Oppenheimer“ (2010) schreiben Kai Bird und Martin J. Sherwin: „Zur ersten persönlichen Begegnung zwischen Oppenheimer und Bohr kam es in [Ernest] Rutherfords Büro. Als Robert hereinkam, stand Letzerer von seinem Schreibtisch auf machte Bohr mit seinem Studenten bekannt. `Ich stecke in Schwierigkeiten.´ – `Sind diese Schwierigkeiten mathematischer oder physikalischer Art?´ – `Das weiß ich nicht.´ Darauf sagt Bohr: `Das ist nicht gut.´ Bohr erinnerte sich lebhaft an diese Begegnung – Oppenheimer habe ungewöhnlich jung gewirkt, doch nachdem er gegangen sei, habe ihm Rutherford gesagt, er erwarte viel von diesem jungen Mann. / `Sind die Schwierigkeiten mathematischer oder physikalischer Art?´ – Jahre später erzählte Oppenheimer, wie bedeutsam diese Frage für ihn war: `Sie führte mich darauf, wie sehr ich mich in formale Fragen verrannte ohne einen Schritt zurück zu tun und mich darum zu kümmern, was sie mit der physikalischen Seite des Problems zu tun hatten.´ Später sah er, dass sich einige Physiker zur Beschreibung der Natur beinahe ausschließlich der Mathematik und ihrer Sprache bedienen. Die verbale Beschreibung sähen sie nur als `Zugeständnis an die Verständlichkeit, sie ist nur pädagogisch gemeint. Ich glaube, dass triff besonders auf [den britischen Physiker Paul] Dirac zu. Seine Einfälle sind am Anfang nicht verbaler, sondern algebraischer Natur.´ Ein Physiker wie Bohr dagegen betrachte `die Mathematik, wie Dirac Worte betrachtet, nämlich als einen Weg, sich verständlich zu machen …“
Hannah Arendt erkennt hierin – in diesem Verhältnis von Algebra und Sprache – nun ein grundlegendes Problem der Moderne. In „Vita activa“ (1958) schreibt sie: „Es zeigt sich nämlich, daß die `Wahrheiten´ des modernen wissenschaftlichen Weltbilds, die mathematisch beweisbar und technisch demonstrierbar sind, sich auf keine Weise mehr sprachlich oder gedanklich darstellen lassen. Sobald man versucht, diese `Wahrheiten´ in Begriffe zu fassen und in einem sprechend-aussagenden Zusammenhang anschaulich zu machen, kommt ein Unsinn heraus, der `vielleicht nicht ganz so unsinnig ist wie ein `dreieckiger Kreis´, aber erheblich unsinniger als ein `geflügelter Löwe´. (Erwin Schrödinger). Wir wissen noch nicht, ob dies endgültig ist. Es könnte immerhin sein, daß es für erdgebundene Wesen, die handeln, als seien sie im Weltall beheimatet, auf immer unmöglich ist, die Dinge, die sie solcherweise tun, auch zu verstehen, d. h. denkend über sie zu sprechen. Sollte sich das bewahrheiten, so würde es heißen, daß unsere Gehirnstruktur, d. h. die physisch-materielle Bedingung menschlichen Denkens, uns hindert, die Dinge, die wir tun, gedanklich nachzuvollziehen. – woraus in der Tat folgen würde, daß uns gar nichts anderes übrigbleibt, als nun auch Maschinen zu ersinnen, die uns das Denken und Sprechen abnehmen.“
Für Arendt ist klar: „die Wissenschaften reden heute in einer mathematischen Symbolsprache, die ursprünglich nur als Abkürzung für Gesprochenes gemeint war, sich aber hiervon längst emanzipiert hat und aus Formeln besteht, die sich auf keine Weise zurück in Gesprochenes verwandeln lassen. Die Wissenschaftler leben also bereits in einer sprach-losen Welt, aus der sie qua Wissenschaftler nicht mehr herausfinden. Und dieser Tatbestand muß, was politische Urteilfähigkeit betrifft, ein gewisses Mißtrauen erregen. Was dagegenspricht, sich in Fragen, die menschliche Angelegenheiten angehen, auf Wissenschaftler qua Wissenschaftler zu verlassen, ist nicht, daß sie sich bereitfanden, die Atombombe herzustellen, bzw. daß sie naiv genug waren zu meinen, man würde sich um ihre Ratschläge kümmern (…); viel schwerwiegender ist, daß sie sich überhaupt in einer Welt bewegen, in der die Sprache ihre Macht verloren hat, die der Sprache nicht mächtig ist. Denn was immer Menschen tun, erkennen, erfahren oder wissen, wird sinnvoll nur in dem Maß, in dem darüber gesprochen werden kann.“
Es sind diese Gedanken, die Arendt durch den Kopf gehen, als im Jahr 1962, in den Tagen der Kubakrise, als die Welt am Rande eines Atomkriegs stand, auf der Straße ihrem Studenten Richard Sennett begegnete. Und die „Raketenkrise“, so erinnert sich Sennett, „hatte sie wie uns alle erschüttert, sie aber auch in ihrer Überzeugung bestärkt“, wie er in „Handwerk“ (2008) schreibt. In „Vita activa“ hatte Arendt nur vier Jahre zuvor dargelegt, so rekapituliert Sennett, „dass der Ingenieur (…) nicht Herr im eigenen Hause sei. Die Politik stehe über der physischen Arbeit und müsse ihr Leitlinien vorgeben. Zu dieser Überzeugung war sie gelangt, als das Los-Alamos-Projekt 1945 die erste Atombombe entwickelte. (…) Arendts Furcht vor selbstzerstörerischen materiellen Erfindungen reicht in der westlichen Kultur zurück bis zum Mythos der Pandora. (…) Mit der Weiterentwicklung ihrer Kultur erkannten die Griechen in Pandora zunehmend ein Element ihres eigenen Wesens: Die von Menschen gemachten Dinge, in denen die Kultur gründet, bargen die ständige Gefahr der Selbstzerstörung. / Etwas nahezu Unschuldiges im Menschen kann diese Gefahr heraufbeschwören: Menschen lassen sich von Staunen, Erregung und Neugier verführen und schaffen so die Illusion, das Öffnen der Büchse sei ein neutraler Akt. Im Blick auf die erste Massenvernichtungswaffe hätte Arendt auch eine Tagebucheintragung von Robert Oppenheimer zitieren können, der das Los-Alamos-Projekt geleitet hatte. Darin schreibt Oppenheimer wie zur Entschuldigung: `Wenn man etwas technisch Verlockendes sieht, macht man sich an die Arbeit und fragt sich erst später, wenn man technisch erfolgreich war, wie man damit umgehen soll. So war es auch bei der Atombombe.´ (…) Im antiken Mythos waren die aus Pandoras Büchse dringenden Schrecken nicht die Schuld des Menschen. Sie hatten ihre Ursache im Zorn der Götter. In einem stärker säkularisierten Zeitalter ist die Angst vor Pandora Anlass zu größter Verstörung: Bei den Erfindern der Atombomben mischt sich Neugier mit Schuld. (…) In seinem Tagebuch erinnerte Oppenheimer an die Worte des indischen Gottes Krischna: `Ich bin der Tod, der Weltzerstörer.´ Fachleute, die sich vor ihrem eigenen Fachwissen fürchten: Wie sollen wir mit diesem schrecklichen Paradoxon umgehen?“
Oppenheimer wusste nicht, wie er mit dem, was er entfesselt hatte, umgehen sollte. Bei seinem Abschied am 2. November 1945 sagte er: „Es ist gut, nun die denkbar größte Kraft zur Kontrolle der Welt an die ganze Menschheit zu übergeben, damit sie nach ihren Erkenntnissen und Werten damit verfährt.“ Damit wird, wie Sennett bemerkt, „das Werk des Schöpfers zu einem öffentlichen Problem“ – und obwohl Arendt, wie Sennett vermutet, „nicht viel von Physik verstand, nahm sie Oppenheimers Herausforderung an: Sollte also die Öffentlichkeit sich dem Problem stellen. Sie besaß eine robuste Zuversicht, dass die Öffentlichkeit die materiellen Bedingungen ihres Lebens verstehen und politisches Handeln den Willen der Menschheit festigen konnte (…) In The Human Condition [Vita acitva], erschienen 1958, stellt sie heraus, wie wichtig es ist, dass die Menschen offen und frei miteinander sprechen. Sie schreibt: `Sprechen und Handeln … sind die Modi, in denen sich das Menschsein selbst offenbart.´“
Dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen – Richard Sennett aber ist nicht damit einverstanden, dass Arendt hier zwischen dem Handelnden und dem Denkenden unterscheidet. Für Arendt ist Oppenheimer ein geistloser Techniker, der Arbeit als Selbstzweck betrachtet und insofern handelt, ohne an die gesellschaftlichen Folgen seines Tuns zu denken. Das werde, so Sennett, dem Handwerker als praktisch tätigem Menschen nicht gerecht: „Bei jedem guten Handwerker stehen praktisches Handeln und Denken in einem ständigen Dialog. Durch diesen Dialog entwickeln sich dauerhafte Gewohnheiten, und diese Gewohnheiten führen zu seinem ständigen Wechsel zwischen dem Lösen und dem Finden von Problemen. Solch ein Verhältnis zwischen Hand und Kopf findet sich in scheinbar so unterschiedlichen Bereichen wie Maurern … oder dem Cellospiel. Die Entwicklung handwerklichen Könnens hat nichts Unausweichliches, wie auch die Technik als solche nichts geistlos Mechanisches besitzt“, schreibt er.
Für Sennet ist klar, dass es „(d)er westlichen Zivilisation tiefgründige Probleme bereitet (hat), Kopf und Hand miteinander zu verbinden“. Wir stehen aber aber, so Sennett, im Bereich der natürlichen Ressourcen und des Klimawandels „vor eine phyischen Krise, die weitgehend von uns Menschen gemacht ist. Aus dem Pandora-Mythos wird damit ein ganz profanes Symbol der Selbstzerstörung. Wenn wir diese physische Krise überwinden wollen, müssen wir andere Dinge herstellen als bisher und sie auf andere Weise nutzen. (…) Heute verwenden wir den Ausdruck „Nachhaltigkeit“ zur Kennzeichnung solch eines handwerklichen Könnens, und der Begriff trägt einiges im Gepäck. „Nachhaltigkeit“ meint, in größerem Einklang mit der Natur zu leben (…) die Herstellung eines Gleichgewichts zwischen uns und den Ressourcen der Erde, ein Bild des Ausgleichs und der Versöhnung. (…) Der Traum, in Frieden und Gleichgewicht mit der Welt zu leben, verleitet uns meines Erachtens, den Ausweg in einer Idealisierung der Natur zu suchen, statt uns der von uns selbst herbeigeführten Selbstzerstörung zu stellen. (…) Der Rückzug auf spirituelle Werte dürfte beim Umgang mit Pandora kaum helfen. Die Natur ist möglicherweise ein besserer Führer, sofern wir unsere eigene Arbeit als Teil der Natur begreifen.“
Füssen und der Lautenbau
Die Violine hat ihren Ursprung in den Alpen, das heißt seit Jahrhunderten werden im Alpenraum Streichinstrumente hergestellt. Auch in dem unscheinbaren Städtchen Füssen im Allgäu, direkt bei Schloss Neuschwanstein am Fuß der Alpen gelegen, etwa zwanzig Kilometer nordöstlich der Zugspitze. Nur etwa 2.000 Menschen lebten hier um 1600, und dennoch gilt Füssen als Wiege des Lauten- und des sich später daraus entwickelnden Geigenbaus: Hunderte von Lauten- und Geigenbauern sind über die Jahrhunderte von hier nach ganz Europa emigriert und haben den Instrumentenbau und -handel über den ganzen Kontinent maßgeblich beeinflusst, zeitweise sogar dominiert.
Dafür gibt es sicherlich mehrere Gründe, ein entscheidender aber dürfte insbesondere auch in der Armut der Menschen gelegen haben. Denn grundsätzlich ist der Boden in der Alpenregion an vielen Orten karg oder das Gelände zu steil und bergig, um hier großflächig Nutzpflanzen anbauen zu können. Viehwirtschaft war nur im Rahmen einer Alpwirtschaft möglich, hinzu kommt, dass die Winter oft lang und hart waren. Landwirtschaft war insofern also mühsam und gerade für kleine Bauern war es schwierig, ausschließlich davon zu leben. Viele von ihnen mussten entweder auswandern oder sich nach anderen Erwerbsmöglichkeiten umsehen.
Wie überall im Alpenraum hat sich so auch in der Region um Füssen die Holzwirtschaft entwickelt. Kräftige Männer verbrachten insbesondere die Sommermonate damit, in die Alpen zu wandern und von den Bergwäldern dort das Holz der Fichten, Tannen, Lärchen oder Eiben ins Flachland zu bringen. Sie nutzten dazu den damals befahrbaren Lechfluss, indem sie die Baumstämme zusammenbanden und sie auf dem Fluss über Füssen nach Augsburg flößten.
Schon seit jeher war das Holz aus den höheren Lagen der Alpen besonders wertvoll, da die Bäume hier aufgrund der Umweltbedingungen langsamer wachsen und somit dichteres Holz bildeten, das insofern besonders strapazierfähig und stabil waren. Hauptsächlich aus dicht gewachsenen Nadelhölzern wurden in Füssen schon im 15. Jahrhundert Saiteninstrumente wie Lauten, Fiedeln und Violen hergestellt, und 1562 dann auch die erste Lautenmacherzunft Europas gegründet.
Wegen seiner besonderen Resonanzfähigkeit für den Instrumentenbau gebraucht wurde vor allem das Holz von Fichten und Ahorn, hinzu kommt Birnenholz. Bevorzugt verwendet wurde langsam gewachsenes Fichtenholz, das auf mineralstoffarmen Böden gewachsen ist – wie eben auf den Steilhängen des Alpengebirges. Die Jahresringe haben sich hier in sehr engen Abständen ausgebildet. Das gilt insbesondere für die frühe Neuzeit, als das Klima kühl war, weshalb die Bäume langsam wuchsen und der Holzzuwachs entsprechend gering war. Man spricht in diesem Zusammenhang auch von der „Kleinen Eiszeit“.
Erstmals verwendet wurde dieser Begriff Ende der 1930er Jahre vom amerikanischen Glaziologen Francois Matthes (1875-1949), der die Gletschervorstöße in Nordamerika infolge der Abkühlung des Klimas nach der Warmzeit des Mittelalters untersuchte. Ihm zufolge gehen die meisten der noch heute existierenden Gletscher des nordamerikanischen Kontinents nicht auf die letzte Große Eiszeit zurück, sondern entstanden erst wesentlich später, nämlich ab dem 13. Jahrhundert. Entsprechend nannte er die Zeit zwischen dem 13. und 19. Jahrhundert, als es weltweit, auch in den Alpen, zu großen Gletschervorstößen kam, auch „the little ice age“. Dieser Begriff wurde dann von dem schwedischen Wirtschaftshistoriker Gustaf Utterström (1911-1985) aufgegriffen, der damit versuchte, die Klimaverschlechterung in Skandinavien im 16. und 17. Jahrhundert zu erklären. Utterström wandte sich damit gegen den von dem Soziologen Émile Durkheim (1858-1917) formulierten Grundsatz, Soziales nur durch Soziales zu erklären, und verwies stattdessen – wie vor ihm bereits Montesquieu – darauf, dass es auch externe Faktoren gebe, die das Leben der Menschen, deren Lebensform, beeinflussen – allen voran das Klima.
Nun hat man es bei der Kleinen Eiszeit allerdings nicht mit einer konstanten klimatischen Abkühlung zu tun, sondern mit einer vorherrschenden Tendenz, wie Wolfgang Behringer in „Kulturgeschichte des Klimas“ (2007) schreibt, allerdings sei für die Jahrzehnte ab 1563 im Alpenraum „ein deutlicher Rückgang der durchschnittlichen Temperaturen um etwa 2 Grad Celsius zu beobachten: Hier haben wir es mit einem der typischen Abkühlungsereignisse der Kleinen Eiszeit zu tun“, wobei die Kälte, die langen Winter, der viele Schnee, das dauerhafte Eiss und das Gletscherwachstum auch von den Zeitgenossen wahrgenommen wurden. Behringer schreibt in diesem Zusammenhang: „Lokale Chronisten stellten durchaus längerfristige Vergleiche an, und Prediger nutzten die ungeheuren Schneemassen für ihre geistlichen Ermahnungen. (…) Das Gletscherwachstum wurde aufmerksam registriert. So wandten sich im Jahr 1601 die Bauern von Chamonix in Panik an die Regierung von Savoyen, weil der Gletscher, der heute unter dem Namen Mer de Glace bekannt ist, ständig anwachse, bereits zwei Dörfer begraben habe und gerade dabei sei, ein drittes zu zerstören.“ Auch der Füssener Färbermeister Hanns Faigele, der eine private Stadtchronik verfasste, beobachtete die Veränderungen. Über die damals häufig auftretenden Kapriolen der Natur notiert er an einem Frühjahrstag: „Am Markustag [25. April 1618] schneite es den ganzen Tag, und es herrschte eine so große Kälte, die den gefallenen Schnee hart gefrieren ließ; es war so kalt, dass mir noch am darauffolgenden Freitag das Wasser in den Tüchern am Netz in der Mange gefror.“
So unklar die mit der Kleinen Eiszeit verbundenen Veränderungen des Ökosystems insgesamt auch sind, weil weitreichendere Aufzeichnungen von Beobachtungen als jene von Hanns Faigele aus dieser Zeit nicht existieren, kann man für den hochalpinen Bereich aber dennoch konstatieren, so Behringer, „dass die Baumgrenze sank und hochgelegene Almen aufgegeben werden mussten“, je länger die Kleine Eiszeit andauerte. „In den Mittelgebirgen und in den Alpen verkleinerten sich die Möglichkeiten der Viehhaltung, weil die Almweide entfiel.“ Auch die Holzbewirtschaftung war spätestens ab der Mitte des 17. Jahrhunderts von der Abkühlung betroffen: „Längere Heizperioden waren nicht nur ein Kosten-, sondern auch ein Umweltfaktor. Der Holzbedarf stieg und führte zu Knappheit oder Auseinandersetzungen um Ressourcen. Tagebucheinträge verdeutlichen, dass jährliche Holzkäufe schon wegen des Transports teuer waren und jede Menge Arbeit und logistisches Geschick sowie Lagerfläche erforderten. Hinzu kam, dass bei großer Kälte das Holz langsamer wuchs, wie wir auch von der Dendrochronologie wissen.“ Behringer zitiert in diesem Zusammenhang einen Zeitgenossen: „Das Holz im Wald wächset auch nicht mehr wie in Vorzeiten (…). Eine gemeine Klag und Sag unter den Leuten ist, dass, wenn die Welt länger stehen sollte, es ihr endlich und in kurzer Zeit an Holz mangeln und gebrechen würde.“
Im 16. Jahrhundert aber war von diesem Mangel noch nichts zu spüren, im Gegenteil. Hochwertiges Holz gab es reichlich – und so gab es um 1600 in Füssen schon 18 bei der Innung gemeldete Lautenbauerwerkstätten, während es, zum Vergleich, in Nürnberg mit seinen 40.000 Einwohnerinnen und Einwohnern nur fünf Lautenbauer gab und in Augsburg sogar nur drei. Gerade in landwirtschaftlich unsicheren Zeiten wie dann zunehmend während der Kleinen Eiszeit bot der Instrumentenbau einen Ausweg aus der ländlichen Armut, man konnte so durchaus mit einem stabilem Einkommen rechnen. Allerdings waren so viele Werkstätten auch deutlich zu viel für ein so kleines Städtchen wie Füssen: Es gab für die zahlreichen hier ausgebildeten Handwerker einfach nicht genug Arbeitsplätze – und die Wahrscheinlichkeit war hoch, dass man sich als Geselle woanders umsehen musste: Die Zunft kontrollierte nicht nur Preis und Qualität der hergestellten Lauten, sondern bestimmte auch, wie viele Werkstätten überhaupt zugelassen wurden. Einem Lehrling war so von Anfang an klar, die Stadt nach der Ausbildung verlassen zu müssen.
Nun führt durch Füssen jedoch nicht nur der Lechfluss, sondern auch die Via Claudia Augusta, eine alte Römerstraße, die von der Adria und den Ebenen des Po über die Alpen bis zur Donau führte, und so das eigentlich unbedeutende Provinzstädtchen mit einer der wichtigsten Metropolen jener Zeit, Venedig, verband. Die geographische Lage verband Füssen insofern mit einem der bedeutendsten Märkte jener Zeit. Und so machten sich viele Füssener über die Via Claudia Augusta auf den Weg auf die Alpensüdseite, was dazu führte, dass in Norditalien und Venedig bald zwei Drittel aller Lautenbauer Füssener Abstammung waren.
Aber umgekehrt kamen Einflüsse auf diesem Weg auch aus Venedig: Im 15. und 16. Jahrhundert war Venedig nicht nur als Seemacht bedeutsam, sondern insbesondere auch kulturell, wie Philipp Bloom in „Eine italienische Reise“ (2018) schreibt, wo er sich auf die Suche nach dem Ursprung seiner Geige macht: „Die musikalische Kultur Venedigs war (…) ein Abbild seiner internationalen Handelsverbindungen. Besonders die Kultur der moslemischen Welt erreichte mit den Händlern aus Konstantinopel und der Levante hier ihren ersten europäischen Hafen. So kamen nicht nur musikalische Formen, sondern auch Instrumente aus der islamischen Tradition nach Venedig. Das vielleicht wichtigste darunter war ein besonders vielseitiges Saiteninstrument, die Oud, die in Konstantinopel und im islamischen Spanischen al oud genannt wurde und in Europa bals als lute (englisch), liuta (italienisch) oder als Laute bekannt werden sollte.“
Quellen zur Frühgeschichte des Lautenbaus in Füssen sind rar und fragmentarisch, erklärt Blom, und es ist noch nicht erforscht, wie genau das Wissen und die Expertise hier in die Voralpen gelangen konnte, sodass Füssen eine derart wichtige Position im Instrumentenbau einnehmen konnte. Ein Anhaltspunkt könnte Blom zufolge die Einbürgerung eines gewissen Jörg Wolff als „Lauter“ am 10. Oktober 1493 gewesen sein. Seine Einbürgerung ist jedenfalls „ein Hinweis darauf, wie weit die Verbindungen der kleinen Stadt gereicht haben könnten. Die spanische Übersetzung von Wolf ist Lopez, und das Datum seiner Einbürgerung, 1493, legt zumindest die Möglichkeit nahe, dass Wolff ursprünglich Jorge Lopez gewesen sein könnte, ein spanisch-jüdischer Musiker und Lautenbauer, der ein Jahr nach der spanischen Reconquista auf der Flucht ins Alpenvorland kam“, wie Blom schreibt. Zwar lässt sich nicht beweisen, „dass mit Jörg Wolff ein Stück mediterrane Expertise nach Füssen kam“, es gab allerdings „eine bekannte spanisch-jüdische Musikerfamilie namens Olmaliach oder Almaliach (wohl eine Version von El-Malech)“, die sich „nach ihrer erzwungenen Konversion Lopez (nannte). In den folgenden Jahrzehnten verließen mehrere Mitglieder dieses Musikerclans Spanien, um anderswo in Europa ein besseres Leben zu suchen.“
Al-Andalus war der arabische Name für die zwischen 711 und 1492 muslimisch beherrschten Teile der Iberischen Halbinsel. Mit ihren maurischen, christlichen und jüdischen Einflüssen war die musikalische Kultur von Al-Andalus ungeheuer vielfältig und verfeinert, „und die wenigen Instrumente, die aus dieser Periode erhalten sind, zeugen von einer raffinierten Handswerkskunst“, wie Blom schreibt. Allerdings wurden schon vor Jörg Wolff, früher im 15. Jahrhundert, Lautenmacher in der Stadt urkundlich erwähnt. Womöglich haben sie sich im Gefolge des römisch-deutschen Kaisers Maximilian I. (1459-1519) hier niedergelassen: Vielleicht war es die schöne und praktische Lage, die den Kaiser dazu bewog, „oft und gelegentlich auch mehrere Monate lang in Füssen zu residieren“. Mit ihm kamen dann auch von überall her „Musiker (…) und Handwerker in den Ort, der um diese Zeit seine größte Blüte erlebte“, wie Blom erklärt. Unter diesen Bedingungen konnten sich auf jeden Fall von Füssen aus bald ein Netzwerk für die höfische Musik und den Lautenbau über den Kontinent spannen. Unabhängig davon also, ob der Lautenmacher Jörf Wolff nun aus Al-Andalus nach Füssen kam oder nicht – vermutlich gelangte die Laute schon zu dieser Zeit über die Via Claudia Augusta von Venedig aus hierher.
Es waren die Begegnungen mit dem Orient, vor allem über Al-Andalus, aber auch über die Beziehungen Venedigs zu Konstantinopel, von denen Europa insgesamt und Füssen in der Folgezeit im Besonderen profitierte: Grundlage dafür, dass sich der Lautenbau in der Stadt etablierte, waren insofern nicht nur das wertvolle Holz aus den hiesigen Bergwäldern und der befahrbare Lechfluss als Transportweg für das Holz, sondern auch die Handelsverbindungen nach Venedig über die Via Claudia Augusta.
Die Laute
Die Araber kannten drei Lautentypen, erklärt Gabriele Braune in „Europa und der Orient 800-1900“ (1989), von denen die Knickhalslaute, die al Oud oder al-Ud, die heute noch geläufigste ist, während die Kurzhalslaute Rabab im Mittelalter verbreiteter war und die Langhalslaute al-Tunbur sich wiederum insbesondere in der osteuropäische Musikpraxis etabliert hat. Die Knickhalslaute war im persischen Raum schon seit dem dritten Jahrhundert gebräuchlich. Im siebten Jahrhundert wurde sie in Mekka eingeführt, unter der Bezeichnung Barbat (Entenbrust), nach der Form des gewölbten, birnenförmigen Resonanzkörpers. Korpus und Hals waren dabei aus einem Stück Holz gefertigt. In früher Zeit war das Instrument nur mit zwei Saiten bespannt, später mit mehr.
Die Kurzhalslauten waren auch bekannt als Kiran, Mizhar oder Muwattar. Seit etwa Ende des 8. Jahrhunderts spricht man aber auch von diesem Lautentyp nur noch als al-Ud, was auf arabisch das Holz heißt. Gemeint ist damit jenes Instrument, wie Braune ausführt, „dessen elliptischer Korpus ohne Unterbrechung in einen rechtwinklig umgeschlagenen Wirbelkasten mit seitenständigen Wirbeln übergeht und in einen sogenannten Riegelschweif ausläuft. In den Resonanzkörper sind zwei oder mehr Schalllöcher eingelassen, die Saiten werden mit einem Plektrum geschlagen.“
Seit dem 13. Jahrhundert ist eine zunehmende Europäisierung der arabischen Laute zu beobachten, das heißt auf dem Griffbrett wurden Unterteilungslinien angebracht, wie man auf zeitgenössischen Darstellungen erkennen kann, was auf die Entwicklung einer Bundeinteilung schließen läßt, wie Braune erklärt. Außerdem wird das Schallloch in dieser Zeit zentral inmitten des Resonanzkörpers platziert, der Hals des Instrumentes vom Korpus abgesetzt, der nun auch langsam eine bauchige, an der Basis abgeflachte Form bekommt.
Vom 15. bis zum 17. Jahrhundert vergrößerte man den Umfang der Saiten auf sechs. Braune schreibt in diesem Zusammenhang: „Mit Ausnahme der beiden höchsten Saiten (Chanterelle) waren alle auf dem Griffbrett liegenden Saiten paarweise angeordnet; die zweite Saite der tieferen Chöre meist in der höheren Oktave der ersten Saite gestimmt. Jedes Saitenpaar, aber auch jede selbstständige Saite wurde Chor genannt, so daß man von fünf- bis sechschörigen Lauten sprach.“ Die Vergrößerung des Tonumfangs nach der Tiefe führte im 16. Jahrhundert außerdem zur Erfindung verschiedener Basslauten, die Theorben genannt wurden oder auch Arciliuto und Chittarone.
Neben den Bass- und den Langhalslauten war die arabisch Rabab genannte Kurzhalslaute im Westen bald am gebräuchlichsten. Dieses Instrument mit birnenförmigem Korpus ist aus einem Stück Holz geschnitten und läuft in einem rechtwinkelig abgebogenen Kopf mit seitenständigen Wirbeln aus. Es unterscheidet sich aber nicht nur der Form nach von den anderen Lautentypen, denn die Rabab ist ein Saiteninstrument, das mit einem Bogen gestrichen wird. Die typische orientalische Spielhaltung bestand dabei – ähnlich wie heutzutage bei einem Chello – in einem senkrecht vor dem Körper gehaltenen Instrument, das mit einem Bogen gestrichen wird. Die Rabab war aller Wahrscheinlichkeit nach das erste Streichinstrument, das während der arabischen Herrschaft im Westen bekannt wurde, jedenfalls spricht man in spanischen Quellen, wie Braune erklärt, seit dem 12. Jahrhundert von der Rabab als Rabé (morisco), Rabel oder Raben, während sich im deutschen Sprachgebrauch des Mittelalters der Begriff Rebec durchsetzte.
Das im Hinblick auf die Herausbildung der Violine wichtigste Resultat aus dem Bekanntwerden der Rabab hierzulande war die Übernahme des Streichbogens, der in Europa bis zum 9. Jahrhundert völlig unbekannt war, bald jedoch auf allen sogenannten Chordophonen – also Saiteninstrumenten – verschiedenster Art eingesetzt wurde. Der früheste Beleg eines gestrichenen Saiteninstruments europäischer Herkunft befindet sich in einer Apokalypsenhandschrift des Beatus de Liébana, die aber erst lange nach seinem Tod um etwa 798 zwischen 920 und 930 im arabischen Spanien entstand ist. „Die Citharae dei, in früheren Beatus-Handschriften stets gezupft dargestellt, werden nun mit einem Bogen gestrichen, der in typisch orientalischer Spielweise, das senkrecht vor dem Körper gehaltene Instrument zum Klingen bringt“, wie Braune schreibt.
Im 11. Jahrhundert ging man dazu über, die Rabab immer mehr zur europäischen Violine hin zu entwickeln: Der Wirbelkasten lief flach aus, am Korpus wurden Seiteneinschnürungen angebracht, so daß man das Instrument seitlich oder schräg umhängen oder halten konnte und den Bogen so zu führen vermochte, wie es typisch für die europäische Spieltechnik wurde. Durch die Vervollkommnung der Violen und schließlich das Aufkommen der Violinen wurde der Rabab-Typus dann immer mehr in den Hintergrund gedrängt.
Von der Laute zur Violine
Der Bau von Lauten ist eine außergewöhnlich komplexe Angelegenheit, erklärt Philipp Blom: „Sie haben im Wesentlichen die Form einer halbierten Birne und bestehen aus einem halbrunden Bauch, einer flachen Decke und einem langen Hals, über den je nach Art des Instruments unterschiedlich viele Saiten laufen. Die Spannung, Länge und Anzahl der Saiten, die Stimmlage und der Kontext, in dem die Laute gespielt werden soll, bestimmen die Größe des Instruments, wie stark der Bauch gewölbt ist, wie stabil die Konstruktion sein muss und wie die Einzelteile geformt sein müssen. Das erfordert nicht nur viel Erfahrung, sondern auch ein erhebliches geometrisches Wissen, um die Form und Beschaffenheit der einzelnen Teile richtig zu berechnen.“ Ist das aber einmal geschehen, können die Einzelteile auch in Heimarbeit hergestellt werden. Und so kam es, dass die Bauern und Flößer insbesondere in den Wintermonaten die Zeit nutzten und am Herdfeuer im Akkord Gerätschaften und Instrumententeile aus Holz fertigten, um ihr mageres Einkommen aufzubessern. „Die `Lautenspäne´, die wie Orangenscheiben zugeschnitten und über Hitze gebogenen Einzelteile, aus denen der Lautenbach zusammengesetzt wird, sind relativ einfach anzufertigen“, bemerkt Blom in diesem Zusammenhang. Genau darauf spezialisierten sie sich.
Die zu Hause hergestellten Lautenspäne wurden dann entweder von Werkstätten vor Ort in Füssen zusammengebaut oder aber über die Alpen nach Venedig geschickt, wo ausgewanderte Füssener Lautenbauer, die sich dort niedergelassen hatten, sie erst zu verkaufsfertigen Instrumenten zusammen montierten. Denn eine Laute ist ein sensibles, zerbrechliches Instrument, das bereits zusammengebaut nur schwer hätte über die Alpen transportiert werden können, die damals ohnehin noch nicht jene pittoreske Landschaft waren, zu der sie dann später wurden. Noch bis ins 18. Jahrhundert waren es die montes horribilis, die schrecklichen Alpen, wie man sie in der Antike nannte. Von seiner Durchquerung der Westalpen 1666 jedenfalls berichtet der Italiener Sebastiano Locatelli: „Wie ich wünsche, dass ich Worte hätte, um die Schluchten zu beschreiben, die den armen Reisenden umgeben, das Brüllen des Wassers! Das Beängstigendste von allem war, vor uns immer größere Höhen zu sehen, die noch erstiegen werden mussten. Der Gipfel … war mit Wolken verhangen, die sich manchmal lüfteten, dann wieder miteinander rangen, heller wurden, ineinanderflossen und scheinbar gegeneinander und den Gipfel selbst in die Schlacht zogen. (…) Aber unsere Füße traten auf Pfaden, die so hoch oben waren wie die funkelnde Milchstraße selbst, und wir fürchteten jeden Moment, dass wir für unseren Wagemut bestraft und in den Abgrund stürzen würden. Nachdem wir den engen und gewundenen Wegen blind gefolgt waren (die Augen vor lauter Angst zugekniffen), und auf unsere Maultiere vertrauend, die mit diesen Bergen vertraut waren, erreichten wir endlich einen Ort, an dem Frühlingsblumen blühten.“
Mehr als zwei oder drei fertig hergestellte Instrumente gleichzeitig über die Alpen zu befördern, sei es auf dem eigenen Rücken oder auf dem der Maultiere, wäre praktisch nicht möglich gewesen, nicht zuletzt auch deshalb, weil es noch keine ausgebauten oder gar befahrbaren Wege durch das Gebirge gab – die Via Claudia Augusta war im Hochgebirge wohl nichts anderes als ein Trampelpfad. Mit vorgefertigten Lautenspänen allerdings sah die Sache völlig anders aus. Hier hielt sich das Risiko von Beschädigungen und Verlust in Grenzen, das heißt die dünnen und flachen Späne ließen sich, genau wie auch die Decken und Hälse der Lauten, „bequem und sicher flach packen und in großen Mengen“ von Füssen Richtung Venedig über die Alpen transportieren. Die Füssener Heimarbeiter konnten so zeitraubende Vorarbeiten für die Füssener Instrumentenbauer in Venedig übernehmen, die die vorgefertigten Teile nur noch zusammenbauen mussten.
Um 1570 war Lautenträger ein bekannter Beruf in Füssen. Das lag auch daran, dass bis dahin schon zahlreiche Füssener Instrumentenbauer ihre Heimat verlassen mussten. Die meisten von ihnen wählten den Weg über die Alpen, nach Italien, wohin auch der Großteil der halbfertigen Instrumente verkauft wurde und wohin sie bereits Verbindungen hatten: Füssener Lautenbauer werden in den Registern italienischer Innungen bis hinunter nach Sizilien genannt und sind in fast allen norditalienischen Städten nachweisbar, erklärt Blom, besonders aber in Venedig, das in dieser Zeit die Musikgeschichte zweifelsohne prägte. Zu ihnen gehörten so namhafte Instrumentenbauer wie Giorgio und Matteo Sellas, eigentlich Matthäus und Georg Seelos, Söhne des bekannten Mang Sellas (um 1584 geboren), die schon als zwölfjährige nach Venedig aufgebrochen sind, oder auch Zuanne Curci, der 1651 in Füssen als Hanns Kurz geboren wurde und später in Venedig in der Werkstatt des berühmten Matteo Goffriller gearbeitet hat.
Der vielleicht bekannteste Füssener Auswanderer aber dürfte Caspar Tieffenbrucker (1514-1571) gewesen sein. Er wurde in Füssen geboren und wurde hier auch ausgebildet, bevor er sich 1539 auf den Weg nach Norditalien machte, wo er seine Gesellenjahre verbrachte. Nachdem er 1544 nach Füssen zurückgekehrt war und durch Heirat des Bürgerrecht erhalten hatte, hat sich Tieffenbrucker allerdings in Lyon niedergelassen, wo er ab 1553 urkundlich nachweisbar ist. Von Lyon aus verkaufte er seine Instrumente, dessen Teile er Blom zufolge wahrscheinlich noch immer aus Füssen bezog, auf dem ganzen Kontinent. Er gilt dabei als Begründer der französischen Lautenbauschule und war wohl auch einer der ersten Geigenbauer, der dort die Violine in ihrer heutigen Gestalt herstellte, wie Blom schreibt: „Tieffenbrucker dürfte auch einer der ersten Instrumentenbauer gewesen sein, der kleine Violen herstellte, Instrumente, die der heutigen Violine sehr ähnlich sind“, auch wenn keine originalen Instrumente von ihm erhalten sind, sondern nur ein Portrait, dass ihn mit einer solchen modernen Viola zeigt. Der Stich entstand jedenfalls 1548 – also mehr als ein Jahrzehnt, bevor der Cremoneser Meister Andrea Amati (1505-1577), der heute als Vater der modernen Geige gilt, die erste noch erhaltene moderne Geige schuf (die sich heute im Metropolitan Museum of Art befindet). Dass Tieffenbrucker aber noch vor Amati Violinen herstellte, bleibt eine Vermutung.
Andrea Amati, der früheste der berühmten cremonesischen Geigenbauer, soll die elegante Form der Violine erfunden haben. In einer 1576 erstellten Auflistung der Bürger Cremonas wird seine Tätigkeit allerdings ausschließlich mit „de far instrumenti de sonar“ („Herstellung von Musikinstrumenten“) angegeben, was zumindest bezeugt, dass er zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich der einzige in Cremona ansässige Instrumentenbauer gewesen sein dürfte. Ende des Jahres 1577 verstarb Amati, dessen Begräbnis am Heiligen Abend stattfand. Seine beiden Söhne Antonio (geboren 1537/40) und Girolamo (geboren um 1550) übernahmen die Werkstatt, die aber erst unter Girolamos Sohn Nicolò Amati (1586–1684) ihren Höhepunkt erreichen sollte.
Obwohl Andrea Amatis Name zu Lebzeiten auch außerhalb Italiens ein Begriff war, sind heute nur mehr ungefähr 20 Instrumente aus seiner Werkstatt bekannt (die er unter anderem an den Hof von König Karl IX. nach Paris lieferte). Anders als heute wurden bis ins 17. Jahrhundert Violinen, Violen und Violoncelli in unterschiedlichen Größen gefertigt. Auch Amati baute neben einem kleinen Geigenmodell (Korpuslänge etwa 342 Millimeter) ebenso ein großes, das in etwa dem heute üblichen Maß entspricht (353 Millimeter). Er hat so in Stil und Größe den Standard für die Geigenbauer in seiner Nachfolge gesetzt.
Bis dahin gab es alle möglichen Arten von Streichinstrumenten, das heißt zahllose Arten von Fiedeln und mehrsaitigen Violen, von denen einige da braccia, auf Arm und Schulter liegend, und andere da gamba, zwischen den Beinen gehalten, gespielt wurden. Oft hatten diese Vorläufer der Geige sechs Saiten, manchmal sogar mehr, die in unterschiedlichen Intervallen gestimmt waren – je nach Instrumententyp und auch Region. Das aber bedeutete, dass schon eine Tagesreise weit weg alles wieder anders sein konnte, sodass sowohl Musiker als auch Kompositionen immer nur regionale Bedeutung hatten (auch wenn sich in Venedig schon früh der Notendruck durchgesetzt hat und die Lagunenstadt hierin führend war: Ottaviano Petrucci (1466-1539) entwickelte dort ein besonderes Verfahren mit beweglichen Metalltypen zum Drucken mehrstimmiger Musik – er gewissermaßen der erste Musikverleger. 1498 erhielt er von der Stadt Venedig dazu das exklusive Recht. „Das war neu“, erklärt Blom, „und nun konnte man Noten, die bisher nur handschriftlich in wenigen Exemplaren verfügbar waren, leicht verfielfältigen. Venedig wurde zum Zentrum des europäischen Notendrucks. Antonio Gardano war als Nachfolger Petruccis einer der besten und wichtigsten Notendrucker seiner Zeit.“)
Den verschiedenen Violen gegenüber hatten die nun entstandenen Violinen, Bratschen und Celli den enormen Vorteil, dass sie standardisiert waren. Blom bemerkt in diesem Zusammenhang: „Sie hatten vier Saiten, immer in denselben Quintabständen gestimmt. Wer Bratsche spielte, konnte alle Bratschen auf Anhieb spielen, und Musik, die für diese Instrumente geschrieben wurde, konnte auch in einem anderen Land problemlos gelesen und reproduziert werden. Es war ein Erfolg durch Standardisierung. Dazu kam die einfache Tatsache, dass vier Saiten, die aus Schafsdarm gedreht waren und sich bei wechselnder Temperatur und Luftfeuchtigkeit in einem ungeheizten Saal mit Publikum unweigerlich verstimmten, weniger Arbeit beim Nachstimmen bereiten und weniger verstimmte Akkorde produzieren als acht, 16 oder mehr Saiten.“
Für die Geigenbauer, die diesen Prozess, der spätestens mit Andrea Amati einsetzte, miterlebten, boten sich nun natürlich ungeahnte Möglichkeiten, denn die neuen, stets mit nur vier Saiten versehenen Streichinstrumente waren plötzlich überall gefragt. Trotz der Standardisierung verbreitete sich dabei mit den zahlreichen ausgewanderten Handwerker immer auch ihre individuelle Methode, die Instrumente zu konstruieren, ihre Ästhetik, ihre Formensprache, die am neuen Lebensort der Auswanderer oft auf lokale Traditionen und Schönheitsideale traf und entsprechend angepasst wurde. Dabei hatte die Fertigung der Instrumente schon im 16. Jahrhundert „wenig mit der romantischen Idee des authentischen und einsamen Handwerkers zu tun“, wie Blom bemerkt: „Der Füssener Lautenbauer Laux Maler, der 1552 in Bologna starb, hinterließ laut Testament 1.100 fertige Lauten sowie 127 noch nicht vollendete, Hunderte von noch unbearbeiteten Lautendecken und ein ganzes Lager voller Späne für den Korpus und voller anderer Instrumententeile und Saiten, die von Spezialisten aus Schafsdärmen hergestellt worden war. (…) Im Testament von Moisè und Magno Tieffenbrucker in Venedig erschienen 1581 sogar `335 fertige Lauten und 8 Gitarren, 150 Lautenkorpora und 60 unfertige Instrumente (…) 15.200 Eibenspäne, 2.000 Decken, 300 Stege, 600 Hälse, 160 Wirbel´. Näher konnte man im vorindustriellen Zeitalter der Produktion auf industriellem Niveau nicht kommen.“
Dreißigjähriger Krieg und Pestepidemie
Füssen war eine gut vernetzte und durch den Lauten- und Geigenbau auch wohlhabende Stadt, als 1618 der Dreißigjährige Krieg begann. Da die Stadt ohne strategische Bedeutung war, blieb sie vom Kriegsverlauf und von damit verbundenen Kampfhandlungen zunächst verschont, sieht man von der Bedrohung der Handelswege durch umherziehende und marodierende Soldaten ab. So konnten die Instrumentenbauer ihre Werkstätten also zunächst mehr oder weniger unbehelligt weiterführen – und den Handel mit ihren hergestellten Musikinstrumenten sogar noch ausbauen: 27 Laute- und Geigenbauer-Werkstätten zählte man in Füssen jedenfalls im Jahr 1623.
Dann allerdings änderte sich die Lage und der Krieg rückte immer näher heran, wie Blom schreibt: „Die unsicheren Straßen und die immer unsicherer erscheinende Zukunft trafen den Instrumentenhandel wie auch den Holzhandel. Die ersten Menschen verließen ihre Häuser und Höfe in und um Füssen im Jahr 1624, um anderswo ein besseres Leben zu finden. (…) Langsam, aber sich kam der Krieg näher und brach in den Füssener Alltag ein. Soldaten aus den verschiedensten Ländern und Gegenden marschierten durch das Land, hungrige und verlauste Flüchtlinge zogen in Kolonnen des Elends auf der Suche nach Nahrung und Unterschlupf durch die Gegend. Ganze Regionen wurden leergekauft oder geplündert, und die umherwandernden Menschen waren die idealen Überträger von ansteckenden Krankheiten.“
So kam schon 1627 die erste Pestepidemie nach Füssen. Kostete sie zunächst nur einigen Einwohner das Leben, wütete sie drei Jahre Später dann mit voller Wucht. Der Färbermeister Hanns Faigele schrieb während der Kriegsjahre eine private Stadtchronik und notierte in diesem Zusammenhang: „Am 12. November hat allhie die Bestilenz anfachen Regieren …“ Etwa die Hälfte der Füssener Bevölkerung gingen daran zugrunde – die Auswirkungen auf die Stadt waren verheerend. Was der Krieg verschonte, erledigte nun die Seuche: „Nach dem Krieg sollen noch immer 94 der 266 Häuser und Wohnungen in der Stadt unbewohnt gewesen sein“, schreibt Blom, „56 von ihnen baufällig.“ Faigele notiert über diese schreckliche Zeit: „Dieses verflossene Jar send allhie gestorben und vergraben worden Jung und Alt bei 1.600 an der Pestilenz und sonst. Gott sey in gnedig und barmherzig und uns allen.“
Mit dem Zusammenbruch der Stadt kollabierte auch der Instrumentenbau – Die Füssener hatten ihre Instrumente immer für den Export gebaut, aber die Nachfrage brach nun ein, bis kaum ein Meister von seinem Handwerk leben konnte. Außerdem traf der Schwarze Tod hat auch zahlreiche Lautenbauer. Abgesehen vom Geld fehlte es nun überall an Menschen, die das Verlorene hätten wieder aufbauen können. Faigele schreibt dazu 1635: „Von der Fruchtbarkeit dieses Jahres kann ich nichts anderes schreiben, denn es war eine recht gute fruchtbare Zeit, denn es gedieh alles wohl. Aber es gab wenige Leute, die es nützten und einbrachten.“
Und dann blieb in der zweiten Kriegshälfte auch Süddeutschland und die Regionen an Lech und Donau, Füssen selbst, nicht mehr vom Blutvergießen verschont, als sich General Tilly, oberster Heerführer der Katholischen Liga und ab 1630 auch der kaiserlichen Armee, hier gegen die Schweden in Stellung brachte, bevor er 1632 in Ingolstadt ums Leben kam. (Bertolt Brecht lässt seine „Mutter Courage“ am Begräbnis teilnehmen.) Als der Dreißigjährige Krieg 1648 dann schließlich endete, so Blom, „war Füssen, wie viele andere Städte auch, erschöpft, verarmt, teilweise zerstört, entvölkert und massiv traumatisiert“.
Nach Krieg und Pest lebten nur noch etwa 800 Menschen in Füssen. Der Holzhandel kam aufgrund der Verteuerung des alpinen Holzes praktisch zum erliegen, ohnehin aber waren die für den Lautenbau so wichtigen Lärchen, Eiben und Fichten in dieser Zeit schon beinahe abgeholzt. Auch der Markt für Musikinstrumente ist fast völlig eingebrochen – die Menschen hatten andere, existentielle Sorgen. Hinzu kam, dass sich nun auch in Venedig selbst, bis dahin immerhin „der wichtigste Abnehmer für Füssener Instrumente“, wie Blom bemerkt, die Situation gravierend änderte: Etwa 400 Jahre lang, von Anfang des 13. bis zur Mitte des 16. Jahrhunderts, beherrschte Venedig als Seemacht den Handel zwischen Orient und Okzident, es bescherte ihm ein goldenes Zeitalter. Nach der Entdeckung Amerikas im Jahr 1492 und dem Seeweg nach Indien durch den Portugiesen Vasco da Gama im Jahr 1498 sowie den verstärkten Expansionsbestrebungen des Osmanischen Reiches im östlichen Mittelmeer jedoch verlor Venedig im ab dem 16. Jahrhundert langsam seine Vormachtstellung im Orienthandel und insgesamt an Macht und Einfluss.
Ein weiterer Grund für den Niedergang von Venedig war dieselbe Katastrophe, die 1630 so viele Füssener das Leben gekostet hatte: Die Pest verbreitete sich in den Jahren von 1629 bis 1631 rapide und flächendeckend im gesamten Alpenraum und damit auch in Norditalien, nachdem deutsche Soldaten sie dort von Norden aus eingeschleppt hatte. Eine geschätzte Million Menschen kostete sie das Leben: Verona verlor fast zwei Drittel seiner Einwohner, Mailand knapp die Hälfte, und auch Venedig wurde hart getroffen. 46 000 Venezianerinnen und Venezianer wurden in hastig ausgehobenen Massengräbern beigesetzt, ein Drittel der Bevölkerung. „Für die Handelsmetropole besiegelte dieser katastrophale Verlust an Menschen, Arbeitskraft, Expertise und Kaufkraft das Ende ihrer ehemaligen Macht“, bemerkt Blom.
Venedig als Stadt der Musik
Venedig mag politisch an Macht verloren haben – musikalisch aber war die Stadt noch immer eines der tonangebenden Zentren in Europa. Gleichwohl änderte sich in dieser bewegten Zeit, als man „nicht mehr so richtig an die Dogmen und Überlieferungen der Kirche glaubte“, wie Martin Geck in „Die kürzeste Geschichte der Musik“ (2020) schreibt, auch der Musikgeschmack: Wo der Handel eine erfolgreiche bürgerliche Kaufmannsklasse entstehen ließ, sollte auch die Musik die gewonnene Freiheit ausdrücken. So verlangte der aufgeklärte Zeitgeist ungefähr ab 1600, als Ersatz nach neuen musikalischen Formen, die sich fortan an die bürgerliche Gesellschaft richten sollten – und zwar in öffentlichen Räumen wie dem Theater als einer Art Gegenpol zum adligen Palazzo und der Kirche. So entstanden in dieser Zeit mit dem Konzert und der Oper zwei neue Gattungen, die auch den Möglichkeiten der in dieser Zeit entstandenen neuen Streichorchester gerecht wurden.
Lauten sind zwar lyrische, polyphone Instrumente, mit denen auch komplexe musikalische Kompositionen (wie beispielsweise Johann Sebastian Bachs Suite in g-Moll, BWV 995 aus dem Jahr 1727) gespielt und Sänger und Sängerinnen unterstützt werden können – laut sind sie aber nicht. „Ihr zarter Klang“, stellt Blom fest, „ist ideal für einen großen Wohnraum und zur Begleitung einer Gesangsstimme. In den Gewölben einer Kirche oder im Gemurmel eines Theaters aber können sie sich kaum durchsetzen.“ Das änderte sich mit den neu entstandenen Streichinstrumenten, wie Blom schreibt: „Keine Atmosphäre, kein Sound-Effekt, den diese Instrumente nicht schaffen konnten, von flatternden Herzen zu Stürmen auf hoher See, von Vogelgesang bis zu Dudelsack und Jagdhörnern. Sogar zu Mozarts Lebzeiten hatten viele Orchester noch Lautenisten, aber es war klar, dass die Zukunft den brillanteren, facettenreicheren und raumfüllenden Klängen von Celli, Bratschen und Geigen gehörte.“
Die Oper sollte dem Streichorchester zum Durchbruch verhelfen – und Venedig war nicht nur deren Geburtsstadt, sondern auch lange danach noch immer der wichtigste Aufführungsort jener neuen musikalischen Gattung, die womöglich 1607 mit Claudio Monteverdis „L`Orfeo“ das Licht der Welt erblickte (. Monteverdi hat die „Oper“, die diesen Namen damals noch gar nicht hatte, für den Karneval in Mantua komponiert, erst 1613 kommt er als Kapellmeister nach Venedig, nach San Marco (Markusdom), wo er zunächst einen berühmten Chor mit mehr als dreißig Sängern aufbaut, bevor er schließlich als Opernkomponist reüssierte.
Claudio Monteverdi wurde 1567 in Cremona geboren, zehn Jahre vor Andrea Amatis Tod. Nach Venedig wird er berufen, nachdem er in Mantua entlassen worden ist, weil eine in Auftrag gegebene Messe missfallen hatte. So wird aus dem beruflichen Scheitern die Karriere eines der berühmtesten Musiker der Welt, der in Venedig sogar der il divino, der Göttliche, genannt wird, nicht zuletzt, weil er mit seinen Opern Venedig endgültig als Stadt der Musik etabliert: Monteverdi war es, der hier 1637 das erste Opernhaus der Welt, das Teatro San Cassiano, gründete. Es war das erste öffentliche, das heißt allen Bürgern und Bürgerinnen zugängliche Opernhaus und wurde von ihm auf der kommerziellen Grundlage freien Unternehmertums als impresario geleitet.
Monteverdis „L`Orfeo“ stellte sich noch, wie Geck schreibt, „in den Dienst des Dramas“, das heißt hier kam es noch zu einer „perfekte[n] Synthese von Text, Handlung, Szene, Gesang, Tanz und Instrumentalmusik“, es war noch nicht jenes gewaltige, insbesondere von einem Streichorchester getragene Totalerlebnis, zu dem sich die Oper später entwickeln sollte. Dass es soweit kommen sollte, lag insbesondere an dem Zwang, „wirtschaftlich denken und sich gegenüber ständiger Konkurrenz behaupten zu müssen“, wie Geck schreibt. Man musste auf den Geschmack des Publikums achten und das hieß, neben der Vergrößerung des Orchesters, insbesondere, exzellente Sängerinnen und Sänger zu engagieren.
Die große Zeit der sogenannten Da-capo-Arien und der Primadonnen brach an – mit Georg Friedrich Händel (1685-1759) folgten etwas später die ob ihrer Abnormität allseits faszinierenden Kastraten –, wobei es wohl Francesco Cavalli (1602-1676) war, er sang noch im Knabenchor Monteverdis, der die Oper in diesem Sinne populär machte; er war es jedenfalls, der mit seinen Kompositionen den belcanto einführte, also das schöne, melodiöse lamenti.
Dass die Oper so raschen Erfolg hatte, hängt auch mit einer verheerenden Pestepidemie 1630 zusammen, nach der die Zeit der großen Chöre vorbei war, auch jene von San Marco. Das nach der Katastrophe neuerwachte Musikleben ging nicht mehr von den Kirchen, sondern von den Opernhäusern aus. Auf Monteverdis Teatro San Cassiano folgten in den nächsten Jahren rasch sieben weitere Opernhäuser in einer Stadt, die mit etwa 200.000 Einwohnern und Einwohnerinnen bis zum Beginn des 18. Jahrhunderts dann bereits sechzehn Opernbühnen haben sollte.
Neben der Oper aber war das Konzert beziehungsweise concerto die zweite wichtige musikalische Neuerung jener Zeit. Es geht zurück auf Andrea Gabrieli, vor allem aber auf dessen Neffe Giovanni Gabrieli (1554/1557-1612), der noch in San Marco als Organist tätig war, bevor er als Komponist erfolgreich wurde. Dabei hat er eben nicht nur Kirchenmusik komponiert, sondern er gilt auch als Erfinder der Violinsonate, außerdem taucht bei ihm in einer 1587 veröffentlichen Sammlung von Kompositionen auch erstmals das Wort „concerto“ auf. „Konzert“, darauf verweist Martin Geck, wird meist mit „Wettsreit“ übersetzt, weil sich zum Beispiel beim Violinkonzert der Solist mit dem Orchester misst. (Hervorgegangen ist es aber aus dem – im Grunde durchaus geselligen – Streit von zwei Vokalchören, die nicht mehr im Altarraum aufgestellt waren, sondern auf gegenüberliegenden Emporen, wo sie sich – der eine begleitet von Violinen, der andere von Posaunen – wechselseitig zu singen. Martin Geck schreibt in diesem Zusammenhang: „Es ist kein Zufall, dass diese konzertante Mehrchörigkeit ihre erste Blüte im Stadtstaat Venedig erlebt hat. Zum einen steht dort wegen des florierenden Überseehandels so viel Geld zur Verfügung wie nirgendwo sonst; man kann daher problemlos eine größere Truppe von Berufsmusikern bezahlen. Zum anderen bedarf es, um auswärtigen Besuchern zu imponieren, repräsentativer Staatsakte.“)
Giovanni Gabrieli war ein außerordentlich virtuoser Organist – sogar der Deutsche Heinrich Schütz kam als junger Mann auf Wunsch mit einem Stipendium des Landgrafen Moritz von Hessen-Kassel 1609 für drei Jahre nach Venedig um bei ihm zu lernen. Wichtiger für die Musikgeschichte aber ist, dass er als einer der ersten „reine“ Instrumentalmusik geschaffen hat: Einer neuen Druckausgabe von mehrchörigen Vokalkonzerten gibt er, wie Martin Geck bemerkt, „einige Instrumentalkonzerte bei, darunter die berühmte Sonate Pian e forte. Die Bezeichnung `Sonate´ muss in diesem Zusammenhang nicht verwirren: Man wusste anfänglich nicht recht, wie man die neuen Instrumentalstücke überhaupt nennen sollte, und versuchte es auch mit dem Vorschlag `Sonate´, also `Klangstück´.“
Die Bezeichnung Pian e forte trägt zum einen der Tatsache Rechnung, dass neben den Streichinstrumenten gerade auch das Pianoforte, also das Klavier, erfunden wurde, gleichwohl aber verweist Gabrieli mit dieser Namensgebung auf mehr: Denn zweifelsohne ist jede Musik einmal leise, einmal laut – aber er signalisiert damit, wie Geck bemerkt, „dass sein Werk immerhin ein klar herauszuhörendes Thema habe, nämlich den stetigen Wechsel zwischen einem `lauten´ Instrumentenchor und seinem `leisen´ Echo.“ Mit Überschriften wie diesen gibt er dem Zuhörer damit ein gewisses „Programm“ mit auf den Weg, das heißt er kann erst dadurch etwas inhaltliches mit der Sonate assoziieren. Darin aber liegt für Martin Geck auch der Erfolg der neuen Instrumentalmusik begründet – zu denen beispielsweise auch Antonio Vivaldis Violinkonzerte Die vier Jahreszeiten gehören, die „ohne diese Überschrift und ohne ihr programmatisches Eingehen auf die Merkmale von Frühling, Sommer, Herbst und Winter gewiss weniger berühmt geworden (wären)“.
Den Weg den Giovanni Gabrieli eingeschlagen hat, bringt Antonio Vivaldi (1678-1741) dann gewissermaßen zu Ende. Das heißt er hat vielleicht als erster konsequent nicht mehr für eine kirchliche Gemeinde, sondern für ein bürgerliches Publikum komponiert. Eigentlich aber war Vivaldi, wie sein Vater, der in San Marco tätig war, Violinist. Er gab zunächst Geigenunterricht, bevor er dann den Chor in einem der großen ospedali leiten durfte, dem Ospedale della Pietà. Diese ospedali waren ursprünglich karitative Einrichtungen für Bedürftige: Alte, Kranke, Arme und auch für Waisenkinder, zumeist Mädchen, die dort eine musikalische Ausbildung erhielten und dann in den angeschlossenen Kirchenchören bei Messen eingesetzt wurden. Dabei erreichten diese Einrichtungen bald eine solche Qualität, dass man sie vielleicht – aus heutiger Perspektive – als Konservatorien bezeichnen müsste. Jedenfalls wurde sie so berühmt – Goethe zum Beispiel erwähnt sie begeistert in „Italienische Reise“ (Den 3. Oktober) –, dass man aus ganz Europa Schüler zur Ausbildung hierher schickte.
Das Wort „Konservatorium“ kommt von conservare, „bewahren“, und geht zurück auf Bewahranstalten, Waisenhäuser in Neapel, in denen auch Kinder musikalisch ausgebildet wurden. In Venedig sagte man ospedali, weil die Institute an Krankenhäuser angeschlossen waren. Vivaldi baute am Ospedale della Pietà, dem ältesten, 1345 gegründeten ospedale, einen berühmten Mädchenchor mit Orchester auf. Die Mädchen bekamen zu ihren Vornamen den Namen ihres Instrumentes oder ihrer Gesangsstimme – Catarina dal Cornette, Luciana Organista, Maddalena dal Soprano et cetera.
Vivaldi leitete den Chor und das Orchester im Ospedale della Pietà 35 Jahre lang – komponierte aber vor allem auch Konzerte, und zwar Hunderte, und außerdem auch zahllose Opern. 94 Opern habe er komponiert, sagte Vivaldi, 47 davon sind nachzuweisen, für einige hat sogar der damals noch unbekannte Carlo Goldoni die Libretti geschrieben. Ansonsten waren die Konzerte für alle nur denkbaren Soloinstrumente geschrieben. Dass jedoch seine Violinkonzerte besonders bekannt geworden sind, lässt sich nicht zuletzt damit erklären, dass er selbst, wie Martin Geck erklärt, „ein phantastischer Geiger“ war. Das wird auch daran deutlich, dass der Frankfurter Patrizier Johann Friedrich von Uffenbach, der während des Karnevals 1715 in Venedig weilte, geradezu erschrocken über das Spiel des Maestros berichtete: „denn er kahm mit den Fingern nur einen Strohhalm breit an den Steg daß der bogen keinen plaz hatte, und das auf allen 4 saiten mit Fugen und einer geschwindigkeit die unglaublich ist.“ Daran, so Geck, werde deutlich, „wie man damals dem Publikum im Bereich der `reinen´ Instrumentalmusik am besten imponierte: (…) mit viel virtuoser Hexerei. Unter solchen Bedingungen kann selbst das polyphone und mehrgriffige Spiel – Uffenbach spricht etwas übertreibend von `Fugen´ – zur Sensation werden.“
Jacob Stainer
Die Füssener Handwerker konnten sich nach dem Dreißigjährigen Krieg und der Pest nicht mehr an die Veränderungen der von Venedig ausgehenden Musikkultur anpassen. Zwar waren die Lauten, die noch zuletzt hier gebaut wurden, durchweg hochwertig hergestellt – mit aufwändigen Schnitzereien und wertvollen Materiellen – und elegant im Stil, damit aber konnten die Geigen nicht annähernd mithalten: „Instrumente, die nach dem Krieg in Füssen selbst hergestellt wurden, waren häufig sehr rustikal: roh, asymetrisch und improvisiert, grob geschnitten, wie mit stumpfen Werkzeugen und müden Augen, Instrumente, die man im Wirtshaus spielt“, bemerkt Blom in diesem Zusammenhang. Während vor dem Krieg noch mehr als zwanzig Werkstätten in Füssen existierten, waren 1675 nur noch fünf Meister ansässig: Hans, Christoph und Michael Fichtel, Mattheis Aicher und Lucas Socher. Das zeigt deutlich, dass die Nachfrage nach qualitativ gut gemachten Streichinstrumenten für die neue Musik im italienischen Stil offensichtlich nicht vorhanden war.
Auch deshalb verließen zahlreiche Füssener Geigenbauer aus dieser zwischen 1650 und 1680 geborenen Generation die Stadt und gingen nach Italien, wo sie das Handwerk mitbestimmten, wie Blom erklärt: „Unter den Füssenern, die in diesem Umfeld gelernt hatten, um dann nach Italien auszuwandern, waren einige der besten `italienischen´ Meister des frühen 18. Jahrhunderts“. Nach der katastrophalen Pestepidemie hatte sogar Cremona auswärtige Handwerker als Gesellen genommen.
Auch der Tiroler Jacob Stainer (1618-1683), lernte in Italien, sehr wahrscheinlich sogar bei dem großen Nicolò Amati. Aber „Stainer war einer der wenigen, die wieder in die Heimat zurückgingen. In Absam in Tirol schuf er Instrumente, die nördlich der Alpen fast alle anderen Geigenbauer beeinflussten“, schreibt Blom.
Stainer kam im Laufe der Zeit viel herum und ist auf seinen zahlreichen Reisen auch mit den Ideen der Reformation bekannt geworden. Das sollte ihm im erzkatholischen Tirol zum Verhängnis werden, als im Haus des durchaus belesenen Stainers im Zuge einer Durchsuchung indizierte Bücher gefunden wurden, denn der Haller Stadtpfarrer erstattete daraufhin 1668 tatsächlich eine Anzeige wegen Häresie. Stainer wurde von einem bischöflichen Gericht verurteilt, konnte aber zumindest die einem gesellschaftlichen Bann gleichkommende Exkommunikation verhindern.
In dieser von persönlichen Rückschlägen gekennzeichneten Zeit hat sich Stainer auf seine Arbeit konzentriert – und zahlreiche Aufträge aus dem Ausland bearbeitet. Seine Produktivität war vor allem vor dem Hintergrund, dass er allein arbeitete, also ohne Lehrlinge und Gesellen, beachtlich, bis ihm aber eine Krankheit zusehends zu schaffen machte. 1680 wurde in einem kurfürstlichen Rechnungsbuch vermerkt, dass Stainer „ganz sinnlos“ geworden sei, dennoch arbeitete er bis zuletzt.
Anders als Stainer kehrten die aus Füssen ausgewanderten Geigenbauer nicht zurück ins Allgäu – und auch als Zulieferer von Instrumententeilen wurde die Stadt zusehends immer unwichtiger, da Streichinstrumente wesentlich einfacher zu bauen sind als Lauten: sie bestehen aus weniger Teilen und sind insgesamt auch weniger zeitaufwändig in der Herstellung. Grundsätzlich ist zwar auch die Violine ein komplexes Instrument, sie besteht aber nur aus etwa 80 Teilen, die nun jeweils ähnlich arbeitsteilig in den Werkstätten vor Ort hergestellt und zusammengebaut werden.
Die Violine
Jacob Stainers Geigen sind, wie Rudolf Hopfner schreibt, „hochgewölbt und zeichnen sich durch eine besondere Klangqualität aus. Daher zählten sie, neben Nicolò Amatis Instrumenten, bis ins späte 18. Jahrhundert zu den begehrtesten und auch teuersten Streichinstrumenten.“ Erst mit dem Aufkommen von immer mehr Konzertsälen und stark besetzten Orchestern ab dem 19. Jahrhundert setzten sich dann zunehmend die Instrumente Antonio Stradivaris und später auch die von Batolomeo Giuseppe Guarneri „del Gesù“ (1698-1744) durch, die mit etwas längeren Hälsen versehen wurden und ein etwas größeres Tonvolumen hatten, wie Hopfner bemerkt. Die Violinistin Anne-Sophie Mutter erklärt in diesem Zusammenhang über ihre Geige von Stradivari: „Wohl in der unterbewussten Vorahnung, dass sich die Musik aus dem höfischen Zeremoniell in die Demokratie – in die Mitte des Volkes – bewegen würde und damit natürlich auch in größere Räume … Irgendwie hatte er wohl die Vision von, ich weiß nicht, Royal Albert Hall mit siebentausend Zuhörern, denn das Mysterium der Geige ist nicht unbedingt die Größe und die Lautstärke des Klanges, sondern ihre Tragfähigkeit. Es ist auch diese Präsenz im ganz Leisen (…), dass tatsächlich noch im Saal bei Person Nummer 4.000 gehört wird.“
Der Klang einer Geige ergibt sich grundsätzlich über das Resonanz- und Schwingungsvermögen der verwendeten Materialien und Teile. Die Zargen beziehungsweise der Zargenkranz – also die Teile der Seitenwand – verbindet dabei Boden und Decke der Geige. Sie sind entscheidend für den Klang, denn die Schwingungen von Boden und Decke werden über die Zargen übertragen. Je dünner Boden und Decke aus dem Ausgangsmaterial gearbeitet sind, desto dunkler ist gemeinhin der Ton.
Der Bassbalken im Inneren des Instruments verteilt die Schwingungen dabei gleichmäßig auf die Decke: Ohne ihn würde der untere Bereich der Decke gegenläufig zum oberen Bereich schwingen, der Knotenpunkt dabei liegt genau beim sogenannten Stimmstock. Der Bassbalken gleicht diese gegenläufigen Schwingen jedoch aus, sodass die Decke eine harmonische Schwingungsbewegung ausführt. Seine Gestaltung wirkt sich erheblich auf den Klang des Instrumentes aus. Gewöhnlich hat der etwa über zwei Drittel der Länge des Korpus verlaufende, nur wenige Millimeter breite und etwa einen Zentimeter hohe Bassbalken seinen höchsten Punkt, dort, wo sich der Steg befindet, und läuft an seinen beiden Seiten geschwungen aus.
Der Korpus ist der Resonanzkörper der Geige. Dieser Hohlkörper verstärkt die Schwingungen eines Tons und damit den Klang. Durch die sogenannten f-Löcher, die aus der Decke herausgeschnitten werden, kann der Schall aus dem Korpus heraustreten.
Zum Schutz vor Rissen wird am Rand des Bodens und der Decke der schmale, nur wenige Millimeter dicke sogenannte Einlegespan aus einem hellen Ahornstreifen, der von zwei dunklen Ebenholzstreifen umgeben ist, wie eine Intarsie eingearbeitet. Aus dem harten Ebenholz gefertigt sind auch das auf dem Hals der Geige befestigte Griffbrett sowie die vier Wirbel des in den Hals eingearbeiteten Wirkbelkastens unterhalb der Schnecke am Kopf des Instruments.
Neben dem Bassbalken ist auch der Stimmstock entscheidend für den Klang einer Geige. Er besteht aus einem runden Fichtenstäbchen mit etwa 6 Millimeter Durchmesser, das ungefähr an der breitesten Stelle des Bassbalkens zwischen Boden und Decke eingesetzt, das heißt eingeklemmt wird. Der Stimmstock überträgt die Schwingen von der Decke auf den Boden. Durch seine Positionierung kann die Spannung eines Korpus verändert werden – mehr oder weniger Spannung – und dadurch auch der Klang eines Instruments.
Die Grundierung (ein Gemisch aus Silikat- und einigen Harzanteilen, das das Holz härtet und die Poren verschließt) und die anschließende Lackierung einer unbearbeiteten Geige – bis zu zehn Schichten werden aufgetragen – verändert noch einmal den Klang eines Instruments: Die Lackierung bremst die Schwingungen des Holzes, sie darf sie aber nicht dämpfen
Beim Geigenbau wird zuletzt der Steg auf dem ansonsten fertigen Instrument angepasst. Auch er wird, wie der Stimmstock, nicht mit dem Instrument verleimt, sondern quasi zwischen den Saiten und dem Korpus eingeklemmt. Der Steg überträgt so die Schwingungen der Saiten (mit den Tönen E, A, D und G) auf den Korpus. Die Saiten werden heutzutage nicht mehr aus Schafsdarm hergestellt, sondern aus verschiedenen Materialien: sie bestehen aus einem Kern und einer Umspinnung, wobei der Kern bisweilen aus Kunststoff ist und die Umspinnung aus Aluminium oder Silber. Die E-Saite ist die dünnste Saite und besteht meistens aus Stahl. Gegenüber der Darmsaite hat die Kunststoffsaite den Vorteil, dass sie die Stimmung länger hält und sich nicht mehr so schnell verstimmt. Gegenüber Saiten mit einem Stahlkern haben sie einen etwas wärmeren Klang.
Auch der Bogen beeinflusst den Klang eines Instruments enorm, Bogenmacher aber ist ein eigenständiger Beruf – er wird nicht in der Geigenbauwerkstatt gefertigt. Der Bogen besteht bisweilen aus einem Edelholz wie dem brasilianischen Fernambuk, und ist mit Pferdehaaren bezogen. Ein guter Bogen sollte die Schwingung der Saite sofort übernehmen.
War Jacob Stainer noch alleine tätig, spezialisierten sich die Handwerker in den vielen Werkstätten nach ihm auf einzelne Arbeitsschritte wie das Biegen der Zargen, das Schnitzen von Boden und Decke, das Schnitzen der Schnecken, das Schneiden der f-Löcher oder das Grundieren und Lackieren des Holzes. So konnten alle Lehrlinge und Gesellen einer Werkstatt an einem Instrument beteiligt sein, das dann doch nur den Namen des Meisters und Besitzers trug. Gleichzeitig aber blieb jetzt der gesamte Fertigungsprozess in einer Werkstatt, die ein Instrument vom Holzscheit bis zur letzten Politur fertigstellte. Das galt auch für die Werkstatt des wohl bekanntesten Geigenbauers überhaupt: Antonio Stradivari.
Antonio Stradivari und seine Werkstatt
Cremona in Oberitalien, etwa 30 Kilometer südlich der Alpen bei Brescia gelegen – hier wurde Antonio Stradivari 1644 geboren. Über seine Ausbildung ist wenig bekannt. Man ging früher davon aus, dass er bei Nicolò Amati gelernt hat, inzwischen aber wird auch eine Lehre als Holzschnitzer in Betracht gezogen. Das älteste erhaltene Dokument in Zusammenhang mit Stradivari betrifft jedenfalls seine Eheschließung im Jahr 1667. Wenig später bezog das Paar ein Haus mit Werkstätte im Zentrum Cremonas.
Als Stradivari dort mit dem Bau eigener Geigen begann, stand er in einer Tradition, deren Maßstabe für den Zuschnitt der Decke, des Bodens und des Wirbelkastens von Streichinstrumenten Andrea Amati ein Jahrhundert zuvor gesetzt hatte. Spätere Geigenbauer – die natürlich immer auch andere Streichinstrumente hergestellt haben – hielten sich an die von den Meistern in Cremona und deren österreichischem Nachbarn Jacob Stainer gesetzten Maßstäben, die sich in den Anfangsjahren des Geigenbaus in Norditalien trafen und auch vermischten.
Wer nicht direkt von diesen Meistern oder ihren Schülern ausgebildet wurde, lernte durch die Reparatur ihrer alten Instrumente, wie Richard Sennett in „Handwerk“ (2008) schreibt: „Die technische Ausbildung basierte auf direktem Umgang mit den Instrumenten und einer direkten Anleitung, die mündlich von Generation zu Generation weitergegeben wurde. Der junge Geigenbauer hatte eine Original-Amati in Händen, die er nachbaute oder reparierte. Das war die Methode des Wissenstransfers, die Stradivari erbte.“
Wie schon in den Werkstätten vor ihm, war auch Stradivaris Werkstatt zugleich Schlaf- und Arbeitsplatz für die Familie Stradivaris wie für seine Lehrlinge und Gesellen. Die Arbeit beherrschte den Tagesablauf, das heißt von Tagesanbruch bis zur Abenddämmerung wurde in der Werkstatt gearbeitet, während die unverheirateten Lehrlingen und Gesellen und Stradivaris Söhne nachts auf Strohsäcken unter den Werkbänken übernachten.
Die Herstellung der Streichinstrumente erfolgte arbeitsteilig: Die jüngsten Lehrlinge hatten „vorbereitende Arbeiten wie das Einweichen des Holzes in Wasser, den groben Zuschnitt und das grobe Vorformen“ zu erledigen, während die erfahreneren Gesellen „feinere Arbeiten wie den Zuschnitt der Decke oder den Zusammenbau des Halses“ übernahmen und Stradivari selbst „den endgültigen Zusammenbau“ vornahm und den Firnis auftrug, also die schützende Lackschicht, die nach Meinung mancher Experten den Klang des Instruments wesentlich bestimmen soll. Stradivari war allerdings, wie Sennett betont, „in allen Phasen des Herstellungsprozesses präsent“ und dabei bisweilen „ein herrischer, zuweilen sogar tyrannischer Charakter, der seinen Launen gelegentlich auf spektakuläre Weise freien Lauf ließ und nicht mit Anweisungen oder Ermahnungen sparte“.
Stradivaris älteste erhaltene Geige stammt aus dem Jahr 1666, gerade aus dem ersten Jahrzehnt seiner Werkstatt sind jedoch nur wenige weitere Instrumente erhalten geblieben. Erschwerend kommt hinzu, so schreibt Rudolf Hopfner, dass „bei den meisten dieser frühen Geigen die Zettel manipuliert oder entfernt (wurden). Instrumente aus seiner frühen Schaffensperiode zeigen Stilmerkmale Amatis auf, sind jedoch hinsichtlich des verwendeten Modells und der Wölbungsform uneinheitlich. Offensichtlich experimentierte Stradivari in dieser Phase seines Schaffens, indem er unterschiedliche Parameter variierte.“
Nachdem sich Stradivari 1680 mit seiner Werkstatt an der zentral gelegenen Piazza di San Domenico, in der Nähe der Werkstätten von Guarneri und Amati, niedergelassen hatte, experimentierte er ab 1690, so Hopfner, „mit einem Korpusmodell, das um einige Millimeter über dem Standard lag und als long pattern bezeichnet wird. Ab 1700 erreichte Stradivaris Werkstatt ihren qualitativen Höhepunkt. Das von da an vorherrschende breite Modell mit einer sehr vollen Wölbung mittlerer Höhe ist sowohl in ästhetischer Hinsicht als auch klanglich optimal; wohl auch wegen des hervorragenden Tonholzes, das Stradivari zu dieser Zeit zur Verfügung gestanden ist.“
Die Produktivität der Werkstatt stieg, nachdem die beiden Söhne Stradivaris, Francesco (geboren 1671) und Omobono (geboren 1679), ihre Ausbildung abgeschlossen hatten. Man bezeichnet diese Zeit zwischen 1690 und 1720 auch als die Goldene Periode. Die danach gebauten Instrumente wirken hingegen häufig „sehr kräftig, haben breitere Ränder und eine schwach ausgebildete Hohlkehle“, so Hopfner, der aber betont, dass auch diese späten Instrumente, wenn man „von geringfügigen altersbedingten Unsicherheiten in handwerklicher Hinsicht“ absieht, „großes klangliches Potential“ besitzen.
Stradivaris Werkstatt, die schon der Neuzeit nahe steht, wie Richard Sennett bemerkt, unterschied sich von mittelalterlichen Werkstätten insbesondere dadurch, dass er auf dem offenen Markt auftrat und sich nicht auf einige wenige Gönner beschränkte. Fauto Cacciatori, Kurator des Museo del Violino in Cremona, erklärt in diesem Zusammenhang: „Zweifelsohne führte Stradivari ein vielbeschäftigtes Leben und vermehrte seinen Wohlstand kontinuierlich. Er hatte in Cremona die bedeutendsten Persönlichkeiten als Auftraggeber – adlige Auftraggeber, die schon zu seinen Lebzeiten Unsummen für seine Instrumente bezahlten. Schritt für Schritt begannen andere ihm nachzueifern. Zweifellos: Er war schon damals ein berühmter Mann.“
Schon zu Stradivaris Zeit war die handwerkliche Produktion dabei auf die Herstellung von Markenerzeugnissen ausgerichtet: Der Name Stradivari stand lange für Qualität – und seine Erfolge setzten schon früh die anderen Geigenbauer in Cremona unter Druck. Mit Blick auf die von Andrea Guarneri (1623-1698) gegründete Geigenbauwerkstatt von Bartolomeo Giuseppe Guarneri, genannt „del Gesù“, in der Nachbarschaft von Stradivari schreibt Richard Sennett: Del Gesù „arbeitete in Stradivaris Schatten. `Im Gegensatz zu Antonio Stradivaris umfangreicher internationaler Klientel´, so schreibt Guarneris Biograph, `bestand seine Kundschaft hauptsächlich aus … einfachen Cremoneser Musikern, die in Palästen und Kirchen in und um Cremona´ spielten. Obwohl del Gesù in seinen Fähigkeiten nicht hinter Stradivari zurückstand, konnte er seine Werkstatt nur fünfzehn Jahre halten. Und noch größere Schwierigkeiten hatte er, seine besten Lehrlinge zu halten.“
Aber auch Stradivari hatte nach dem Ende der sogenannten Goldenen Periode Probleme, sich zu behaupten. Sennett schreibt in diesem Zusammenhang: „Die Zahl der Geigenbauer und der hergestellten Instrumente hatte sich zu Stradivaris Zeiten beträchtlich vergrößert. Das Angebot begann die Nachfrage zu übersteigen. Selbst Stradivari, der schon früh Berühmtheit erlangte, musste sich Sorgen um seinen Absatz machen, denn er hatte es mit einer Vielzahl privater Kunden zu tun, und diese Marktpatronage erwies sich vor allem gegen Ende seines langen Lebens als unbeständig. Während des allgemeinen wirtschaftlichen Niedergangs der 1720er Jahre musste seine Werkstatt die Kosten senken, und ein großer Teil der Produktion wanderte ins Lager. Die Risse in der Werkstatthierarchie verbreiterten sich aufgrund der Unsicherheit des offenen Marktes. (…) Der offene Markt verringerte den zeitlichen Rahmen für die Herrschaft des Meisters.“
Schon 1727 kaufte Stradivari eine Grabstätte in der Basilika San Domenico und regelte die Aufteilung seines beträchtlichen Vermögens. Im März 1737 starb seine zweite Frau Antonia im Alter von 72 Jahren, er selbst folgte ihr schließlich im Dezember desselben Jahres. Stradivari wurde über 90 Jahre alt – bis in sein letztes Lebensjahr hinein blieb er im Geigenbau aktiv.
Man hat Stradivari zum berühmtesten Geigenbauer aller Zeiten erhoben. Das hat, erklärt Rudolf Hopfner, „gleichermaßen mit seiner langen Schaffenszeit, den zahlreichen erhaltenen Instrumenten, der stilistischen Konstanz seiner Arbeiten, der hohen Ästhetik und – vor allem – dem klanglichen Potenzial seiner Instrumente zu tun. Alle bis heute erhaltenen Violinen, Violen und Violoncelli Stradivaris wurden im Lauf der Zeit baulich verändert. Sie erhielten längere und stärker geneigte Hälse sowie längere Bassbalken. In Verbindung mit dem heute verwendeten Saitenmaterial, das höhere Spannung erlaubt als die ursprünglich verwendeten Darmsaiten, besitzen diese Instrumente eine Klangfülle und ein Timbre, das sie zu idealen Konzertinstrumenten macht.“
Mit Stradivari wurde Cremona zum Zentrum des Geigenbaus – heute gibt es dort 150 Geigenbauwerkstätten –, wobei er selbst als bedeutendster Geigenbauer der Geschichte und seine Instrumente nach wie vor als unübertroffen gelten. Das aber ist mehr Fluch als Segen, wie Richard Sennett bemerkt: Denn als Antonio Stradivari starb, stirbt mit ihm auch sein Wissen. Er übergab das Geschäft zwar an seine Söhne, die „noch mehrere Jahre Nutzen aus dem Namen Stradivari zu schlagen (vermochten), doch dann ging das Unternehmen zugrunde. Er hatte sie nicht gelehrt und sie nicht lehren können, Genies zu sein.“
Mythos Stradivari
Über 1.000 Instrumente soll Stradivari in seiner Werkstatt hergestellt haben, von denen heute noch, je nach Quelle, etwa 500 bis 650 erhalten sind. Nicht zuletzt aufgrund des beschränkten Angebots ist um sie ist ein regelrechter Mythos entstanden – durch den Stradivaris, im Englischen oft auch einfach „Strads“ genannt, zu den teuersten Instrumenten der Welt geworden sind, zu wahren Investments, sodass die Instrumente anstatt bei den Musikern und Musikerinnen in irgendwelchen wohltemperierten Safes landen. An den Auktionsbörsen wie dem Tarisio, einem der ersten, das sich auf Streichinstrumente spezialisiert hat, werden inzwischen Preise im zweistelligen Millionenbereich für eine Stradivari erzielt, zuletzt waren es sogar über 15 Millionen Dollar.
Kein Wunder, dass kein anderer Geigenbauer so oft gefälscht worden ist wie Stradivari – und von keinem öfter als von dem Deutschen Dietmar Machold. Mit Echtheitszertifikaten und Garantien, die er selbst erstellte, machte er Millionen. (Ansonsten sind Gutachter für Streichinstrumente ohnehin rar und ein eher verschwiegenes Kartell, deren Urteil kaum anzufechten ist.) Das väterliche Stammgeschäft in Bremen war Machold bald zu klein, sodass er von einem Schloss bei Wien aus, das wohl Seriosität ausstrahlen sollte, Filialen in der ganzen Welt gründete und dabei vornehmlich mit Foundations und Banken handelte, weil Händler seine Instrumente eher nicht gekauft hätten. Schlussendlich konnte er überführt und zu sechs Jahren Gefängnis verurteilt werden.
Dass es überhaupt Fälschungen gibt, liegt daran, dass es seit nahezu dreihundert Jahren nicht gelungen ist, dem Geheimnis der Stradivaris auf die Spur zu kommen – er scheint es mit ins Grab genommen zu haben. Worin aber besteht dieses Geheimnis? Was macht diese Violinen so unübertroffen? An der Perfektion seiner Instrumente arbeitete Stradivari akribisch, experimentierte mit verschiedenen Formen, Größen und Materialien – immer mit dem Ziel, den idealen Klang zu erreichen. Und tatsächlich zeichnen sich seine Instrumente auch durch eine außergewöhnliche Klangqualität aus. Um der auf die Spur zu kommen, analysiert man die Geigen Stradivaris und konzentriert sich dabei vor allem auf folgende Aspekte: manche versuchen, exakte Nachbauten der Stradivaris herzustellen (die aber nur einen Bruchteil kosten), wie beispielsweise der New Yorker Geigenbauer Samuel Zygmuntowicz für den Violinisten Isaac Stern (1920-2001); andere sehen das Geheimnis in der Lackierung und versuchen deshalb, die Firnis der Instrumente chemisch zu analysieren; wieder andere bemühen sich um eine Rekonstruktion auf der Basis des Klangs, wobei es hier nicht um eine Nachahmung der Form und Konstruktion geht.
Im Hinblick auf die Lackierung sagt man, Stradivari habe einen Lack aus Öl verwendet, unter anderem mit Pigmenten, Kurkuma und Gummigutta gemischt. Bis heute aber ist es nicht gelungen, seine Rezeptur zu analysieren, das heißt man kennt sein Rezept genauso wenig wie die Rezepturen der andern italienischen Meister. Außerdem sind die 8 bis 10 Schichten Lack, die Stradivari bei seinen Instrumenten aufgetragen hat, bei den meisten Geigen heute mitunter komplett abgerieben oder sie wurden zwischenzeitlich ohnehin neu lackiert. Vom Lack lassen sich insofern bislang keine direkten Rückschlüsse auf die Klangqualität eines Instruments machen.
Die Geige ist ein komplexes Instrument und gibt sein Klanggeheimnis nicht so ohne weiteres preis. Manche behaupten, dass die Klangqualitäten einer Stradivari auf dem verwendeten Holz beruhen, das Stradivari im Wald von Tarvisio gefunden hat. Für den Geigenbau braucht man vor allem das Holz von Fichten und Ahorn, dazu Obstbaumholz; ursprünglich nahm man meistens Birnenholz. Stradivari verwendete weiches Fichtenholz, das für eher weichere Töne sorgt, für die Decke und den im Inneren des Korpus in die Deckenwölbung eingepassten Bassbalken, und hartes Ahornholz für Boden, Zarge und die Schnecke. Hartholz wie Ahorn ist für den Instrumentenboden wichtig, weil es für Klänge mit einer Obertonpalette sorgt.
Besonders geschätzt im Instrumentenbau ist Holz, das von langsam gewachsenen Fichten stammt: Sie wuchsen in den Alpenwäldern auf mageren und mineralstoffarmem Untergrund mit einem geringen Wassergehalt, etwa auf Steilhängen des Gebirges. Folglich ist ihr Wachstum langsam und die Jahresginge in sehr engen Abständen ausgebildet, ihre Ausrichtung viel gleichmäßiger, kompakter und dichter. Grundsätzlich kann man von den Jahresringen eines Baumes auf die mechanischen Eigenschaften eines Holzes schließen. Die besten Bäume wachsen in Norditalien heute an Hängen, die nach Norden gerichtet sind, denn Bäume, die viel Sonne einfangen, bilden gemeinhin mehr Harztaschen aus und haben deshalb mehr Hohlräume.
Besonders gering war der Holzzuwachs von Fichten, die im späten Mittelalter und in der frühen Neuzeit wuchsen, im kühlen Klima der Kleine Eiszeit. Diese Bäume konnte man im 17. und 18. Jahrhundert schlagen, also genau in der Zeit der Goldenen Periode von Stradivari. Die Bäume, die Stradivari verwendete, waren insofern lange Zeit winterlicher Kälte ausgesetzt. Gewachsen ist so ein massives Holz mit unvergleichlichen Klangeigenschaften, so glauben manche – gleichwohl aber hatten nicht alle Geigenbauer zur Zeit Stradivaris den selben Erfolg. Man geht deshalb davon aus, dass die lange Trockenzeit der Hölzer die Güte einer Stradivari ausmachen: Stradivari habe mit sehr trockenen Hölzern gearbeitet. Allerdings haben Untersuchungen ergeben, dass die Hölzer tatsächlich nicht wie bisher angenommen bis zu 60-70 Jahre getrocknet sind, sondern nur etwa 20 Jahre, sodass also auch diese These keine eindeutigen Ergebnisse bringt.
Auch wenn es anhand der Breite der Jahresringe des verwendeten Holzes wohl möglich ist, Fälschungen zu erkennen, weil das Klima, wie Hansjörg Küster in „Die Alpen“ (2020) schreibt, sich seit der frühen Neuzeit verbesserte und die Bäume schneller wuchsen – was in allen diesen Analysen, das heißt der Analyse der Firnis oder der des Holzes, fehlt, so Richard Sennett, ist jedoch „eine Rekonstruktion der Werkstätten dieser Meister – oder genauer, es fehlt ein Element, das unwiederbringlich verloren ist: die Allgegenwart des stillschweigenden, unausgesprochenen und nicht in Worte gefassten Wissens, das dort zur Gewohnheit wurde und in den tausend alltäglichen Bewegungen steckte, die in ihrer Summe eine bestimmte Praxis ausmachen. Die wichtigste Tatsache, die wir im Blick auf Stradivaris Werkstatt kennen, ist der Umstand, dass er überall unerwartet auftauchen konnte und die unzähligen Bits an Informationen sammelte und verarbeitete, die für seine mit Teilarbeiten beschäftigten Gehilfen nicht dieselbe Bedeutung haben konnten.“ Sennett spricht in diesem Zusammenhang auch von Kultur: „Hochspezialisierte Fertigkeiten bestehen nicht einfach aus einer Liste von Verfahren, sondern aus einer ganzen Kultur, die sich um solche Fertigkeiten gebildet hat.“
Das Wissen Stradivaris, so Sennett, das gewissermaßen definiert, was eine Violine sein kann, ist mit dem Tod des Meisters verloren (Sennett bezeichnet das auch als „Stradivari-Syndrom“), das heißt die qualitativ hochwertige Arbeit gründete hier ganz im impliziten Wissen Stradivaris und lässt sich nach dessen Tod nicht mehr rekonstruieren. „Obwohl man Unsummen an Geld ausgab und zahllose Experimente durchführte, ist es nicht gelungen, die Geheimnisse dieser Meister zu lüften. Etwas am Charakter ihrer Werkstätten muss den Wissenstransfer verhindert haben“, schreibt Sennett. Man kann insofern also sagen, dass es nicht möglich ist, den spezifischen Klang eines Instruments zu rekonstruieren. Andererseits aber, das zeigen neuere Untersuchungen von Akustikern, kann man auch nicht heraushören, aus welcher Form ein Klang kommt. Es gibt insofern keine Idealform – und eine Stradivari anhand ihres Klangs zu identifizieren ist insofern praktisch auch unmöglich. Selbst Experten scheitern an solchen Versuchen.
Außerdem ist es wohl auch so, wie Philipp Blom einen Geigenbauer anonym zitiert, dass es einfach nicht den Stradivari-Klang gibt, das heißt all das ist „reiner Unsinn. Diese Instrumente sind großartig, aber wie sie wirklich klingen, hängt von so vielen verschiedenen Faktoren ab: ob und wie eingreifend und wie kompetent sie über die Jahrhunderte repariert oder restauriert wurden, ob der Lack original ist, ob jemand neue Einlagen gemacht oder Boden und Decke weiter ausgehobelt oder, im Gegenteil, weiter verstärkt hat, wie hoch der Steg und wie er geschnitten ist, wie die Stimme eingestellt ist, was für ein Bassbalken drin ist, welche Saiten drauf sind, wie hoch die Luftfeuchtigkeit gerade ist, und wer sie spielt. Die Leute versuchen, das zu objektivieren mit allen möglichen wissenschaftlichen Methoden, Schwingungsmessungen und Spielautomaten, aber letztendlich ist die objektive Klangqualität eines Instruments gar nicht so interessant, denn es klingt ja erst durch das sehr subjektive Zusammentreffen mit einem Musiker, der auf seine Möglichkeiten und Anforderungen auf eine bestimmte, subtile und sehr persönliche Weise reagiert.“
Die damals 27jährige Anne-Sophie Mutter bemerkte in Zusammenhang mit der Beziehung zu ihrem Instrument in der Dokumentation „Anne-Sophie Mutter – Musik ist wie eine Droge“ (1991) einmal: „Ich war immer wahnsinnig fixiert auf eine Geige, und es hat mir schon von klein auf richtiggehend weh getan mich von einer Geige zu trennen. Eine Geige ist ja immerhin auch ein Teil von einem selbst, mit dem man lebt viele Jahre, in das man so unglaublich viele Emotionen legt. Und man trennt sich nur sehr schwer von einem Teil seines Lebens. Ich würde sicherlich zu allerletzt eine Geige verkaufen, wenn ich nur noch ein Hemd hätte – die Geige würde mich sicherlich bleiben müssen.“
Dann aber gibt sie ihre Violine von Alessandro Gagliano (1665–1732) doch zugunsten ihrer ersten Stradivari, der „Emiliani“ von 1703, auf, zu der sie sagt: „Diese Stradiviari, die erste von 1703, hat mir die Möglichkeiten eröffnet, mich von den Klangfarben her weiter zu entwickeln. Ich hatte vorher eine Gagliano, ein sehr schönes Instrument, aber halt ein bisschen begrenzt – sie war recht laut, hat gut getragen, aber mehr war da nicht drin. Die Geige an sich hatte keine große Persönlichkeit, die mich bereichert hätte, die mich auch gefordert hätte. Eine Stradivari ist ja ein ganz verzwicktes Gerät: sie ist sehr verschlossen in sich – es dauert lange Zeit, bis man wirklich den Ansatzpunkt gefunden hat, bis man auch so vertraut ist mit dem Instrument, so verwachsen, das man sich – gegenseitig, würde ich sagen, denn die Geige verändert sich ja auch, durch den der darauf spielt, und umgekehrt: man verändert sich, indem man das, was die Geige schon zu bieten hat, eingeht. Und das ist eine sehr, sehr wichtige Partnerschaft. Nur nach kurzer Zeit – nach drei, vier Jahren – habe ich bei der ersten Stradivari bemerkt, dass ich inzwischen schon so weit war in meinem inneren Ohr, klanglich, so weit entwickelt, dass ich mich auf der Geige nicht mehr habe ausdrücken können. (…) Sie hatte nicht die Klangfarben und auch nicht die Klanggröße, die Größe des Klanges. Es war dieser `Edge´, diesen Biss, den ich gesucht habe – und den hatte ich nicht auf der `Emiliani´. Diese Geige ist wunderschön, ist vielleicht sogar, was die Qualität des Klanges angeht, noch runder, noch dunkler, aber sie hat halt diesen Biss nicht, dieses, nicht Stählerne, aber dieses Lauernde – zwar unter der vollen, dunklen Färbung liegend, aber es muss noch ein bisschen so wie ein Drahtseil drunter sein.“
So hat sie schließlich sogar noch eine zweite Stradivari erworben, die „Lord Dunraven“ von 1710 – also genau wie die erste aus der Goldenen Periode –, zur der sagt sie: „Die ist natürlich noch besser im Sinn von weiter entwickelt: der Klang ist größer von der `Lord Dunraven´ und was Stradivaris ja ganz besonders auszeichnet, ist ihre Tragkraft. Das hat weniger zu tun mit der Lautstärke, die man darauf erreichen kann, sondern eigentlich mehr mit der Projektionskraft. Das heißt, wenn ich auf der Lord Dunraven ein Pianissimo hauche, kann ich sicher sein, dass man es auch bei 5.000 Sitzen ganz hinten noch hört. Es kann noch so Pianissimo sein, aber es ist immer eine Substanz da, es verschwindet nie im Nichts, es wird also nie Bedeutungslos, der Klang. Ich meine, das ist natürlich auch eine Frage der Vibratotechnik und so weiter, aber die Geige an sich hat schon diese Stimme, die man natürlich wissen muss, wie man sie erweckt.“
Damit auch junge Musikerinnen und Musiker sich an solch außergewöhnlichen Violinen erproben können, stellt ihnen Anne-Sophie Mutter mit ihrer Stiftung alte Instrumente zu Verfügung. Denn wer wenn nicht sie wüßte, wie sie in dem aktuellen Portrait „Anne-Sophie Mutter – Vivace“ (2023) sagt: „Ehre, Freude, Privileg – all of the above. Aber meinen Sie nicht (…), dass so eine Geige leicht zu spielen wäre. Und so ist diese Auseinandersetzung mit dieser komplexen Persönlichkeit Stradivari immer wieder eine Bereicherung, aber auch eine große Herausforderung. Letzten Endes – das ist jetzt mein Schluß nach fast 45 Jahren Zusammenleben mit einer Stradivari – scheinen diese Geigen tatsächlich alles in sich zu tragen, aber man lernt an ihnen, ein kompletterer Musiker zu werden.“
Bachs Suiten für Violine solo
Johann Sebastian Bach (1685-1750) besaß keine Stradivari, aber doch war „sein erstes Instrument wahrscheinlich die Geige“, bemerkt Philipp Blom. Für sie jedenfalls hat er mit seinen Sonaten und Partiten für Violine solo, im Originaltitel „Sei Solo a Violino senza Basso accompagnato“ (BWV 1001-1006) im Jahr 1720, zum Abschluss der Goldenen Periode Stradivaris gewissermaßen, als erster alle Möglichkeiten des Instruments – nicht nur in technischer, sondern auch hinsichtlich des Ausdrucks – kompositorisch in Perfektion ausgelotet.
Dabei war auch Bach, wie Blom ausführt, zuerst ein „musikalischer Handwerker“, wenngleich er aufgrund der Tätigkeit seines Vaters als Stadpfeifer wohl kaum hungern musste wie die Füssener Bauern in ihren schlimmsten Zeiten. Gleichwohl aber ist sein Vater früh gestorben – und so kam Johann Sebastian zu einem älteren Bruder, der ihm die Violine gewissermaßen abnahm und ihn in Orgel und Tonsatz unterrichtete. Bach wurde bald zu einem wahren Orgelvirtuose.
Bach hat niemals formal Komposition studiert, sondern sich sein musikalisches Wissen, wie Blom schreibt, immer immer „angeeignet, wie es Handwerker häufig taten: durch Kopieren und Imitieren und Weiterentwickeln und Üben“ der Werke anderer Komponisten. Er begreift sich dabei, durchaus der Auffassung seiner Zeit entsprechend nicht als Künstler sonder als Handwerker. Seine Kompositionen sind jedenfalls fast immer zweckgebunden und erfüllen eine bestimmte Funktion – sei es bei öffentlichen Ereignissen oder im Gottesdienst. Dort fungieren seine Kompositionen als eine Lobpreisung Gottes, der nach der Vorstellung des tief im christlichen Glauben verwurzelten Bach die von ihm angewandten musikalischen Ordnungen geschaffen habe. Fast alle seine Werke unterzeichnet Bach mit Formeln wie „Soli Deo Gratia“ (allein zur Ehre Gottes).
Spezialisierte Handwerker wie es Bach als Orgelvirtuose war, sind gezwungen auf die Walz zu gehen – also dorthin zu wandern, wo es Arbeit für sie gibt –, denn der Markt für Komponisten war, wie der für Geigenbauer, begrenzt. So entstand gewissermaßen auch Bachs „Handschrift“, wie Blom schreibt, das heißt sie „entstand aus einer Mischung regionaler Traditionen, historischer Überlieferung und internationaler Einflüsse, die er sich über zirkulierende, oft handschriftlich kopierte Noten aneignete, und durch das Zuhören bei großen Improvisatoren“, denen er auf seinen Wanderungen begegnete. Dabei lernte Bach auch Änderungen im musikalischen Geschmack kennen – der nun zunehmend von Venedig bestimmt werden sollte. Kompositionen von dort kamen zu Bachs Zeit in Mode und wurden überall studiert und gespielt, auch von ihm selbst.
Aus Venedig kam wohl auch die Inspiration für seinen Violinzyklus aus Sonaten und Partiten. Als noch unbekannter Komponist war er wohl fasziniert von den neuen Streichinstrumenten und dem Pianoforte – und „von der Idee, die technischen und vor allem die harmonischen und polyphonen Möglichkeiten der Tasten- und Streichinstrumente, die er selbst auch beherrschte, bis zum Letzten auszureizen und dabei Musik zu schreiben, die nicht nur unterhaltsam war, sondern den Musiker dazu antrieb, die Grenzen, die das Instrument ihm setzte, von vier Fingern auf vier Saiten, einzureißen“, wie Blom schreibt.
Nach Jahren als Organist kommt Johann Sebastian Bach etwa um 1709 nach Weimar. Dort erreicht sein Schaffen einen ersten Höhepunkt, bevor er als Komponist die alte polyphone Satzkunst zur Vollendung bringen sollte. Aber schon in Weimar wird deutlich, dass Bach nicht nur eine Karriere als Klavier- und Orgelvirtuose anstrebt, sondern – gerade dreißigjährig – mit aller Leidenschaft „nach den grundlegenden Gesetzmäßigkeiten von Musik fragt. Auf der Basis des obligatorischen dreistimmigen Satzes versucht er alsbald alle Bereiche der Komposition zu erfassen“, wie Martin Geck bemerkt, so entstehen alsbald die ersten Instrumentalkonzerte und Sonaten.
Es war wohl eine ganz konkrete Begegnung, die Bach dazu veranlasste, die Stücke für Violine solo zu schreiben: In Venedig gab es ja bereits eine Tradition von Solostücken für Violine, die sich aber meistens als „virtuose Feuerwerks-Konfektionen“ darstellten, die nur dazu dienten die virtuose Technik der jeweiligen Solisten zu demonstrieren (die in dieser Zeit dennoch überall in Europa gefeiert wurden). Diese Stücke waren musikalisch oft nicht besonders interessant und ganz auf die technischen Fähigkeiten eines bestimmten Spielers zugeschnitten. – Einer dieser Solisten aber war auch Johann Georg Pisendel (1687-1755), der nur zwei Jahre jünger war als Bach, und der 1716 auch eine Reise nach Venedig unternommen hatte, um von den dortigen Virtuosen zu lernen. Ein Jahr verbrachte er so auf Kosten seines Dienstherrn in der Lagunenstadt, wo er unter anderem auch mit Antonio Vivaldi zusammenarbeitete.
In technischer Hinsicht waren die italienischen Virtuosen wie Vivaldi oder auch Giuseppe Tartini (1692-1770) allen anderen Geigern Europas überlegen, Pisendel jedoch konnte mit ihnen mithalten. Und so widmete ihm Vivaldi sogar einige besonders virtuose Sonaten (wie beispielsweise das Concerto in d-Moll „Per Pisendel“, Op. 8, No. 7, RV 242). Nach Deutschland zurückgekehrt, wurde Pisendel dann Musikdirektor in Dresden und schrieb dort zahlreiche virtuose Violinstücken (wie beispielsweise das Violin Concerto in d-Dur JunP I.7).
Als Pisendel nach Deutschland zurückkommt, ist Bach noch immer in Weimar als Konzertmeister, und das heißt als Geiger, tätig. Zwar dürfte er, darauf verweist Geck in seiner Bach-Biographie, auch „als Konzertmeister und selbst als späterer Köthener Kapellmeister (…) weiterhin oft am Cembalo gesessen (haben), je nach Bedarf aber auch zu einem Streichinstrument gegriffen haben. Immerhin schreibt Carl Philipp Emanuel Bach um das Jahr 1774 an Forkel: `Als der größte Kenner u. Beurtheiler der Harmonie spielte er am liebsten die Bratsche mit angepaßter Stärcke u. Schwäche. In seiner Jugend bis zum ziemlich herannahenden Alter spielte er die Violine rein u. Durchdringend u. Hielt dadurch das Orchester in einer größeren Ordnung, als er mit dem Flügel hätte ausrichten können. Er verstand die Möglichkeiten aller Geigeninstrumente vollkommen. Dies zeugen seine Soli für die Violine und das Violoncell ohne Baß.´“
Bach kannte seinen Kollegen Pisendel, weil auch er 1709 in Weimar verweilte. Und so lernte Bach nun über ihn die neuen italienischen Satztechniken kennen und begann bald selbst, an eigenen Stücken für Violine solo zu arbeiten – vermutlich sogar noch während seiner Weimarer Zeit. Denn wegen seine wachsenden Rufs holte ihn der junge Herzog Leopold von Sachsen-Anhalt-Köthen bald zu sich nach Köthen, einem Städten mit etwa 2.000 Einwohnern und damit etwa so groß wie Füssen, wo er Bach zum Hofkapellmeister und machte und ihm, wie Geck bemerkt, „zu der äußerlich schönsten Zeit seines Leben (verhalf): Mit Hofdiensten offenbar wenig behelligt, kann Bach in den Jahren 1717 bis 1723 ganz seinen kompositorischen Neigungen folgen und wichtige Werkreihen vollenden, die er zum Teil schon in Weimar begonnen hat: die Brandenburgischen Konzerte, die Inventionen und Sinfonien für Klavier, das Wohltemperierte Klavier, die Suiten für Violine und für Violoncello solo.“
Inzwischen ist Johann Sebastian Bach zum zweiten Mal verheiratet: Die erste Frau, Maria Barbara Bach, eine Cousine zweiten Grades, hat ihm sieben Kinder geboren, ehe sie 1720 vom Tod überrascht worden ist; seine zweite Frau ist die Köthener Hofsängerin Anna Magdalena Bach. Sie wird ihm weitere dreizehn Kinder schenken, wobei von den insgesamt zwanzig Söhnen und Töchtern letztlich nur neun das Erwachsenenalter erreichen werden – eine für die damalige Zeit recht hohe Quote und eine gute Voraussetzung, um über die Jahre hinweg in wechselnden Besetzungen Stubenmusik betreiben zu können. (Hansjörg Küster verweist in „Die Alpen“ (2020) darauf, dass zwei Violinen, eine Viola beziehungswesie Bratsche und ein Violoncello auch „ein Streichquartett (bilden), eine besonders wichtige Form von Haus- oder Kammermusik, die vielleicht in einer gewissen Verwandtschaft zur Stubenmusik steht“, wie sie besonders auch in den Alpen eine lange Tradition hat. Es ist insofern vielleicht kein Zufall, dass die ersten Kompositionen für solche Quartette von Joseph Haydn (1732-1809), der als Begründer des Streichquartetts gilt, im Alpenraum entstanden sind.)
In Köthen waren Bachs Aufträge als Hofmusiker eines protestantischen Fürsten meistens mit säkularer Musik verbunden. Jedenfalls weiß er „bei seiner Berufung an den reformierten Köthener Hof“, wie Geck erklärt, „daß ihn dort keine bedeutenden Aufgaben im Bereich der Kirchenmusik, vielmehr solche im weltlichen Bereich erwarten werden. (…) Dort leitet Bach eine große Kapelle; er hat ferner, wie er rückschauend im Erdmann-Brief schreiben wird, `einen gnädigen und Music so wohl liebenden als kennenden Fürsten´.“ Die Zeit, die ihn zum größten aller Kirchenmusiker machen sollte kommt für Bach erst später, in Leipzig. Köthen ist für ihn aber, so Geck des weiteren, „ein wichtiges Beispiel dafür, daß Bach in seinem Schaffen nicht nur der jeweiligen Lebenssituation folgt, sondern zugleich seine Vorstellungen von der Ordnung der Musik Schritt für Schritt weitertreibt. (…) Bach führt in jedem Fall das universelle Wesen der Musik vor. Er tut dies in äußerer und innerer Freiheit gegenüber seinem Kapellmeisteramt und dessen Aufgaben, denkt gleichsam von der Sache her. Gleichwohl gibt es Unterschiede zu den späten Leipziger Instrumentalzyklen: Akzentuieren die Köthener Werkreihen die Vielfalt, die aus ein und demselben musikalischen Denken erwachsen kann, so betonenen die Zyklen der letzten Jahre die geistige Einheit allen musikalischen Schaffens.“
Das gilt auch für die Sei Solo für Violine, die Bach nun fertigstellt – er schreibt diese Stücke für Violine solo aber auch als Demonstrationszyklus für seine Schüler. Geck bemerkt in diesem Zusammenhang: „Obwohl die Violine nicht Bachs Lehr- und Demonstrationsinstrument ist, legt allein die autographe Handschrift dieser Werke nahe, daß ihm das Instrument gleichwohl sehr nahe gewesen sein muß: Er scheint den Armschwung des Geigers unmittelbar auf das Notenbild übertragen zu wollen. Selten findet man bei Komponisten ein Notenbild, das kalligraphisch vollendet ist und zugleich etwas vom Geist der Musik mitteilt. Melodie und Harmonie in einem – das ist die Botschaft der Sei Solo, die darüber hinaus eine Enzyklopädie des violinistischen Solospiels darstellen: Präludium, Fuge, Konzert, Aria, Variation, Tanz – alles ist auf der Geige solistisch darstellbar.“ Und all ist auch auf vier Saiten mit vier Fingern, auf Holz, Schafsdarm (heute Kunststoff), Harz und Pferdehaar spielbar.
Die jeweils drei Sonaten und Partiten BWV 1001-1006 erschienen 1720. Das Manuskript von Bachs eigener Hand kündigt das Werk an wie folgt: „Sei solo à Violino senza Basso accompagnato“, darunter das Datum der Reinschrift und der Name des Komponisten. „Dieser Titel“, so Geck, „wirft einige Fragen auf. Zum einen ist da das Datum, das ungewöhnlich ist, denn gedruckte Noten wurden im Barock meistens nicht datiert. Musikliebhaber waren an neuen Stücken interessiert, es half also nicht, das Datum aufs Titelblatt zu schreiben.“ Noch verwirrender allerdings ist ein grammatikalisches Problem, wie Blom bemerkt: „Sollte es im Italienischen nicht sei soli heißen, im Plural, nämlich `sechs Soli´ für Geige?“, fragt er.
Nun war 1720 nicht nur das Datum der Fertigstellung der Sonaten und Partiten, es markierte auch einen tiefen Verlust für Bach: Er war nämlich mit seinem Dienstherrn nach Karlsbad gereist – und als er zurückkehrte, musste er feststellen das in der Zwischenzeit seine Frau Maria Barbara gestorben war und auch schon frisch begraben wurde. Sie war jäh an einer unbekannten Krankheit gestorben. Blom schreibt: „Plötzlich wurden diese großen Stücke für ein einsames Instrument zur Hommage an eine geliebte Person, was auch der Titel andeutet: Sei solo ist nicht falsches Italienisch für `sechs Soli´, sondern völlig korrektes Italienisch für: `Du bist allein´.“
So gelingt es Bach, den eigentlich nur als Demonstrationszyklus gedachten Stücken einen Gedanken und auch ein Gefühl mitzugeben, das sonst wohl nur schwer kommunzierbar wäre. „Er hatte sich so tief hineingedacht in die Texturen und Gezeiten der Einsamkeit“, schreibt Blom. „in Zyklus, den Bach mit dem ganzen Ehrgeiz seiner jungen Jahre geschrieben und dann in einer subtilen, kaum lesbaren Geste der tiefen Trauer seiner verstorbenen Frau gewidmet hatte, trug die Botschaft: `Du bist allein´ – und überwand gleichzeitig die Einsamkeit, indem er sie zum Klingen brachte.“ Und doch bleibt es, so Geck, „Bachs Geheimnis, wie er in einer konzentrierten Verbindung von Geistigkeit und Sinnlichkeit, Abstraktion und Klangfülle, universeller und gegenwartsbezogener Tonsprache sein Prinzip `Alles aus Einem und Alles in Einem´ am Beispiel der Violinmusik verdeutlicht.“