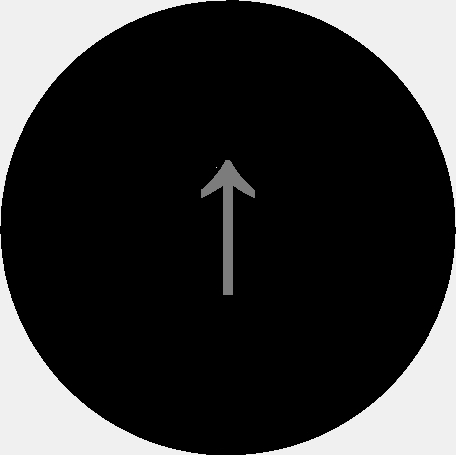Am Karfreitag vor 300 Jahren wurde Bachs erste oratorische Passion uraufgeführt. Er bezieht sich darin überwiegend auf den Leidensbericht des Johannes, der bis heute immer wieder zu Kontroversen führt. Ein Essay zur Passionsgeschichte Jesu …
„Das Historische zu wissen ist für den Glauben gleichgültig. Es kommt nur darauf an, dass Gott in der Welt war und gekreuzigt wurde.“
Søren Kierkegaard, Philosophische Brosamen … (1844)
„Mit dem Wissen wächst der Zweifel.“
Johann Wolfgang von Goethe, Maximen und Reflexionen … (1826)
„Da und dann wußte ich: die alte Zeit ist herum, und es ist eine neue Zeit. Bald wird die Menschheit Bescheid wissen … Was in den alten Büchern steht, das genügt ihr nicht mehr. Denn wo der Glaube tausend Jahre gesessen hat, eben da sitzt jetzt der Zweifel. Alle Welt sagt: ja, das steht in den Büchern, aber laßt uns jetzt selbst sehn.“
Galilei in Bertolt Brecht, Leben des Galilei (1943)
Bach in Leipzig
Als Johann Sebastian Bach im Jahr 1723 zum Thomaskantor berufen wird, in das wichtigste Amt für einen Kirchenmusiker im lutherischen Deutschland, und vom beschaulichen Köthen nach Leipzig wechselt, hatte sich in der sächsischen Metropole bereits ein Paradigmenwechsel im Verständnis gottesdienstlicher Musik vollzogen, mit dem Bach nun konfrontiert ist. Auf das Zeitalter der Motette und der Polyphonie folgte dasjenige von Konzert und Generalbass, was mit wesentlichen stilistischen Änderungen der Kirchenmusik verbunden war. Es ist die Renaissance, die mit Verspätung auch die Musik erreicht hat und hier „Barock“ genannt wird.
Eine Motette (vom französischen „mot“, „Wort“) ist eine mehrstimmige (polyphone) Komposition, bei der jede Stimme einen eigenen Text hat, wobei die Stimmen zum liturgischen cantus firmus (einer feststehenden Melodie, meist einem gregorianischen Choral) hinzukommen. Die meistens vierstimmige Motette besteht insofern aus selbstständigen, in unterschiedlichen Abständen einsetzenden Stimmen und man kann durchaus, wie Martin Geck meint, die „Messe – Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus mit Benedictus, Agnus Dei – als Spezialformen der Motette betrachten“.
Nun jedoch ändert sich das und es setzt so etwas wie die musikalische „Neuzeit“ ein: Wenn Kompositionen bisher zur Ehre Gottes aufgeführt wurden, dominiert nun ein Kompositionsstil, „in welcher der Mensch sich in seiner eigenen Würde und mit seinen eigenen Fähigkeiten abbildete“, wie der Musikwissenschaftler Martin Geck in seiner Biographie über „Bach“ (2000) feststellt. Zunehmend entstehen weltliche Werke, die das Gefühl eines empfindsamen Publikums ansprechen sollen. Geck zitiert in diesem Zusammenhang einen Zeitgenossen Bachs: „An die Stelle der motettischen Schreibweise, bei der ’nicht so sehr der Text als die Harmonie in Acht‘ genommen wurde, tritt die konzertierende; diese besteht aus ‚Teils ziemlich geschwinden Noten, seltzamen Sprünge, so die Affecten zu bewegen geschickt sind‘.“ Ein spezielle Spielart dieses Stils sei der „theatralische“.
Zu den stilistischen Veränderungen kommen solche der Aufführungspraxis: Motetten wurden von den liturgischen Ensembles, den Chören, bisweilen ohne Instrumentenbegleitung aufgeführt (oder diese waren nur in untergeordneter Funktion beteiligt); Bei dem nun vorherrschenden theatralischen, konzertierenden Kompositionsstil kommen Instrumental-Ensembles zum Einsatz, die „vom Fundament des Generalbasses aus“ agieren, wie Geck bemerkt, „also einer Instrumentengruppe, welche die Komposition mit einer kontinuierlichen Folge von Akkorden ‚begleitet’“.
Erfolgreich ist das, weil dieser sich kontinuierlich wiederholende Basso continuo eine neue Dur-Moll-Harmonik realisiert „mit der Kadenz, die von den Dreiklängen über der ersten, vierten und fünften Stufe (I – IV – V – I) gebildet wird. Vor allem die Kadenzharmonik ist es, welche eine Komposition im modernen Sinne ’spannend‘ macht“, weiß Geck. Gespielt wird das von harmoniefähigen Instrumenten wie Orgel oder Cembalo, während „zur Verstärkung des Bassfundaments … oft ein tiefes Streich- oder Blasinstrument mit(geht)“.
Die dritte wesentliche Veränderung gottesdienstlicher Musik ergibt sich, weil um die Wende zum 18. Jahrhundert eine neue Gattung entstanden ist: die Kantate. Von der Motette unterscheidet sich die Kantate dadurch, dass sie nicht nur über eine Textsorte (bisweilen ein Kirchenlied oder ein Bibelzitat) komponiert wird, sondern eine ausgedehnte, mehrteilige geistliche Komposition mit verschiedenen Textsorten ist. Geck schreibt in diesem Zusammenhang: „Das in den Quellen oft so genannte Musizieren der Kantate ist der jeweils aktuellen Predigt, die Aufführung der Motettenmusik dem Verlesen des Evangeliums oder dem Absingen von Kirchenliedern vergleichbar: Ersteres stellt eine individuelle schöpferische Leistung dar; letzteres ist Nachvollzug eines Vorgegebenen …“
Mit moderner Konzert- und Kantatenmusik reagieren Komponisten geistlicher Kirchenmusik wie Bach auf den aufgeklärten Geschmack des beginnenden 18. Jahrhunderts, der wesentlich von der Oper geprägt ist, von deren neuer, „beseelt liedhaften Musik“ (Geck) eine ungeheure Faszination ausgeht. Für das aufstrebende Bürgertum von Leipzig, das zu der Zeit die geistige Metropole Deutschlands ist, drückt sich hier der Wunsch aus, „sich Zugangsweisen zur Musik zu erschließen, die bis dahin Privileg des Adels gewesen sind“, schreibt Geck. Entsprechend werden Kirchenkantaten mit ihrer Unterstützung zunehmend wie Opern angelegt und zielen vermehrt auf persönliche Empfindungen und Gefühle der Rezipienten, die sich zunehmend als Subjekte begreifen. Sie beruhen auf Texten, „die wie ein Opernlibretto durch den regelmäßigen Wechsel von Rezitativ und Arie gekennzeichnet sind“, bemerkt Geck. (Während sich in einer Arie die Sprache gewissermaßen in Musik auflöst, schreitet in einem Rezitativ das sprachliche Drama fort, das heißt die Musik tritt zugunsten des Wortes zurück. Der Unterschied zwischen Arie und Rezitativ wird auch in Beethovens „Sturmsonate“ ab 13:05 besprochen.)
Allerdings finden all diese Veränderungen nicht ungeteilten Zuspruch: Fromme, konservative Kirchgänger und Pietisten beklagen eine sich innerhalb des Gottesdienstes verselbständigende Musik. Ihnen ist das zu theatralisch und opernhaftig – sie wollen stattdessen, dass Kirchenmusik „zur Andacht aufmuntere“. Johann Sebastian Bach entscheidet sich deshalb in vielen seiner zweihundert erhaltenen Kantaten für einen Kompromiss, wie Geck feststellt: „Der Kern der Kantate wird nach dem Vorbild der Oper als eine Folge von Rezitativen und Arien über moderne Dichtung gestaltet; den Kopf bildet ein Konzertsatz über ein Bibelwort oder ein Kirchenlied; und am Schluss steht ein schlichter vierstimmiger Choral“, dessen Text bisweilen von bekannten Dichtern aus dem 16. und 17. Jahrhundert stammt, mitunter auch auf Martin Luther (1483-1546) zurückgeht.
Lutherische Kirchenmusik
Für Bach in Leipzig ist die lutherische Kirchenmusik zweifelsohne das zentrale Moment seines Komponierens: Jedes Jahr werden über 60 Kantaten aufgeführt, eine für jeden Sonn- und Festtag. Nur an den sechs Passionssonntagen vor Ostern werden keine Kantaten aufgeführt und Bach hat Zeit, sich anderem zu widmen. In dieser Zeit im Jahr 1724, seinem ersten Jahr in Leipzig, komponiert er die Johannespassion BMV 245. Sie ist seine erste Passion (es folgen 1727 noch eine Matthäus- und 1731 eine Markuspassion sowie ein Weihnachtsoratorium 1734 und die h-Moll-Messe 1748) und wird innerhalb der Karfreitagsvesper am Nachmittag des 7. April 1724 in der Leipziger Nikolaikirche uraufgeführt.
Obwohl die Uraufführung im Rahmen eines Predigtgottesdienstes stattfindet, hat die Aufführung der Johannespassion dennoch, wie Geck bemerkt, „Darbietungscharakter“, da man am Karfreitag traditionell zwei Gottesdienste besuchte: Schon vormittags wird die Passionsgeschichte nach Johannes ohne Instrumentalbegleitung in liturgischem Gesang dargeboten (zwar mit verteilten Rollen, aber einstimmig, das Volk im schlichten vierstimmigen Satz), am Nachmittag sollte dann, seit das Leipziger Konsistorium das 1721 erlaubte, eine „musicirte Passion“ für Chor und Orchester folgen. Das war eine ungewohnte Neuerung, denn seit den Tagen der lutherischen Reformation wurde in der Karfreitagsvesper zur Verinnerlichung von Jesu Leiden praktisch ausschließlich Passionslieder von der Gemeinde selbst gesungen.
Ermöglicht wurde die Aufführung eines so aufwändigen Passionsoratoriums durch eine eigens dafür eingerichtete bürgerliche Stiftung, aber erst Bach etablierte es dann auch. Für ihn sollte die Johannespassion das musikalische Hauptereignis seines ersten Jahres in Leipzig werden. Da er an den Einnahmen beteiligt war, wollte Bach die Uraufführung auch in der mit 2.000 Plätzen ausgestatteten, größeren Thomaskirche aufführen, was ihm jedoch von der Stadt untersagt wurde. Gleichwohl waren die Leipziger Hauptkirchen damals keine Orte der Sammlung, sondern hatten eher „etwas von Logentheater an sich“, weiß Geck: Für die reicheren Bürger war die Miete eines Kirchenstuhls verpflichtend, ansonsten gab es eine abgestufte Hierarchie von der Empore bis zum Stehplatz. Insofern lag es, wie Geck meint, „von vornherein nahe, die Passionsaufführung als Musikgenuss und darüber hinaus als gesellschaftliches Ereignis wahrzunehmen“. Die christliche Kirchengemeinde wird hier zum Publikum beziehungsweise zur „Zuhörerschaft“ – zu „Herren Auditoribus“, wie Bach selbst sagte.
Bachs Passion und das Johannesevangelium
Obwohl sich die Passionsmusik in späteren Zeiten eher als die Kantaten aus dem liturgischen Geschehen lösen konnten, war das am Karfreitag 1724 noch nicht der Fall: Die Aufführung der Johannespassion war noch in den Gottesdienst eingebunden und wurde deshalb nach dem II. Akt, der Verleugnung, unterbrochen. Erst nach der Predigt folgte die Fortsetzung mit dem Verhör von Jesus durch den Hohen Rat.
Anders als die Vormittagslesung des Johannesevangeliums soll die musikalische Aufführung der Passion am Nachmittag das Nachempfinden des Leidens ermöglichen, sie trägt insofern – darauf macht der Regisseur Philipp Harnoncourt in seinem kurzen Text „Die Johannespassion szenisch aufführen …?“ anlässlich seiner Inszenierung in Weimar 2017 aufmerksam – die Idee von Mimesis und Katharsis in sich. Überhaupt zeitigt sich in der Vergegenwärtigung des Leids ein tiefes Verwandtschaftsverhältnis zwischen Theater und religiöser Praxis.
Bach leitet die Dramaturgie seiner Passion weitestgehend vom Johannesevangelium ab, aber der Evangelienbericht wird nicht nur erzählerisch wiedergegeben, sondern es kommen verschiedene Personen und Menschengruppen zu Wort: Bach vertont das Evangelium für einen Evangelisten, Solist*innen (Sopran, Alt, Tenor, Bass) für unterschiedliche Rollen, einen vierstimmigen Chor und Orchester. Der Evangelist, traditionell ein Tenor, führt mit seinen Rezitativen als Erzähler, aber mitunter auch als Augenzeuge, durch die Leidensgeschichte von Jesus, während die Solist*innen in den Arien das Geschehen aus ihrer Perspektive kommentieren und ihre Gedanken hinzufügen. Mit den Chorälen (bisweilen Kirchenliedstrophen) vertont Bach die Stimme der Gemeinde, die insofern symbolisch am Geschehen teilnimmt. Von formaler Tragweite sind in der Johannespassion außerdem noch die sogenannten Turba-Chöre, die an der Handlung beteiligte Menschenmengen darstellen, denen Bach in der Johannespassion einen breiten Raum gibt.
So wird die Passion insgesamt mit mehreren verschiedenen Stimmen aus unterschiedlichen Perspektiven und mitunter sogar Zeitebenen geschildert. Ähnlich wie im epischen Theater von Bertold Brecht, wo mit der Montage einzelner Szenen aus unterschiedlichen Blickwinkeln die klassische dramatische Struktur mit ihrer geradlinigen Dynamik permanent unterbrochen wird, erlaubt es auch Bach den Rezipienten, sich durch den Wechsel von Rezitativen, Arien, Turba-Chören und Chorälen ihr eigenes Bild zu machen. Die Johannespassion hat insofern von der dramaturgischen Konzeption und formalen, kompositorischen Gestaltung Bachs her etwas immanent Theatrales, unabhängig davon, ob sie nun szenisch aufgeführt wird oder nicht.
Erinnert die Johannespassion formal also vielleicht an Brecht, orientiert sich Bach inhaltlich überwiegend am Johannesevangelium, wobei er dieses in fünf Akte gliedert, die zu seiner Zeit in folgende lateinische Formel gefasst wurden: „Hortus, Pontifices, Pilatus Cruxque, Sepulchrum“, was übersetzt bedeutet:
- Exordium (Eröffnungschor, 1. Szene)
- I. Akt: Gefangennahme Jesu im Garten Gethsemane (2.-5. Szene)
- II. Akt: Verleugnung durch Petrus (6.-14.)
- III. Akt: Verhör und Prozess vor dem Hohen Rat und Pilatus (15.-23.)
- IV. Akt: Tod am Kreuz (24.-37.)
- V. Akt: Grablegung Jesu (38.-40.)
Für die Johannespassion führt Bach zwei Versionen bereits existierender Libretti zusammen und verbindet in diesem Zusammenhang wörtliche Übernahmen aus dem Johannesevangelium mit umgedichteten, freien Passagen in einer theologisch-poetischen Deutung. Dabei blieb er dem neutestamentlichen Leidensbericht von Johannes treu – sein Bericht bildet eine Einheit, die Bach als solche vertonte, wobei er der gottesdienstlichen Funktion der Passion dadurch gerecht wurde, dass er die gläubige Gemeinde durch die betrachtenden Arien und Choräle am Ende jeden Aktes einbezog.
Zwischen 1724 und 1749 wurde die Johannespassion öfter aufgeführt und es entstanden verschiedene Versionen. Insgesamt fünf Fassungen sind bekannt, wobei die heute übliche der allerersten Version gleicht, sieht man von geringfügigen Textänderungen ab. Gegenüber der Matthäus-Passion enthält die Johannespassion wesentlich weniger Arien und Ariosi (nicht 26, sondern nur 10), wodurch Bach die Dramatik stärker betont. Das gilt auch bei der Gestaltung der Rezitative des Evangelisten.
Das Johannesevangelium
Das Johannesevangelium entstand im ersten Jahrhundert, vermutlich zwischen 80 und 95 nach Christus, und damit nach den anderen drei, den sogenannten synoptischen Evangelien. „Synoptisch“ heißen die Evangelien von Markus, Matthäus und Lukas deshalb, weil sie das Leben und die Lehre Jesu aus einer vergleichbaren Perspektive beschreiben und das Geschehn auch recht einheitlich deuten, weshalb sie Johann Jakob Griesbach im Jahr 1776 erstmals zum besseren Vergleich in Spalten nebeneinander abdrucken ließ und dergestalt eine Synopse, eine „Zusammenschau“, produzierte zum besseren Vergleich der intertextuellen Bezüge und Ähnlichkeiten zwischen den drei Evangelien: Denn der sogenannten Griesbach-Theorie zufolge bildet Matthäus den Grundlagentext, während Markus in Kenntnis von Lukas beide Evangelien vereinfacht, indem er zum Beispiel die Bergpredigt weg lässt. Es gibt allerdings unterschiedliche, sich widersprechende Theorien über das „synoptische Problem“, also die Abhängigkeiten und Ähnlichkeiten der Evangelien untereinander.
Das Markusevangelium, das um 65 nach Christus entstanden ist, gilt zwar als ältestes der vier „frohen Botschaften“, dennoch scheinen auch die beiden anderen synoptischen Evangelien auf dieselbe Passionsgeschichte zurückzugehen. Obwohl unklar ist, ob Johannes die synoptischen Evangelien überhaupt kannte, weisen auch bei ihm die Kapitel ab Beginn der Passionsgeschichte (18. Kapitel) Parallelen auf. So mag es vielleicht eine allen gemeinsame Quelle geben was die Passion Jesu betrifft – insgesamt aber gibt es Unterschiede und es gilt eigentlich als sicher, dass das Johannesevangelium auf eine ältere mündliche Überlieferung zurückgeht.
Auch eines der ältesten gefundenen handschriftlichen Manuskripte des Neuen Testaments ist ein Evangelium von Johannes. Es handelt sich um das „Bodmer-Papyrus“ – die älteste Kopie nahezu des gesamten Johannesevangeliums (bei den 75 Seiten fehlen nur die Abnahme Jesu vom Kreuz, die Grablegung und wie Maria Magdalena das Grab am nächsten Morgen leer vorfand) aus der Zeit um 175 nach Christus, 150 Jahre nach den historischen Ereignissen. Das Papyrus wurde im Jahr 1952 in Oberägypten entdeckt und nach seinem Schmuggel in die Schweiz von Martin Bodmer erworben. Heute wird es nahe Genf aufbewahrt (teilweise auch in der Bibliothek des Vatikans).
Das Johannesevangelium des Papyrus ist in altgriechischer Sprache verfasst. Wie auch die synoptischen Evangelien entstand es nicht in Jerusalem, sondern die Evangelisten lebten damals schon im gesamten Mittelmeerraum verteilt: Der Verfasser des Markusevangeliums zum Beispiel lebte im syrischen Antiochia, derjenige des Johannesevangeliums im griechischen Ephesos. Bisher jedenfalls wurde noch nicht einmal ein Fragment eines Evangeliums in Palästina beziehungsweise in hebräischer oder aramäischer Sprache gefunden. Und so geht man also davon aus, dass die Evangelien ihre endgültige Form erst von im Exil lebenden Autoren erhielten – und zwar in einer Zeit, als allmählich ein Bruch einsetzte zwischen Christen und Juden. Das gilt insbesondere für das Johannesevangelium.
Nach dem Tod Jesu verschärften sich die Spannungen zwischen Juden und Christen, besonders in der Zeit des vom römischen Historiker Flavius Josephus in „Der Jüdische Krieg“ beschriebenen jüdischen Aufstands von 66-70 nach Christus, an dessen Ende die Zerstörung des jüdischen Tempels durch die Römer steht. Aber bereits Paulus macht in seinem um 50 nach Christus entstandenen Brief an die Thessaloniker deutlich, dass die „Christen“, die noch eine jüdische Sekte sind, jetzt die jüdischen Gemeinden verlassen und sich unabhängig machen. Spätestens aber seit der Zeit um 85 werden die Christen im Gebet der jüdischen Synagoge mit einem Bann belegt; seither ist am Anfang des Gebets von „Bal-schinim“ und „Minim“, den „Anderen“ die Rede – und das sind zweifelsohne die „Christen“.
Der Ausschluss der Christen aus der Synagoge ist der Anfang eines eigenständigen Christentums. Und auch das Johannesevangelium ist wesentlich aus dieser Spannung heraus entstanden, jedenfalls gibt es in ihm deutliche Hinweise darauf, dass die Johannäische Gemeinde „außerhalb der Synagoge“ steht: Auffällig ist, wie oft bei Johannes „die Juden“ angesprochen werden: 71 Mal spricht das vierte Evangelium von ihnen, während „die Juden“ in den synoptischen Evangelien insgesamt nur 16 Mal vorkommen (und auch konkreter benannt werden, zum Beispiel als „heuchlerische Pharisäer“). Bei Johannes ist vermutlich alles, was mit der Erfüllung der Schrift in Verbindung steht, in einer sehr frühen Phase entstanden, als er sich noch zur jüdischen Gemeinde zählte; die Reden Jesu (Kapitel 12, 15-17, 21 und eventuell der Prolog) hingegen wurden wahrscheinlich erst später eingefügt, als sich die Johannäische Gemeinde von der Synagoge trennte.
Man kann das Johannesevangelium durchaus als Spiegel der Gemeinde beziehungsweise der historischen Situation der Gemeinde lesen – und man muss das wahrscheinlich sogar so lesen, will man die ideologische Instrumentierung des Evangeliums und eine antijüdische Lektüre verhindern. Historisierung steht dem Prinzip der Ideologisierung diametral gegenüber indem sie versucht, wie der Theaterwissenschaftler Manfred Brauneck schon in Bezug auf das epische Theater Brechts festgestellt hat, „das Zustandekommen von Ideologie, ihre historische Bedingtheit“ aufzudecken. Die Methode der Historisierung versucht, wie das Theater Brechts, Ideologien auf ihre materielle Basis zurückzuführen und Objekte gesellschaftlicher Prozesse als objektive gesellschaftliche Prozesse darzustellen (Brecht will damit die Wirklichkeit mit der Perspektive ihrer Veränderbarkeit ausstatten).
– Messiaserwartung –
Es scheint ziemlich eindeutig, dass der Verfasser des Johannesevangeliums für seine christliche Gemeinde im griechischen Ephesos schreibt. Besonders deutlich wird das in Passagen, in denen er Begriffe wie „Messias“ erklärt, was sich in einem rein jüdischen Umfeld erübrigen würde. So heißt es zum Beispiel bereits im ersten Kapitel des Johannesevangeliums (1,41): „Wir haben den Messias gefunden! Messias heißt ‚der Gesalbte‘.“
Das hebräische „Messias“ bezeichnet den „Gesalbten“ und wird hier für die Gemeinde in Ephesos ins griechische „Christos“ („Gesalbter“) übersetzt, aus dem schließlich das latinisierte „Christus“ wurde. „Christos“ bedeutet „derjenige, der geheiligt wurde“, aber auch einfach nur „der mit Öl benetzt wurde“, der „Pomadisierte“. Von ihm jedenfalls erhielten die exilierten Juden, die „Christen“, ihren Namen. Zum ersten Mal so genannt wurden sie den Jüngern zufolge in Antiochia – und da wurde die Bezeichnung „Christen“ wohl als Spottname benutzt: „Die Anhänger des Pomadisierten.“
Als Messias, Gesalbter, wird im Alten Testament (zum Beispiel in Jesaja 45,1) der von Gott eingesetzte „König der Juden“ als Nachfolger Davids bezeichnet (die Salbung mit Öl gilt schon lange als Ritus bei der Thronbesteigung eines Königs und wird noch heute bei Krönungen praktiziert). Insbesondere seit dem historischen Propheten Jesaja, der um 740 vor Christus lebte, und der Zerstörung des Ersten Tempels 586 vor Christus durch die Babylonier sowie dem anschließenden Exil entstand die Erwartung eines Messias, eines zukünftigen Königs, der die Juden einen und von der Fremdherrschaft befreien werde und so das Reich David wieder herstellen werde.
Der Messias wurde lange nicht mit einer lebenden Person in Verbindung gebracht, sondern als „Heilsbringer“ verstanden (zum Beispiel in den Psalmen 17 und 18). Erst mit der Besetzung Palästinas durch die Römer im Jahr 63 vor Christus taucht die Figur des Messias wieder auf – unmittelbar vor Jesus also und in Auseinandersetzung mit der römischen Besatzungsmacht. Nun wächst im jüdischen Volk die Hoffnung auf einen Befreier vom Römischen Reich.
Zu Lebzeiten wurde Jesus nie „Messias“ genannt. Es sind erst die Evangelisten, die die Messiasfigur mit Jesus neu besetzen – ohne ihn jedoch mit dem Messias im alttestamentlichen Sinn zu identifizieren. In den Evangelien erscheint Jesus vielmehr als ein endzeitlicher Prophet, losgelöst von nationalistischen, jüdischen Hoffnungen. Deutlich wird das am sogenannten Messiasbekenntnis des Petrus im Evangelium nach Matthäus (16,13-20): Hier antwortet Petrus Jesus auf die Frage: „Für wen haltet ihr mich?“ mit: „Du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes!“, worauf ihn Jesus als „Felsen“ bezeichnet, auf den er seine Kirche bauen wird. „Dann befahl er den Jüngern, niemand zu sagen, dass er der Messias sei“, bemerkt Matthäus.
Der Messias-Begriff wird hier in einem christlichen Sinn umgedeutet: Jesus will nicht als Befreier von der römischen Besatzungsmacht auftreten – in diesem Zusammenhang verhängt er quasi eine Schweigepflicht –, sondern ihm geht es um die Errichtung einer neuen Kirche: an die Stelle der (Wieder-)Errichtung eines irdischen Reiches tritt ein anderes: Den Evangelien zufolge will er nicht das alte Reich Davids wieder herstellen, sondern nach seinem Tod und seiner Auferstehung ein neues, göttliches.
Aus dieser Vorstellung heraus wird aus Jesus von Nazareth über Jesus Christus schließlich der am Kreuz gestorbene und auferstandene Christus. Die Evangelisten konstruierten zwar Beziehungen zum alttestamentarischen Messias, schufen darüber hinaus jedoch eine Jesusfigur, in der der historische, politische Jesus getilgt war. Das gilt insbesondere für das Johannesevangelium, wo aus dem Leben Jesu das Leben Jesus Christus – eine zur Legende verarbeitete Biografie – wird. Der politische Aspekt des Messias-Begriffs wird hier abgeschwächt und der galiläische Jesus, Jesus von Nazareth, nach seiner Kreuzigung letztlich sogar zum universalen Christus umgeschrieben: Schon im ersten Kapitel seines Evangeliums wird Jesus zum enthistorisierten, entkörperten „Wort Gottes“ (1,1), zum „göttlichen Logos“ (1,3), später zum „Licht der Welt“ (8,12). Ist der Jesus bei den Synoptikern noch etwas menschlicher gezeichnet, wird er bei Johannes zur göttlichen Lichtgestalt. Er betont so die Königsherrschaft Jesu – und manifestiert damit gleichzeitig die Trennung vom Judentum.
Exordium (1.)
Der Passionsbericht des Johannesevangeliums (Kapitel 18-19) stellt den Kern des Textes von Bachs Johannespassion dar. (Ein Textbuch gibt es zum Beispiel hier.) Bach fundiert seine Passion textlich jedoch nicht allein auf dem Evangelium, sondern erlaubt auch dichterische Momente. So entsteht kein ästhetisch einheitliches „Passionsoratorium“ das sich streng an den Evangelientext hält, vielmehr bietet er, wie Martin Geck bemerkt, eine „oratorische Passion“, innerhalb derer sich die traditionell liturgischen Elemente Evangelium und Choral mit freier Ariendichtung abwechseln, sich „Theologie und Poetik gleichsam die Hand reichen“. Er kommt so als Thomaskantor auch der Forderung entgegen, nicht „theatralisch“ zu komponieren.
Bei den Synoptikern ist Christus nicht allein Gott, sondern auch Mensch, insbesondere in seinem Leiden: er ist das gequälte Opfer, leidet wie ein Mensch und schreit auch laut auf, bevor er stirbt. Der Christus des Johannes dagegen hat in seiner Erhabenheit kaum menschliche Züge: Im Vergleich zu den Berichten der synoptischen Evangelien kommt im Johannesevangelium stattdessen die göttliche Natur Jesus Christus` besonders zum Ausdruck. Er erscheint als jemand, der auf Erden einen göttlichen Auftrag erfüllt. Zurückgenommen werden dagegen die menschlich-körperlichen Aspekte – und auch die irdischen Qualen und der Schmerz während seiner Passion. Selbst während der Erniedrigung durch Pilatus und sogar noch am Kreuz bleibt Jesus der göttliche Herrscher. Entsprechend auch heißt es einleitend im Exordium, dem Eingangssatz von Bachs Johannespassion (1.): „Herr, unser Herrscher, dessen Ruhm in allen Landen herrlich ist. Zeig uns durch deine Passion, daß du, der wahre Gottessohn, zu aller Zeit, auch in der größten Niedrigkeit, verherrlicht worden bist.“
Als Auftakt zu einer Leidensgeschichte wirkt der Einleitungschor erstaunlich: keine schmerzliche Klage, sondern eine leidenschaftliche Anrufung – wie drei mächtige Fanfarenstösse klingen die erregten Rufe mit denen der Chor in der Johannespassion einsetzt. Später setzen die Stimmen einzeln ein, jede für sich. Erst nach einiger Zeit finden sie wieder zueinander. Alle aber rühmen die Herrlichkeit des Herrn – und so erscheint der Eröffnungschor der Leidensgeschichte Jesu fast wie ein Gloria, ein Lobgesang.
Bach folgt insofern der johanneischen Christusdarstellung, wenngleich sich der Text der Johannespassion aus verschiedenen Bestandteilen zusammensetzt und sich der Eingangschor zu Beginn auf Psalm 8,2 bezieht wo es heißt: „Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen“. Grundsätzlich konnten in Passionstexten auch Passagen aus anderen Teilen der Bibel herangezogen werden oder Strophen aus bekannten Kirchenliedern – das bibelfeste Auditorium zu Bachs Zeiten verstand sie ohnehin als Zusammenhänge des göttlichen Heilsplans. Entsprechend auch adaptiert Bach die Psalmworte, die sich eigentlich nur auf Gottvater allein beziehen, nun auch auf Jesus – und weist so auf die göttliche Einheit des Vaters mit dem Sohne hin.
Danach wird es freie Dichtung – das Libretto bietet so ein „Einfallstor für die moderne, bürgerliche Konzertmusik“, wie Geck schreibt. Insbesondere in den beiden letzten Zeilen (eines anonymen Librettisten) konzentriert sich der Passionsbericht des Johannes: Selbst der qualvolle Tod am Kreuz ändert nichts an der Herrlichkeit Jesu. Das ist außergewöhnlich, wie Geck weiß: „Es entspricht zwar der Theologie des Johannesevangeliums, Christus nicht als Dulder, sondern als Herrscher darzustellen; (…) Indessen gibt es in der Geschichte der Gattung keine andere Passion, die im Eröffnungssatz nicht vornehmlich auf das Leiden des Heilands einginge und, wenn sie dort schon musikalische Affekte vorstellt, solche des Leidens und des Schmerzes wählte.“
Dem Einsatz des Chors hat Bach eine 18-taktige Einleitung des Orchesters vorangestellt. Und hier ergänzt Bach dann gewissermaßen auch das triumphale Christusbild des Johannes durch den musikalischen Hinweis auf das menschliche Leiden Jesu am Kreuz: Die beiden höchsten Stimmen in dieser Einleitung werden von Oboen und Traversflöten gespielt – und zu hören sind klagende, abwärts schreitende, sich reibende Dissonanzen. Die Wehklage ist insofern musikalisch deutlich wahrnehmbar.
Hinzu kommt der von verschiedenen Instrumenten ausgeführte Basso continuo, der barocke Generalbass, der die Leiden Jesu stützt und das Fundament des Gesamtklanges bildet. Vervollständigt wird die Einleitung schließlich noch mit einem dritten Element, wenn auf- und abschwingende Linien bei den Streichern hinzukommen. Ähnliche Figuren hat Bach übrigens in vielen seiner Kantaten verwendet, und zwar immer dann, wenn es um die Darstellung des Heiligen Geistes ging. Und so wird diese Einleitung von manchen auch als eine musikalische Darstellung der Trinität interpretiert: die Leidensgestalt Jesu in den Stimmen der Holzbläser, das Wehen des Heiligen Geistes in den Streichern und die Festigkeit und unerschütterliche Ruhe Gottvaters im Basso continuo.
Den Einleitungschor der Johannespassion gliedert die Da-capo-Form – eine der am häufigsten verwendeten musikalischen Formen des Barock. Sie ist in drei Abschnitte eingeteilt: Auf den ersten Abschnitt folgt ein kontrastierender Mittelteil, danach wird er Da capo – also von vorne – wiederholt. Es handelt sich hierbei um ein traditionelles, starres Schema, das Bach nun jedoch mit inhaltlicher Bedeutung füllt: Nachdem er Christus zu Beginn als Herrschergestalt vorgestellt hat, bringt er im zweiten Teil einen neuen Gedanken ein: „Zeig uns durch deine Passion, dass du der wahre Gottessohn zu aller Zeit, auch in der größten Niedrigkeit, verherrlicht worden bist.“ Nacheinander setzen die Chorstimmen mit dieser Aufforderung ein – und jedes Mal hört man zu Beginn einen Oktavsprung, den man durchaus als eine Art Brecht`sche Geste des Zeigens interpretieren kann – als ob Bach uns zur Aufmerksamkeit auffordert.
„Zeig uns durch deine Passion“ … Bach zeigt das auch in seiner Musik: Für zwei Takte, bei den Worten „auch in der größten Niedrigkeit“, sinken alle Chorstimmen in sich zusammen – und wir sehen einen leidenden Menschen. Aber dieser menschliche Augenblick, dieses Bild, das uns Bach hier musikalisch vor Augen führt, ist nicht das Christusbild des Johannes – und so wird es auch praktisch sofort widerrufen. Bach, der sonst nicht oft Lautstärken vorschreibt, tut es hier: Im forte weist der Chor auf die Verherrlichung hin, die im Text unmittelbar auf die Erniedrigung folgt. So gibt Bach der alten Da-capo-Form letztlich auch die Bedeutung einer theologischen Aussage.
Im dritten Teil dann, nachdem Christus in die Niedrigkeit des Leids herabgestiegen ist und sich dann doch in seiner Herrlichkeit behauptet hat, kehrt er zurück ins Reich des Lichts, wird wieder zu jener göttlichen Herrschergestalt, als die er zu Beginn schon angerufen wurde. Folgerichtig kehrt Bach zurück zum Anfang: „Herr, unser Herrscher …“
Vorgeschichte
– Historischer Jesus? –
Beim Johannesevangelium handelt es sich, wie auch bei den drei synoptischen Evangelien, um ein Glaubensbekenntnis, nicht um einen historischen Bericht: in ihm wird Jesus zum universalen Christus umgeschrieben. Damit jedoch stellt sich die Frage, wie weit das Evangelium von der historischen Wirklichkeit entfernt ist. Der Theologe Adolf Holl unterscheidet in „Jesus in schlechter Gesellschaft“ (2002) in diesem Zusammenhang zwischen einem Christus des Dogmas (der Kirche), einem Jesus Christus der Evangelien und einem historischen Jesus.
Die Existenz Jesu wird nicht nur von den Evangelien bezeugt, sondern auch der bereits in Zusammenhang mit dem „Jüdischen Krieg“ angeführte römische Historiker Flavius Josephus erwähnt ihn. Flavius Josephus wurde um das Jahr 36, also nach der Kreuzigung von Jesus, geboren und war ursprünglich Priester in Jerusalem, bevor er in römische Dienste kam. Er beschrieb den „Jüdischen Krieg“ von 66-70 nach Christus aus Sicht der Römer und in der letzten Ausgabe seines Werkes „Jüdische Altertümer“ erwähnt er Jesus und Johannes den Täufer – in dieser Reihenfolge. Konkret schrieb er zu Jesus: „Zu dieser Zeit lebte Jesus, ein weiser Mensch, sofern man ihn überhaupt Mensch nennen darf. Er war nämlich der Vollbringer ganz unglaublicher Taten und der Lehrer aller Menschen, die mit Freuden die Wahrheit aufnahmen. So zog er viele Juden und auch viele Heiden an sich. Dieser war der Christus. Und obgleich ihn Pilatus auf Betreiben der Vornehmen unseres Volkes zum Kreuzestod verurteilte, wurden doch seine früheren Anhänger ihm nicht untreu. Denn er erschien ihnen am dritten Tage wieder lebend, wie gottgesandte Propheten dies und tausend andere wunderbare Dinge von ihm vorherverkündet hatten. Und noch bis auf den heutigen Tag besteht das Volk der Christen, die sich nach ihm nennen, fort.“
Flavius Josephus Erwähnung, das sogenannte „Testimonium Flavianum“ („Flavische Zeugnis“), ist der einzige historische Hinweis auf Jesus – der einzige außerhalb der Evangelien. Es scheint aber seltsam, dass Flavius Josephus als Jude schreibt: „Zu dieser Zeit lebte“ der Mensch Jesus, „sofern man ihn Mensch nennen darf“. Noch dazu, weil die Bemerkung zu Jesus eingefügt ist zwischen dem Bericht eines Aufstandes und dessen Niederschlagung. „Es drängt sich geradezu die Frage auf“, schreibt Adolf Holl in diesem Zusammenhang, „ob diese Anmerkung nicht nachträglich eingearbeitet wurde.“ Schließlich stammen die frühesten Ausgaben der „Jüdischen Altertümer“ erst aus dem 9. Jahrhundert (während Flavius Josephus selbst um 100 nach Christus starb).
– Geburt in Betlehem –
Geht man davon aus, dass Jesus wirklich lebte, war das zu einer Zeit, als Palästina aufgeteilt war in das südliche Judäa (mit Jerusalem) und das nördliche Galiläa. Hier im Norden, in Nazareth, verkündet den Evangelien zufolge der Heilige Geist der Jungfrau Maria die Geburt Jesu (angeblich am Ort der heutigen Verkündigungskirche). Vermutlich wurde Jesus auch hier in Nazareth geboren. Darüber gibt es widersprüchliche Angaben im ganzen Neuen Testament, jedenfalls versuchen die Evangelien Betlehem als Geburtsort festzuschreiben, denn dem Alten Testament zufolge stammt David aus Bethlehem und auch der von den Juden erwartete Messias muss aus dem Haus David respektive aus Betlehem stammen. So heißt es zum Beispiel schon im Alten Testament beim Propheten Micha (5,1) unter der Überschrift „Der künftige Herrscher aus Betlehem“: „Und du, Betlehem-Efrata, / … aus dir wird er für mich hervorgehen, / um Herrscher zu sein über Israel.“ Den Evangelien zufolge müssen Maria und Josef nach Betlehem, weil der römische Kaiser Augustus eine Volkszählung befiehlt. Laut dem Lukasevangelium hatte er angeordnet, dass sich jeder an seinen Herkunftsort zu begeben habe, um sich dort in die Steuerlisten einzutragen.
In Betlehem wird Jesus den Evangelien zufolge in der „Krippe“ einer „Herberge“ geboren. Die „Herberge“ wurde wohl falsch übersetzt, es handelte sich wohl eher um ein gewöhnliches Wohnhaus (eher nicht am Ort der heutigen Geburtskirche), in dem aber auch noch Tiere gehalten wurden, das heißt die „Krippe“ stand vermutlich nicht in einem extra Stall, den es zu dieser Zeit noch gar nicht gab, sondern im Erdgeschoss (oder Keller) eines Wohnhauses, das damals für die Tiere genutzt wurde, während die Menschen im Obergeschoss wohnten. Dort kommt Jesus zwischen 6 und 4 vor Christus zur Welt. Das genaue Datum ist unbekannt, denn beim Erstellen des christlichen Kalenders im 6. Jahrhundert ist einem Mönch ein Fehler unterlaufen. Das Neue Testament spricht im Anschluss an die Geburt von einer Flucht der Familie nach Ägypten, um der, von Herodes befohlenen, Tötung aller Neugeborenen zu entgehen.
Über die Adoleszenz von Jesus berichten die Evangelisten nichts, nur Matthäus bemerkt in Kapitel 13, dass Jesus auch Brüder und Schwestern hatte, man erfährt aber sonst nichts über sie. Von seinem Vater Josef heißt es, dass er Zimmermann war, in der griechischen Übersetzung steht aber nur „tecton“, was „Handwerker“ bedeutet (jedenfalls war er nicht in der Landwirtschaft tätig).
– Johannes der Täufer –
Nach seiner Geburt taucht Jesus in den Evangelien das nächste Mal erst wieder auf, als er Johannes den Täufer trifft. Laut Johannesevangelium ist das in Betanien in der Nähe von Jericho, wo der Jordan ins Tote Meer mündet. Jesus ist zu diesem Zeitpunkt etwa 30 Jahre alt.
Die Existenz von Johannes dem Täufer wird von dem jüdischen Historiker Flavius Josephus (37/38-100) als einziger Quelle unabhängig vom Neuen Testament bestätigt. Über ihn ist jedoch nicht viel bekannt, nur Lukas (1,80) berichtet davon, dass der Täufer in jungen Jahren „in der Wüste (lebte) bis zu dem Tag, an dem er den Auftrag erhielt, in Israel aufzutreten“. Es wurde darüber spekuliert, ob Johannes (oder sogar Jesus, der ja in der Nähe lebte) Essener gewesen sein könnte? Auch wenn sich das archäologisch nicht belegen lässt, lebte die Wüstenbruderschaft ebenfalls am Nord-West-Ufer des Toten Meeres. Das zumindest leiten manche aus den Qumran-Texten, die zwischen 1947 und 1956 dort gefunden wurden, her, wenngleich nicht bewiesen ist, dass diese Schriftrollen tatsächlich auch von den Essenern stammen. Allerdings sagt der Täufer im Johannesevangelium (1,23) über sich selbst: „Ich bin die Stimme eines Rufers in der Wüste“. Auffällig zumindest ist ihre gemeinsame Abneigung gegen die schriftgelehrten Priester, die Phärisäer (von „paruschim“, „die Abgetrennten, die sich Fernhaltenden“) im Tempel von Jerusalem.
Beim Wüstenaufenthalt der Essener handelt es sich insbesondere auch um eine Kritik am „unreinen Tempelkult“ in Jerusalem, weshalb sie tägliche Waschungen praktizierten. Gottlosigkeit und Unreinheit sollen mit dem Rückzug in die Wüste geheilt werden. Auch Johannes stellt sich als Täufer bewusst außerhalb der Institutionen, obwohl er Lukas zufolge sogar Sohn eines Tempelpriesters gewesen sein soll: Bei ihm tritt an die Stelle der Tempelriten ein Tauf-Ritus, der auch mit einem Heilsmotiv verbunden ist, nämlich mit der Vergebung der Sünden: Von allen rituellen Waschungen des Judentums unterscheidet sich die Johannestaufe als originäre Schöpfung des Täufers insbesondere dadurch, dass sie einen sündenvergebenden Charakter hat. Ihr Sinn, so der Religionswissenschaftler Reinhard Meßner in seiner „Einführung in die Liturgiewissenschaft“ (2001), „besteht in der Gewährung von Heil bzw. in der Verschonung vor dem [Jüngsten] Gericht. Dies ist für den Täufer an die Umkehr als Rückwendung zur göttlichen Lebensordnung (der Tora) sowie an die Taufe gebunden, welche eine ‚Taufe der Umkehr zur Vergebung der Sünden‘ (Mk 1,4) ist. Umkehr und Taufe schaffen in der letzten Zeit vor dem Einbruch Gottes Sündenvergebung; sie treten damit im Verständnis des Johannes offensichtlich an die Stelle der Versöhnungsriten im Tempel“, wo am Versöhnungstag (Jom Kippur) einem Widder als „Sündenbock“ symbolisch die kollektiven Sünden auferlegt wurden, bevor er in die Wildnis geschickt wurde (heute kreisen orthodoxe Juden alternativ auch ein „Sündenhuhn“ drei Mal um den Kopf).
Die Taufe des Johannes vollzieht sich als eine Art Reinszenierung des Exodus, merkt Meßner an. Neben anderen Hinweisen wie dem Nomadengewand, weist nicht zuletzt der Ort der Johannestaufe am Ostufer des Jordan, genau an der Stelle, an der Israel unter Josua in das „Gelobte Land“ eingezogen ist, darauf hin. Meßner schreibt in diesem Zusammenhang: „Johannes führt damit das Volk … symbolisch aus dem Land heraus, genau an die Grenze zwischen Wildnis (‚Wüste‘) und dem verheißenen Gottesland; er stellt damit die Situation Israels unmittelbar vor dem Einzug wieder her. Die Hineinführung in das Land, das für die unmittelbar bevorstehende Heilszeit steht, die Überschreitung der Grenze – die durch den Jordan markiert ist – ist dem Kommenden (Gott) selbst vorbehalten.“
Das Johannesevangelium stellt Johannes den Täufer schon im Prolog in den Fokus (1,19-34): er wirkt hier zeitlich bereits vor Jesus in der Öffentlichkeit, „erkennt“ diesen aber als den Kommenden, als er ihn sieht (1,29): „Seht, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. (…) Dieser ist der Sohn Gottes.“
Während Jesus bei den Synoptikern von Johannes getauft wird (obwohl er bei Matthäus sagt, dass nicht er Jesus, sondern umgekehrt Jesus ihn taufen sollte), erkennt der Täufer im Evangelium nach Johannes an, Jesus nachgeordnet zu sein: Die Wassertaufe antizipiere nur rituell die göttliche Geisttaufe – er sei nicht der Messias, er taufe schließlich nur „mit Wasser“, während Jesus „mit heiligem Geist tauft“ und die Sünden nicht nur vergeben, sondern sogar hinwegnehmen kann.
Ob Jesus selbst die „Bußtaufe“ durchführte, wie im Johannesevangelium (3,22 und 4,1) angedeutet wird, ist unklar. Jedenfalls stehen die beiden nicht in Rivalität zueinander: Jesus nicht, der sagt (3,5): „Wer nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann nicht in das Reich Gottes gelangen“, aber auch Johannes der Täufer nicht, der zu seinen Jüngern sagt (3,28): „Ihr seid meine Zeugen, dass ich gesagt habe: Ich bin nicht der Christus, sondern ich bin vor ihm her gesandt“; wohl aber die Jünger des Jesus und die des Johannes (3,25).
Dennoch scheint es dem Verfasser des Johannesevangeliums, anders als den Synoptikern, wichtig herauszuheben, dass Jesus nicht aus der Bewegung des Täufers hervorging und nicht als Jünger von Johannes dem Täufer erscheint. Der Täufer wird von ihm gewissermaßen als letzte Station einer theologischen Erneuerungsbewegung innerhalb des Judentums gezeichnet, aber erst mit Jesus beginnt das Reich Gottes – und das Christentum als eine Abspaltung vom Judentum.
– Herodes Antipas –
Bald nach der Begegnung mit Jesus, um das Jahr 27/28 oder 30/31, wird Johannes der Täufer verhaftet. Seine Wirkungsstätte in Betanien lag im Einflussbereich des jüdischen Königs Herodes Antipas, dem Sohn von Herodes dem Großen.
Herodes Antipas regierte zur Zeit Jesu als jüdischer König des nördlichen Galiläa-Peräa. Er ließ die etwa acht Kilometer nördlich von Nazareth gelegene Stadt Sepphoris nach deren Zerstörung im Jahr 4 vor Christus durch Publius Quinctilius Varus, den römischen Gouverneur von Syrien, unter dem Namen Autokratis neu aufbauen. (Varus, der wenig später als Statthalter in Germanien in der sogenannten „Hermannsschlacht“ fällt, übte als Statthalter von Syrien eine Kontrollfunktion über das benachbarte Königreich Judäa aus, wo es nach dem Tod von Herodes dem Großen im Jahr 4 vor Christus zu schweren Unruhen kam.) Erst im Jahr 19 nach Christus verlegte Herodes Antipas sein Machtzentrum in die ebenfalls neu errichtete Stadt Tiberias am Westufer des Sees Genezareth. (Nach der Zerstörung Jerusalems im Jahr 70 nach Christus wurde Tiberias das geistige und religiöse Zentrum der Juden: hier wurde gegen 210 die Mischna fertiggestellt, bis um 400 entstand die Genara und bis etwa 450 wurde hier der palästinensische Talmud vollendet sowie der masoretische Text des Alten Testaments fertiggestellt.)
Den Evangelien (Mk 6,18) zufolge wurde Johannes der Täufer deshalb ins Gefängnis geworfen, weil er es gewagt hatte, den doppelten Ehebruch des Herodes Antipas öffentlich zu kritisieren (Herodes Antipas verliebte sich in die Frau seines Halbbruders und verstieß deshalb seine erste Frau). Nach Meinung von Flavius Josephus allerdings war der Grund für seine Inhaftierung, dass Herodes fürchtete, „das Ansehen des Mannes, dessen Rat allgemein befolgt zu werden schien, möchte das Volk zum Aufruhr treiben“.
Als jüdischer König wollte Herodes Antipas auf die Akkulturation des Judentums ins Römische Reich hinwirken und fürchtet das Gefahrenpotential eines zelotischen Aufstands. Die Zeloten waren jüdische Nationalisten, die aber von einem religiösen Standpunkt aus gegen die römische Besatzung rebellierten („zelotisch“ heißt „die Idee des Neuen“, ernsthaft und als politische Gruppierung bedeutsam in Erscheinung traten die Zeloten allerdings erst zwischen 66-70 nach Christus beziehungsweise kurz nach dem Jüdischen Krieg). Nicht zuletzt deshalb wird Johannes der Täufer verhaftet: Wegen „Aufruhr und Mord“ (Lk 23,19) wurde bereits kurz zuvor ein sogenannter Barabbas von den Römern verhaftet – er steht vielleicht für politische Erneuerung; nun folgt ihm Johannes der Täufer ins Gefängnis – der vielleicht für eine religiöse Erneuerung steht.
Folgt man den Evangelien (Mk 6,17-29 und Mt 14,3-12) ist es die Tochter der zweiter Frau, Salomé, die Herodes dazu veranlasst, Johannes den Täufer zu enthaupten: Salomé soll Herodes dazu gedrängt haben, den Kopf des Täufers auf einem Silbertablett als Belohnung für einen Tanz zu erhalten. Das wird teilweise auch von Flavius Joseph bestätigt (während der Name Salomé in den Evangelien nicht fällt, verschweigt Flavius Joseph den Anlass für die Hinrichtung). Schließlich erfolgte im Jahr 28/29 oder 31/32 die Hinrichtung, den Evangelien zufolge am Geburtstag des Herodes Antipas.
– Erste Jünger –
Nach der Begegnung mit Johannes dem Täufer geht Jesus nach Kapernaun, das gegenüber von Tiberias liegt, am Nordufer des Sees Genezareth in Galiläa (es gehört noch zum Reich des Herodes Antipas). In Kapernaun gewinnt er mit den beiden Fischern Simon (später Petrus) und seinem Bruder Andreas seine ersten Jünger. Beide sind ungebunden, denn Junggesellen ohne Landbesitz können in dieser Zeit nicht heiraten. Unklar bleibt, ob Jesus selbst verheiratet war?
– Wunder und göttliche Zeichen –
Jesus predigt nur 3 Jahre, wahrscheinlich jedoch nur 2 Jahre, möglicherweise auch nur einige Monate. Dem Johannesevangelium (2,1-11) zufolge findet bereits zwei Tag nach der Begegnung mit Johannes dem Täufer die Hochzeit in Kana statt. Hier findet das erste Wunder statt, das sogenannte „Weinwunder“: die wundersame Verwandlung von sechs Krügen Wasser zu je 39,5 Liter in Wein – das erste göttliche Zeichen Jesu.
Der Wein symbolisiert in der Bibel das Fest und die Lebensfreude (Ps 104,15) und er lässt die Menschen „die Herrlichkeit der Schöpfung“ spüren, wie der Psalm überschrieben ist. Die Überfülle des Weins auf der Hochzeit kann als Hinweis auf das Leben in Fülle verstanden werden, das Gott dem Menschen zugedacht hat, jedenfalls wird das sogenannte „Weinwunder“ gewöhnlich angebracht, um zu zeigen, dass die Bibel keine Alkoholabstinenz fordert. (Darüber hinaus verweist die Verwandlung von Wasser in Wein auf Dionysos. Auch der Name „Kana“, der im griechischen „Rohrstock“ bedeutet, verweist auf den Dionysoskult, war der Rohrstock doch das Symbol der Begleiterinnen des Dionysos, der Bacchantinnen. Anders als die Bacchantinnen, die eine nähere Verbindung zu Gott über Rausch und Ekstase suchten, geht Jesus einen anderen Weg, auch wenn er selbst durchaus auch Wein trankt. Und anders als in der griechischen Mythologie werden auch keine Trankopfer für Gott in der Bibel erwähnt.)
Das Weinwunder war nur das erste von einigen weiteren göttlichen Zeichen, die Jesus dem Neuen Testament zufolge vollbrachte. Insbesondere die Wunderheilungen (allein mehrere Kapitel handeln von der Heilung von Lepra) oder gar Auferweckungen von den Toten wie bei Lazarus haben die Aufmerksamkeit der Menschen gefesselt – für sie sind die Wunder das Zeichen, dass es sich bei Jesus um den ersehnten Messias handelt. Das jedoch führt dem Johannesevangelium zufolge zur Spaltung im Volk (10,19-20): „Da kam es … zu einer Spaltung unter den Juden. Viele von ihnen sagten: Er hat einen Dämon und ist von Sinnen. (…) Andere sagten: Das sind nicht die Worte eines Besessenen. Kann etwa ein Dämon die Augen von Blinden auftun?“
– Todesbeschluss des Hohen Rates –
Die Spaltung des Volkes rief nicht nur die jüdischen Priester auf den Plan, sondern insbesondere auch den römischen Statthalter von Judäa: Pontius Pilatus, zumal sich die Situation inzwischen auch in politischer Hinsicht verschärfte, da nicht nur Barabbas, sondern auch seine beiden Stellvertreter Dismas und Gestas verhaftet wurden, weshalb die Unruhe im Volk zunahm.
Auf Jesus waren nun alle Augen gerichtet und man riet ihm, von Jerusalem fern zu bleiben. Dort nämlich hat der jüdische Hohe Rat unter dem Hohepriester Kaiphas (Kajafas), dem Johannesevangelium (11,53) zufolge, „beschlossen, dass sie ihn töten wollten“. Kaiphas zerstreute alle Zweifel und überzeugte den Hohen Rat damit, dass es bestimmt „von Vorteil wäre, wenn ein einzelner Mensch für das Volk stirbt und nicht das ganze Volk zugrunde geht“ (11,50). Außerdem beschlossen die Hohen Priester „auch Lazarus zu töten, denn seinetwegen gingen viele Juden hin und glaubten an Jesus“ (12,10-11).
Im Evangelium von Johannes war Jesus bereits zweimal zuvor in Jerusalem, stets zu den religiösen Festtagen, und auch dieses mal, zu Passa (Pessach), wollte er nicht auf den Tempelbesuch verzichten. Diesmal jedoch sollte er, wiederum Johannes zufolge, von Judas Iskariot, einem seiner Jünger, der „ein Dieb war und als Kassenverwalter Einnahmen auf die Seite schaffte“ (12,6) und dem „der Teufel … schon eingegeben hatte, ihn auszuliefern“ (13,2), verraten werden.
– Einzug in Jerusalem –
Jesus ist etwa 34 Jahre alt, es ist etwa das Jahr 30 nach Christus, als er sich auf den Weg nach Jerusalem zum Pessachfest macht. Und da er mit dem Alten Testament beziehungsweise Sacharja (Zacharia), dem vorletzten Buch vertraut war, wusste er, dass der Messias auf einem Esel in Jerusalem einreiten wird (Sach 9,9). Überhaupt wurde von Zacharia schon viel von dem vorweggenommen, was später von den Evangelisten übernommen wird. So erfolgt ihm zufolge die letztendliche Rettung des belagerten Jerusalems beispielsweise von dem, „den sie durchbohrt haben“ (Sach 12,10), der „demütig und auf einem Esel reitend“ (Sach 9,9) in der Stadt einzieht und „den Geist der Unreinheit … aus dem Land (schafft)“ (Sach 13,2) an jenem Tag, an dem „seine Füsse auf den Ölberg (treten)“ (Sach 14,4).
Bei seinem Einzug, so berichtet es das Johannesevangelium (12,18), zog ihm das Volk entgegen, „das bei ihm gewesen war, als er Lazarus aus dem Grab gerufen und ihn von den Toten auferweckt hatte“. Ungeheure Menschenmassen dürften sich zum fünftägigen Pessachfest in Jerusalem aufgehalten haben, vermutlich etwa 100.000 Menschen (davon die überwiegende Mehrheit als Besucher). Als Symbol für das nahende Ende der Unterdrückung begrüßten sie ihn mit Palmwedeln und riefen: „Hosanna, gepriesen sei, der da kommt im Namen des Herrn, der König Israels.“ (12,13).
Johannes beschreibt diese Begrüßungsszene mit „Palmzweigen“ (12,13). Die jedoch gibt es im Frühling noch gar nicht (das gilt vielleicht auch für die reifen Feigen, die Jesus sucht, weil er hungrig ist, wie von Markus (11,12-25) und Matthäus (21,18-22) in der „Verfluchung des Feigenbaums“ beschrieben). Es wäre also denkbar, dass Jesus bereits im Herbst, zum Laubhüttenfest (Sukkot), festgenommen, aber erst zu Pessach im Frühling gekreuzigt wurde.
In Jerusalem beauftragte Jesus seine Jünger, einem Hausbesitzer auszurichten, dass der Tag gekommen sei und er einen Saal herrichten solle, damit er dort das Pessachfest feiern könne. Übernachten wolle er im Freien, zwischen Ölbäumen im Kidrontal, direkt neben dem Tempelberg – dem gegenüber der Ölberg mit dem Garten Getsemani (vom hebräischen „Gat-Schmanim“, „Ölpresse“) liegt, wo Jesus in der Nacht vor seiner Kreuzigung betete.
– Tempelreinigung –
Während bei Matthäus und Lukas Jesus nach seinem Einzug in Jerusalem zunächst den Tempel von den Händlern reinigt, erfolgt diese Tempelreinigung bei Markus und Johannes früher in Jesus` Leben, im Johannesevangelium (2,13-22) bereits wenige Tage nach der Geschichte von der Verwandlung von Wasser in Wein auf der Hochzeit in Kana, allerdings auch im Rahmen eines Pessachfestes (bei seinem ersten Besuch in Jerusalem).
Alle Evangelien zeichnen in dieser Szene einen zornigen Jesus, im Johannesevangelium jedoch richtet sich sein Zorn nicht auch auf das jüdische Volk, sondern ausschließlich auf die Tempelangestellten, das heißt die gewinnorientierten Wechsler (nur der sogenannte „Tyrische Schekel“ war als Tempelwährung zugelassen) und Verkäufer der Opfertiere (und auch Weintrauben), die er mit einer Geißel aus dem Tempel vertreibt und so gewissermaßen auch das Ritual des Opfers beendet.
Schon Sacharja bringt das Ende des Opferkults mit dem Sieg Gottes und der Rettung Jerusalems von der Belagerung in Verbindung: Es endet damit (Sach 14,21), dass „im Haus des Herrn … kein Händler mehr sein (wird) an jenem Tag“. Die Tempelreinigung durch Jesus erhält so einen endzeitlichen, eschatologischen Charakter: ein neuer, besserer Tempel tritt an die Stelle des alten. Im Johannesevangelium heißt es in diesem Zusammenhang (2,18-21): „Da entgegneten ihm die Juden: Was für ein Zeichen kannst du uns vorweisen, dass du dies tun darfst? Jesus entgegnete ihnen: Brecht diesen Tempel ab, und in drei Tagen werde ich ihn aufrichten. Da sagten die Juden: Sechsundvierzig Jahre wurde an diesem Tempel gebaut, und du willst ihn in drei Tagen aufrichten? Er aber sprach von seinem Leib als dem Tempel.“
Anders als bei Markus (13,2), wo Jesus den Tempel niederreißen will („Hier wird kein Stein auf dem andern bleiben, jeder wird herausgebrochen“), sollen ihn bei Johannes die Juden selbst zerstören – er baue ihn neu wieder auf. Aus der Perspektive der jüdischen Hohepriester jedoch ist das eine Anmaßung. Jesus jedoch geht es hier nicht um die Zerstörung des Tempelgebäudes, sondern um die (Wieder-)Herstellung des wahren Tempelkultes respektive des wahren „Reich Gottes“.
– Jesus und die Hohepriester –
Im Konflikt zwischen Jesus und den Hohepriestern ist das Urteil über ihn bereits vor der Tempelaktion gefällt. Sein Streit mit ihnen beginnt nicht erst im Tempel, sondern vorher, zu der Zeit, als er auf dem Land zu predigen beginnt – in Galiläa. Hier schon provoziert er durch die vollbrachten Wunder und der Verkündung des bevorstehenden „Reich Gottes“. Und hier auch hat Jesus Rückhalt im Volk – was man von Judäa jedoch nicht behaupten kann – und initiiert eine „Bewegung“, die jedoch erst bei seinem Einzug in Jerusalem auch zur realen Bedrohung wird.
Römische Besatzung und Hohepriester bilden zur Zeit Jesu quasi eine Interessengemeinschaft, die Priester agieren gewissermaßen als Exekutive (Polizei) und Ankläger für die römische Besatzungsmacht: Wurden die Hohepriester, zum Beispiel Kaiphas, früher noch von den jüdischen Königen, zum Beispiel Herodes dem Großen, ausgesucht, wurden diese später, wie Flavius Josephus bemerkt, von den römischen Statthaltern ernannt. Die Hohepriester waren zwar die Verantwortlichen für die Einhaltung der jüdischen Gesetze, der Tempel jedoch hatte keine politische Bedeutung für die Römer, deshalb schützten sie ihn sogar: Die Macht der Priester stützte sich auf die Römer, die im Tempelbezirk eine Garnison namens „Antonia“ hatten. Die Hohepriester waren insofern Protegés der römischen Besatzung – deshalb hielten sich die wirklich religiösen Juden von Anfang an vom Tempel fern.
Aufgrund der systematischen Verstrickung zwischen Priesterschaft und römischer Besatzungsmacht allerdings wird Jesus` Konflikt mit ihnen von Beginn an politisch verstanden: Seine Kritik an der Tempelpraxis erscheint als gegen die Integration des Judentums ins römische Reich im allgemeinen gerichtet; und das von Jesus prophezeite kommende „Reich Gottes“ wird auch als eine mit der Religion verknüpfte sozio-ökonomische Realität verstanden (schon Moses war ja ein reales Stück „Gelobtes Land“ von Gott verheißen).
– Die Reden des Rabbi aus Galiläa –
Anders als die Priester war Jesus ein „Rabbi“ („Meister“) aus Galiläa, an dem sich das Volk orientierte, etliche Male wird diese Bezeichnung im Neuen Testament für Jesus (von seinen Jüngern) benutzt. Anders als der aus dem Volk kommende „Rabbi“ Jesus waren die meisten „Rabbiner“ zu jener Zeit Pharisäer – jene „Gelehrten“, welche die Schrift auslegten und in der Diskussion entfalteten. (Die Bezeichnung „Rabbiner“ hat sich im Kirchenlatein zu „Rabbi“ gewandelt.) Nicht sie jedoch machten das jüdische Gesetz, sondern die der reichen Oberschicht angehörigen Saduzäer und insbesondere die Hohepriester (Gesetze sind nicht nur politisch, sondern auch religiös motiviert).
Obwohl Jesus als „Rabbi“ tituliert wird, ist er kein Anhänger der schriftlichen, sondern der mündlichen Überlieferung der jüdischen Religion. Es gibt nur eine einzige Szene im Neuen Testament, in der Jesus schreibt. Im Johannesevangelium (8,5-8) heißt es in der Szene mit der Ehebrecherin: „Meister, diese Frau ist beim Ehebruch auf frischer Tat ertappt worden. Im Gesetz aber hat Mose uns vorgeschrieben, solche Frauen zu steinigen. Du nun, was sagst du dazu? (…) Jesus aber bückte sich und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie immer wieder fragten, richtete er sich auf und sagte zu ihnen: Wer unter euch ohne Sünde ist, werfe als Erster einen Stein auf sie! Und er bückte sich wieder und schrieb auf die Erde.“
Obwohl Jesus hier zwar auch einmal schreibt (es wird nicht gesagt, was er in den Sand schrieb, man erfährt nur, dass er sich so eines Urteils enthält), dominiert bei ihm Johannes zufolge die mündliche Rede. In einer Einleitung zum Johannesevangelium in der „Zürcher Bibel“ von 2007 heißt es in diesem Zusammenhang: „In Joh 1,19-12,36 wird das Wirken Jesu in der Öffentlichkeit geschildert (…) Der johanneische Jesus hält zwar lange, kunstvolle Reden – doch er spricht nicht nur, er ist selbst das Wort (Joh 1,1), nicht irgendein Wort, sondern das Wort überhaupt, der Logos, der am Anfang der Schöpfung der ganzen Welt sein Gepräge gab (Joh 1,3) …“.
Anders als die Pharisäer, die die Thora abschrieben und kopierten, und die Hohepriester, die die Gesetze festschrieben, war Jesus ein Befürworter der mündlichen Überlieferung und der Rede. Wie vor ihm bereits Sokrates hat er keine schriftlichen Aufzeichnungen hinterlassen, die intellektuelle Leidenschaft des Umgangs mit den Wörtern war ihm fremd. Stattdessen nahm er die Sprachgewohnheit des Volkes an – das volkstümliche Sprechen in Gleichungen: Viele seiner Predigten, bemerkt Adolf Holl, erfolgten in Gleichnissen (die auf die Gegenwart bezogen sind), zum Beispiel in der Bergpredigt (Mt 7,3): „Warum siehst du den Splitter im Auge deines Bruders, aber den Balken in deinem Auge bemerkst du nicht?“; oder: „Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher in das Reich Gottes gelangt“ (Mk 10,25).

Lucas Cranach der Jüngere, Der Weinberg des Herrn (1569), Stadtkirche Wittenberg
– Der wahre Weinstock –
In seinen Gleichnissen spricht Jesus immer wieder über Wein. Seine Reden sind durchdrungen von Wein-Symbolik – wie die beiden Testamente insgesamt: „An weit über 300 Stellen wird vom Wein, vom Weinstock, vom Weinberg, vom Winzer, von der Traube, der Rebe oder der Kelter gesprochen“, insgesamt werden etwa 88 Begrifflichkeiten in diesem Zusammenhang verwendet, die an 810 Stellen auftauchen, bemerkt Paul-Georg Gutermuth in „Der Wein und die Bibel“ (2007). Nicht zuletzt diese Häufigkeit verweist auf eine breite Weinkultur in Palästina zur Zeit Jesu.
In Zusammenhang mit der Passionsgeschichte wird im Johannesevangelium insbesondere der Begriff des Weinstocks bemüht, dem Jesus nun jedoch einen gänzlich neuen Sinn gibt. In der Geschichte „Der wahre Weinstock“ (15,1-17) findet die Wein-Symbolik vielleicht sogar ihren Höhepunkt, Jesus sagt hier: „Ich bin der wahre Weinstock, und mein Vater ist der Weinbauer. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, nimmt er weg, und jede, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie noch mehr Frucht bringt. (…) Wie die Rebe aus sich heraus keine Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so könnt auch ihr es nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wer nicht in mir bleibt, wird weggeworfen wie die Rebe und verdorrt; man sammelt sie und wirft sie ins Feuer, und sie verbrennen.“
Der Weinstock taucht schon vor dem Johannesevangelium in „Das Lied vom Weinberg“ bei Jesaja (5,1-7) auf, allerdings wird er dort als alttestamentliches Bild für das gesamte Volk Israel benutzt. Jesaja schreibt: „Mein Freund hatte einen Weinberg, an steiler Höhe, überaus fruchtbar. Und er grub ihn um und befreite ihn von Steinen, und er bepflanzte ihn mit edlen Reben, und in seiner Mitte baute er einen Turm, und auch eine Kelter schlug er darin aus. Und so hoffe er, dass er Trauben trage (…) Der Weinberg des Herrn der Heerscharen ist das Haus Israel, und die Männer aus Juda sind, was er aus Leidenschaft gepflanzt hat.“
Im Wein begegnen sich in der Bibel zwei Ebenen: die irdische und die göttliche, „wobei sich die innere Dramatik des Themas vom Alten zum Neuen Testament hin steigert“, wie Paul-Georg Gutermuth feststellt. Wie er ausführt, wird Wein im Alten Testament „zum Maßstab für die Treue und Untreue des Gottesvolkes im Verhältnis zu Jahwe“. Dieses Bild wird von Johannes aufgegriffen und verwandelt, christlich umgedeutet gewissermaßen, wenn sich Jesus selbst als Weinstock bezeichnet: Als seine „Reben“ sind die Menschen nur in Verbindung mit ihm „fruchtbar“, andernfalls „verdorren“ sie. Ohne dieses Bild überstrapazieren zu wollen, lässt sich von hier eine gedankliche Brücke zum Letzten Abendmahl spannen, wo der reale Wein als Mittel oder Zeichen der Verbindung zwischen Jesus und den Jüngern dient – und darüber hinaus sogar zum Blut Christi wird.

Leonardo da Vinci, Das letzte Abendmahl, Santa Maria delle Grazie, Mailand (Wie Bach ist Leonardo da Vinci der typische Renaissance-Künstler: Hier dominiert eine biblische Szene, aber er hat auch das weltliche Porträt der Mona Lisa gemalt.)
– Das letzte Abendmahl –
Während im Johannesevangelium das Bild vom Weinstock als Volk Israel aufgegriffen und umgeschrieben wird, wenn Jesus sich als „wahren Weinstock“ bezeichnet und sich an deren Stelle setzt, greifen die synoptischen Evangelien das jüdische Verständnis von Wein als dem Symbol für den alt(testamentarisch)en Bund zwischen Israeliten und Jahwe in der Szene des Letzten Abendmahls auf, wo die Bedeutung des Weins zum Symbol für den Neuen Bund wird.
Den Synoptikern zufolge lud Jesus am Abend vor Pessach die Jünger zum letzten Abendmahl. Festmahle ohne Wein waren damals praktisch undenkbar – feiern und trinken war in einer Weise vereint, dass sich sogar der hebräische Begriff für „Fest“ vom hebräischen Verb für „trinken“ ableitet. Und auch zum Pessachmahl, das traditionell Ende März/Anfang April stattfindet, gab es keinen unvergorenen Traubenmost mehr, da die Lese in Palästina bereits von Juli bis September stattgefunden hatte und der Traubenmost bis jetzt nicht ohne zu gären gelagert werden konnte.
Obwohl Weißwein in Palästina relativ früh bekannt war, wie Gutermuth weiß, wurde damals hauptsächlich Rotwein getrunken. Dafür spricht, dass schon die alttestamentarischen Texte Rotwein direkt nennen – so heißt es zum Beispiel bei Jesaja (63,2): „Warum ist dein Gewand so rot und sind deine Kleider wie bei einem, der in der Kelter tritt?“; bisweilen wird auch das Wort „Traubenblut“ für Wein benutzt, wie zum Beispiel im Deuteronomium (32,14): „Traubenblut hast du getrunken, feurigen Wein“.
Schon im Alten Testament werden Wein und Blut also zueinander in Beziehung gesetzt. Im Neuen Testament greift Jesus in seinen Reden dieses Bild dann auf und öffnet eine neue Symbolwelt des Weines, das heißt, wie Gutermuth bemerkt, „der Wein selbst (wird) zum Symbol und zu einer neuen Wirklichkeit“: Nachdem Jesus nämlich vor dem gemeinsamen Mahl die Füße der Jünger als Geste der Demut gewaschen hatte und ihnen prophezeite, dass ihn Petrus drei Mal verleugnen werde, geschah den drei synoptischen Evangelien zufolge etwas Außergewöhnliches: Jesus bezeichnete das Brot als sein Leib und den Kelch mit Wein als sein Blut.
Im Einzelnen berichtet Lukas (22,14-20): „Und als die Stunde kam, setzte er sich zu Tisch, und die Apostel mit ihm. Und er sagt zu ihnen: Mich hat sehnlich verlangt, vor meinem Leiden mit euch dieses Passalamm zu essen. (…) Und er nahm einen Kelch, sprach das Dankgebet und sprach: Nehmt ihn und teilt ihn unter euch. Denn ich sage euch: Von jetzt an werde ich von der Frucht des Weinstocks nicht mehr trinken, bis das Reich Gottes kommt. Und er nahm Brot, sprach das Dankgebet, brach es und gab es ihnen und sprach: Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Und ebenso nahm er den Kelch nach dem Mahl und sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das vergossen wird für euch.“
Matthäus (26,17-29) schreibt: „Während sie aber assen, nahm Jesus Brot, sprach den Lobpreis, brach es und gab es den Jüngern und sprach: Nehmt, esst! Das ist mein Leib. Und er nahm einen Kelch und sprach das Dankgebet, gab ihnen den und sprach: Trinkt alle daraus! Denn das ist mein Blut des Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Ich sage euch aber: Ich werde von dieser Frucht des Weinstocks nicht mehr trinken von nun an bis zu dem Tag, da ich aufs Neue mit euch davon trinken werde im Reich meines Vaters.“
Und bei Markus (14,12-25) heißt es: „Und während sie assen, nahm er Brot, sprach den Lobpreis, brach es und gab es ihnen und sprach: Nehmt, das ist mein Leib. Und er nahm einen Kelch, sprach das Dankgebet und gab ihnen den, und sie tranken alle daraus. Und er sagte zu ihnen: Das ist mein Blut des Bundes, das vergossen wird für viele. Amen, ich sage euch: Ich werden von der Frucht des Weinstocks nicht mehr trinken bis zu dem Tag, da ich aufs Neue davon trinken werde im Reich Gottes.“
Einzig Johannes berichtet nichts dergleichen in Zusammenhang mit dem letzten Abendmahl. Er jedoch bereitet darauf schon vorher in der Synagoge in Kapernaun vor, wo er Jesus zitiert, als er sagte: „Ich bin das Brot des Lebens. (…) Wenn ihr nicht das Fleisch des Menschensohnes esst und sein Blut trinkt, habt ihr kein Leben in euch. Wer mein Fleisch verzehrt und mein Blut trinkt, hat ewiges Leben, und ich werde ihn auferwecken am Jüngsten Tag. Denn mein Fleisch ist wahre Speise, und mein Blut ist wahrer Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, bleibt in mir und ich in ihm.“
Letztlich berichten also alle vier kanonischen Evangelien von dieser Verwandlung von Wein in das Blut Christi. Steht der Wandel von Wasser in Wein am Beginn des öffentlichen Wirkens Christi, rückt gegen Ende dieses Wirkens der Wandel von Wein in sein Blut ins Zentrum, das nun zum Symbol für einen Neuen Bund wird. In diesem Bund wird Wein über natürliche Abläufe ins Transzendente erhöht: zu einem verbindenden Element zwischen irdischem und himmlischen Leben. Mit dem Trinken des Weins verabschiedet sich Jesus aus dem Diesseits, was aber sogleich zur Verheißung einer Zukunft wird, die ihrerseits als ein Gastmahl, eine Kommunion, angekündigt wird und eine neue Gestalt von Gemeinschaft und Gemeinsamkeit verspricht.
Im gemeinsamen Mahl bezieht Jesus die Zeichenhandlung auf seinen Tod. Er rekurriert dabei auf die Opfersprache des alten Israel, wo man Gott im Tempel Blutopfer darbrachte: Im Alten Bund werden Opfertiere, bisweilen insbesondere auch Lämmer (Schafe) geopfert, als Zeichen des Dankes gegenüber dem Schöpfer. Wenn Jesus nun den Wein zu seinem Blut macht, bezeichnet er sich letztlich selbst als Opfer. Diesen Bezug zwischen dem alttestamentlichen Tieropferblut und der Rolle, die Christus dem Wein einräumt, hat beispielsweise Lothar Becker in „Rebe, Rausch und Religion“ (1999) hervorgehoben: „Der Gegensatz zwischen den Blutpraktiken des Alten Testaments und denen des Neuen Testaments liegt nicht im Unterschied von Tierblut und Christusblut begründet, sondern im Ersatz des animalischen Opferblutes durch den vegetabilischen mit numinosen Konnotationen verbundenen Wein, der zusammen mit dem Brot den verklärten Herrn der Kirche repräsentiert.“
Gemäß dem Auftrag Jesu: „Dies tut zu meinem Gedächtnis“, wie er im Lukasevangelium (22,19) formuliert ist, wird aus der einmaligen Handlung Jesu beim Letzten Abendmahl eine stets wiederholte Feier beziehungsweise Kulthandlung in der Eucharistie/Kommunion der christlichen Gemeinden. „Nach katholischem Verständnis“, schreibt Gutermuth, „werden in der Eucharistiefeier unter Anrufung des Heiligen Geistes mit den vom Priester gesprochenen Einsetzungsworten Brot und Wein zu Christi Leib und Blut (klassische Formel: Transsubstantiation; Wesensverwandlung); die Liturgie erinnert nicht nur an das Abendmahlmysterium, sie wiederholt es auch nicht, sie vergegenwärtigt es.“ Und so stellt Guthermuth abschließend fest: „Der Wein erfährt durch die Bibel seine tiefste Vergeistigung.“
– Der Verrat des Judas Iskariot –
Während in den drei synoptischen Evangelien das Abendmahlsgeschehen mit der Verwandlung des Weines in das Blut Christi im Zentrum steht, verliert das Johannesevangelium in Zusammenhang mit dem Letzten Abendmahl darüber kein Wort. Bei Johannes rückt an dieser Stelle stattdessen die Figur des Judas Iskariot in den Fokus. Nach der etwas breiter ausgeführten Fusswaschung sagt Jesus bei Johannes (13,21-30): „Amen, amen, ich sage euch, einer von euch wird mich ausliefern. (…) Der ist es, dem ich den Bissen eintauchen und geben werde. Dann taucht er den Bissen ein, nimmt ihn und gibt ihn Judas, dem Sohn des Simon Iskariot. Und nachdem der den Bissen genommen hatte, fuhr der Satan in ihn. Da sagt Jesus zu ihm: Was du tun willst, tue bald! Niemand am Tisch verstand, wozu er ihm das sagte. Denn weil Judas die Kasse hatte, meinten einige, Jesus wolle ihm sagen: Kaufe, was wir für das Fest brauchen, oder etwas für die Armen, damit ich etwas geben kann. Als nun jener den Bissen genommen hatte, ging er sogleich hinaus. Und es war Nacht.“
„Ist Judas der Schlechteste unter den Jüngern?“, fragt Michael Köhlmeier in seinem (Hör-)Buch „Der Menschensohn“ (2001). Ist er der Verräter oder wurde er von Jesus dazu aufgefordert („Was du tun willst, das tue bald!“)? Dass Judas Iskariot als Verräter dargestellt wird, ist bestimmt kein Zufall – möglicherweise ist der Verrat Judas sogar bereits im Namen angelegt: „Iskariot“ kann „der Mann, der aus Kariot stammt“ bedeuten, wobei „Is-“ dem Mann Wichtigkeit verleiht, und während die anderen elf Jünger alle aus Galiläa kommen, liegt Kariot in Judäa. Vielleicht aber stammt es auch von „Sicarius“, was „Dolchmann“ (von „sicari“ für „Dolch“) bedeutet und mit den Zeloten in Verbindung gebracht wird, da sie stets einen Dolch mit sich trugen; Judas hat dieser Deutung zufolge in Jesus den Befreier Israels gesehen, der (auch) die politische Führung eines Aufstands gegen die römische Besatzungsmacht hätte übernehmen sollen. Jesus aber sagte stattdessen (18,36): „Mein Reich ist nicht von dieser Welt.“ Der Verrat wäre demnach aus Enttäuschung erfolgt.
Judas erscheint unabhängig davon als einzige Kontrastfigur – nicht zuletzt, weil er nach der Kreuzigung Selbstmord begeht: Er erhängt sich, Johannes zufolge, nachdem er seinen Lohn, die von Matthäus (26,15) erwähnten „dreißig Silberstücke“, in den Tempel geworfen hat. Allerdings taucht sein Verrat zunächst gar nicht auf, das heißt seine Geschichte ist eine Legende, die erstmals im Markusevangelium entsteht. Von Paulus, von dem in zeitlicher Hinsicht die ältesten Geschichten des Neuen Testaments sind, erfährt man nichts von einem Verrat. Allerdings spricht auch Markus nicht von „Verrat“, wie dann später Johannes, sondern von „Auslieferung“, für die er seinen Judaslohn bekommt (der Legende nach ist Judas Iskariot nicht nur Kassenverwalter der Apostel, sondern auch privater Finanzberater von Pontius Pilatus).
So oder so wird den Juden in den Evangelien mit dem Verrat des Judas endgültig der Sündenbock der Geschichte zugeschrieben. (Damit die Christen kein schlechtes Gewissen haben müssen? Jedenfalls fällt ihnen der Nutzen der Tat zu, bemerkt Köhlmeier.) Allerdings bringt schon vorher das Paulinische Christentum den Mythos des verbrecherischen Judentums hervor: Auch ohne auf den Apostel Judas Iskariot einzugehen, äußerst sich Paulus antijüdisch, ähnlich wie Johannes, und macht die Juden für die Kluft zu den Christen verantwortlich. In seinem ersten Brief an die Thessalonier (2,14-16) schreibt er: „Denn ihr, liebe Brüder und Schwestern, seid dem Beispiel der Gemeinden Gottes gefolgt – der christlichen Gemeinden in Judäa –, da ihr von euren Mitbürgern dasselbe erlitten habt wie sie von den Juden. Diese haben den Herrn Jesus getötet und die Propheten, sie haben uns verfolgt, sie missfallen Gott und sind allen Menschen feind … so machen sie unentwegt das Maß ihrer Sünden voll. Aber schon ist der Zorn über sie gekommen in seinem vollen Ausmaß.“
Spätestens mit der „Judaslegende“ des Abraham a Santa Clara (1644-1709) wird Judas dann zum „Ertz-Schelm“ und ins Monströse verzerrt: Er greift Motive der Moseserzählung und des Ödipusmythos auf und beschreibt, wie Judas von seinen Eltern wegen einer unheilvollen Prophezeiung wie Mose auf dem Meer ausgesetzt und in einem fremden Königshaus aufgezogen worden sei. Dort wurde er zum Mörder an seinem Stiefbruder und nach seiner Rückkehr nach Judäa zum Mörder seines Vaters, bevor er unwissentlich seine Mutter heiratete, die sich daraufhin erhängte.
Gefangennahme (2.-5.)
Unmittelbar, mitten ins Geschehen springend, setzt Johann Sebastian Bach seine Erzählung der Johannespassion nach dem eröffnenden Exordium mit dem Verrat des Judas Iskatiot ein. Der Evangelist rezitiert (2.): „Jesus ging mit seinen Jüngern über den Bach Kidron, da war ein Garten, darein ging Jesus und seine Jünger. Judas aber, der ihn verriet, wusste den Ort auch; denn Jesus versammelte sich oft daselbst mit seinen Jüngern. Da nun Judas zu sich hatte genommen die Schar und der Hohenpriester und Pharisäer Diener, kommt er dahin mit Fackeln, Lampen und mit Waffen …“ Auf Judas Iskariots Zeichen, den „Judaskuss“, nehmen römische Soldaten Jesus gefangen. Petrus ergreift daraufhin das Schwert und trennt einem Soldaten das Ohr ab, worauf Jesus spricht (18,11): „Steck das Schwert in die Scheide! Den Kelch, den mir mein Vater gegeben hat – soll ich ihn etwa nicht trinken?“, und heftet dem Soldaten das abgeschlagene Ohr wieder an.
Bach schildert die Passionsgeschichte des Johannesevangeliums insgesamt reportageartig: Während die Arien Momente der persönlichen Reflexion und der subjektiven Empfindung widerspiegeln – ganz dem bürgerlichen Geschmack seiner Zeit entsprechend –, gilt das nicht für die Berichte des Evangelisten: Diese sind, im Unterschied zu den liedhaften Arien, bisweilen in Rezitativform gehalten, ohne dabei, wie in der Oper, die Funktion zu haben, „in möglichst gedrängten Sätzen die Handlung voranzutreiben und den Sängern ihr Stichwort für die nächste Arie zu geben“, wie Martin Geck schreibt.
Die Worte des Evangelisten wurden traditionell immer von einem stimmlich strapazierfähigen Tenor gesungen, und zwar in der Form eines Rezitativs (Recitativo secco). Damit bezeichnet man eine Art Sprechgesang, eine musikalische Deklamation, die sich nur auf die Akkorde eines Basso continuo stützt. Bach gestaltete diese Rezitative jedoch mit außerordentlicher Expressivität, jedoch weit davon entfernt Opernrezitative zu sein. Das gilt auch schon für das Rezitativ am Beginn des I. Akts (2.)
Zu einem wichtigen Mittel im Hinblick auf die Expressivität des Evangelisten wird Bach die melodische Linie: da gibt es weite Tonsprünge und eine Fülle schwieriger Intervalle – allein dem Tonhöhenverlauf gewinnt Bach so schon eine außergewöhnliche Anschaulichkeit ab. Bertolt Brecht bezeichnet diesen Anfang sogar als „Musterbeispiel gestischer Musik“: Bereits mit den ersten Evangelistenworten („Jesus ging mit seinen Jüngern über den Bach Kidron“) „wird die Lokalität des Baches genau bezeichnet“, sagt Brecht. Und der Komponist Hanns Eisler ergänzt ihn in einem Gespräch (1958) mit dem Musikwissenschaftler Hans Bunge: „Der Tenor ist so hoch gesetzt, Ausdruck ist unmöglich, also Schwulst, Gefühlsüberschwang. Es wird referiert. Das heißt, es wird auch das Zeigen des Vorlesers mitgemacht.“ Das Theatrale, Darstellerische ist also Brecht zufolge schon der Musik immanent.
Das gilt dann in der Folge auch beim Angriff des Petrus auf einen Knecht des Hohepriester (4.): „Da hatte Simon-Petrus ein Schwert, und zog es aus, und schlug nach des Hohepriesters Knecht, und hieb ihm sein recht` Ohr ab …“ Bach betont hier das Wort „Schwert“, indem er es mit einem besonders dissonanten Intervall melodisch kennzeichnet und er schildert bildhaft, mit einer aufsteigenden Tonfolge, wie Petrus dieses Schwert aus der Scheide zog. Dissonanz dann auch, als Petrus dem Knecht das rechte Ohr abschlug – auch hier ist die Musik gestisch, wird die Gewalt musikalisch anschaulich.
Unter Gestus versteht Brecht nicht „Gestikulieren“, wie er in einem bis 1957 unveröffentlichten kurzen Text „Über gestische Musik“ (1932) schreibt, sondern „Gestisch ist eine Sprache, wenn sie auf dem Gestus beruht, bestimmte Haltungen des Sprechenden anzeigt, die dieser andern Menschen gegenüber einnimmt“. Dem Musiker solle dieses Prinzip „dazu verhelfen, seine Texte besonders lebendig und leicht aufnehmbar zu gestalten“. Entsprechend gliedert Bach die Sätze des Evangelisten wie ein guter Redner nach kleinen Sinnheiten: „er hebt betonte Wörter wie `Jesus´, `Jünger´, `Kidron´, `Garten´, `Judas´, `verriet´, `wußte´ hervor, indem er sie auf schwerem Taktteil erscheinen und/oder auf Spitzentöne singen lässt“, bemerkt Geck. Letztlich gestaltet Bach so auch „einen gesellschaftlichen Gestus“, wie Brecht sagt, das heißt er nimmt „musizierend eine politische Haltung ein“: Ganz dem Johannesevangelium entsprechend, betont Bach hier den Verrat des Judas Iskariot.
So wie traditionell ein Tenor den Part des Evangelisten übernimmt, wurden einem Bass die Worte Jesu anvertraut – und Bach verwendet auch hier die Form des Rezitatis. So unterscheidet sich die Partie des Jesus nicht grundlegend von der des Evangelisten, das heißt auch sie ist als gestische musikalische Rede gestaltet: Wenn Jesus den jähzornigen Petrus zurechtweist, dann gestaltet Bach das musikalisch mit einem abwärts gerichteten Intervall, so dass man das Einstecken des Schwerts in die Scheide über die Musik bildhaft vor sich hat. Der höchste Ton der ganzen Passage ist dem Wort „Vater“ vorbehalten. Und am Ende des Fragesatzes steht auch ein musikalisches Fragezeichen (4.): „Stecke dein Schwert in die Scheide. Soll ich den Kelch nicht trinken, den mir mein Vater gegeben hat?“
So ist es in der ganzen Johannespassion: Die Jesus-Partie wird von einer Bass-Stimme vorgetragen, die vom Basso continuo sparsam gestützt wird. Das allerdings hielten nicht alle für gelungen – wurde Jesus in anderen Passionsoratorien doch bisweilen vom gesamten Orchester begleitet (wie Bach selbst das dann auch wieder in seiner Matthäuspassion praktiziert), wobei die schwebenden Akkorde der Streicher für manche wie ein musikalischer Heiligenschein wirkten.
Zugleich aber wirkt die Darstellung Jesu dann aber auch lebendiger und menschlicher – und womöglich hat Bach genau deshalb auf diese orchestrale Begleitung verzichtet und favorisiert für die Johannespassion eine distanziertere, vielleicht etwas erhabenere musikalische Form. Jedenfalls wirken schon Jesus` erste Worte, die Frage an die Kriegsknechte: „Wen suchet ihr?“, herrisch und weit entfernt von irgendwelchen menschlichen Gefühlen wie Angst vor der Gefangennahme. Der Evangelist nennt dafür den Grund: „Als nun Jesus wußte alles, was ihm begegnen sollte …“ Der Jesus des Johannesevangeliums weiß, wie ihm geschehen wird – und lässt sich davon nicht beirren. Unangefochten verfolgt er seinen Auftrag, sich seiner umfassenden und entwaffnenden Autorität voll bewußt. Zwei Worte genügen ihm, um die Situation zu beruhigen: „Ich bin`s.“
Ganz bewußt, und völlig in Übereinstimmung mit der Sicht des Johannesevangeliums, gibt Bach den Jesusworten einen Ausdruck von Ruhe und Unnahbarkeit. Hier gibt es keinen Seelenkampf Jesu im Garten Gethsemane wie in den synoptischen Evangelien. Das ist eine Besonderheit des Johannesevangeliums, bemerkt Wieland Schmid in „Bachs Johannespassion – Stationen und Strukturen“ (1995) in diesem Zusammenhang, „denn manche Episoden, die in den anderen Evangelien dramatische Höhepunkte bilden, kommen bei Johannes gar nicht vor“.
Diesen für Bach bedauerlichen Mangel an dramatischen Szene gleicht er aus, indem er andere Handlungsträger in den Vordergrund bringt – und hier insbesondere auch das jüdische Volk, das vom Chor verkörpert wird. Wo der Chor als Menschenmenge und damit als Dialogpartner auftritt spricht man auch von einem Turba-Chor. Der Turba-Chor ist ein dramaturgisches Element und hat eine szenisch-dramatische Funktion – er wird von Bach entsprechend auch eingesetzt, um die Dramatik einer Szene zu steigern oder sie mit besonders dramatischer Musik in Szene zu setzen.
Besonders deutlich wird das im I. Akt, wo die fanatischen Rufe des Turba-Chors in einem krassen Kontrast zur erhabenen Ruhe der Jesusworte stehen. Tatsächlich gewinnt schon der Beginn der Erzählung in der Johannespassion gerade aus diesem Gegensatz ungeheure dramatische Durchschlagskraft (2.): „Da nun Judas zu sich genommen hatte die Schar und der Hohe Priester und Pharisäer Diener, kommt er dahin mit Fackeln, Lampen und mit Waffen. Als nun Jesus wußte alles, was ihm begegnen sollte, ging er hinaus, und sprach zu ihnen: `Wen suchet ihr?´ Sie antorteten: `Jesu, Jesu, Jesu von Nazareth …´“
Beinahe atemlos wird der Hörer von Bach in das Passionsgeschehen hineingeführt, fast hinein geworfen. Dann aber setzt Bach eine Zäsur – mit einem Choral (3.). Das ist ein, in eine musikalische Form gekleidetes, Gebet. Anders als der Turba-Chor hat es gerade keine szenisch-dramatische Funktion innerhalb der Passion, sondern man versteht darunter in der Liturgie der evangelischen Kirche ein einstimmiges, normalerweise von der Gemeinde gesungenes Kirchenlied. Der Choral hat insofern eher eine gemeinschaftsstiftende Funktion. In der Johannespassion erklingen insgesamt elf solcher Choräle – und wer will, so Wieland Schmid, kann in dieser Zahl einen Hinweis auf die elf getreuen Jünger Jesu sehen.
Die Choräle scheinen zunächst die musikalisch einfachsten Passagen der Johannespassion zu sein, ihre Melodien jedenfalls hatten die Zeitgnossen Bachs im Ohr (gleichwohl darf man nicht annehmen, dass sie auch von der gesamten Kirchengemeinde mitgesungen wurden – wohl eher schon nur vom Chor der Thomaskantorei). Aber auch hier sucht Bach nach gestischen musikalischen Mitteln: Für die „quälende Marterstraße“ beispielsweise fügt er bei den Frauenstimmen und auch im Bass symbolisch eine chromatisch abwärts laufende Passage bei „Marterstraße“ ein. Auch in den Chorälen also geht Bach weit über eine bloße Harmonisierung der Melodie hinaus und gibt stattdessen zugleich den Text in der Musik wieder.
Bachs Textausdeutung findet insofern also in den Rezitativen, bei den Turba-Chöre und nun auch im Choral statt – wohl am Stärksten entfaltet er „das sprechende und ausdrucksvolle Zusammenspiel von Wort und Musik“ aber, wie Schmid sagt, bei der Arie. Dabei handelt es sich um einen melodiebetonten Sologesang mit Instrumentalbegleitung. In der Oper dient die Arie zur musikalischen Schilderung von Zuständen, Stimmungen oder Gefühlen – für die Dauer einer Arie scheint die Bühnenhandlung dann still zu stehen. Ganz ähnlich im Oratorium: Auch da sind Arien sozusagen „Inseln im Fluss des dramatischen Geschehens“, wie Wieland Schmid sagt.
In den Arien der Johannespassion wird mal ein Vorgang beleuchtet, mal ein Gedanke vertieft – zum Beispiel das Geschehen bei der Verhaftung des gesuchten Jesus von Nazareth (6.): „Die Schar aber und der Oberhauptmann und die Diener der Jüden nahmen Jesu und bunden ihn.“ Jesus wird gefesselt – und aus diesem Vorgang erschließt der Libretist, wie Schmid bemerkt, einen verborgenen Sinn: „Die Stricke, mit denen Jesus gebunden wird, deuten symbolisch auf die Verstrickung hin, aus der die Passion des Heilands den Sünder erlöst.“ Um diesen Gedanken kreist die nachfolgende Alt-Arie (7.): „Von den Stricken meiner Sünden mich zu entbinden, wird mein Heil gebunden.“
Obwohl in den Arien Einzelne auftreten, waren alle Versuche, sie bestimmten Personen des Passionsgeschehens zuzuordnen, bislang wenig überzeugend. Insofern ist es, wie Schmid betont, sicher sinnvoller „in den Arien gefühlsbetonte Äußerungen persönlicher Gläubigkeit zu sehen. Ihre Sprache ist außerordentlich bildhaft, beinahe ekstatisch – was sich von der Sprache der Lutherbibel doch deutlich unterscheidet“.
Schon die Vorspiele zu den Arien schaffen eine dichte, den Inhalt musikalisch vorherdeutende Atmosphäre, wobei die sorgfältige Wahl der Begleitinstrumente, ihrer Klangfarbe, eine ganz wesentliche Rolle spielt – so dass man mitunter auch ohne Worte den Inhalt anhand der klanglichen Eigenschaften der begleitenden Instrumente nachvollziehen kann. „Überall sucht Bach im Text das Bild oder den Gedanken, der eine plastische musikalische Gestaltung ermöglicht“, schreibt Schmid in diesem Zusammenhang.
Immer wieder auch deuten musikalische Figuren theologische Zusammenhänge an, zum Beispiel später am Kreuz, als Jesus Johannes zufolge – und nur ihm zufolge – sagt: „Es ist vollbracht“. Bach vertont diesen letzten Worte Jesu (30.) so, dass man ihn auch wie ein Senken des Hauptes interpretieren kann. Die musikalische Geste dieser Passage wird dann in der nachfolgenden Arie der Altstimme aufgegriffen, zuerst aber auch schon im Vorspiel einer Viola da Gamba, die wiederholt: „Es ist vollbracht.“
Nun ist diese musikalische Figur innerhalb der Johannespassion aber nicht neu, wie Schmid bemerkt: Bereits in einer vorherigen Passage, nämlich wenn die Alt-Stimme einsetzt mit: „Von den Stricken meiner Sünden ….“ ist diese Tonfolge zu hören. Solche Entsprechungen sind bestimmt kein Zufall, sondern man darf schon davon ausgehen, dass Bach hier über die Musik ganz bewusst einen theologischen Zusammenhang herstellen wollte. Friedrich Smend (1893-1980) bemerkt in diesem Zusammenhang: „Vollbracht ist nicht nur Qual des Leidens, sondern die Befeiung von den Banden der Sünden“, also die Erlösung. Ganz in diesem Sinn auch ändert Bach am Schluß der Passion, als Jesus am Kreuz gestorben ist und die Altsimme sein langsames und schmerzvolles „Es ist vollbracht“ wiederholt, plötzlich und unerwartet den Takt, schreibt vivace (lebendig) als Tempo vor und forte (laut) als Lautstärke – und das Orchester setzt ein, fährt mitten in die Klage hinein, als gälte es einen Triumph zu feiern: „Der Held aus Juda siegt mit Macht …!“ Jesus wird hier gefeiert – und nicht einmal die Qualen der Kreuzigung können ihm, ganz in der Perspektive des Evangeliums von Johannes, etwas anhaben.
Verleugnung (6.-14.)
Stärker als die anderen Evangelisten, betont Johannes die Rolle der Juden respektive des Hohen Rates bei der Verhaftung und Verurteilung von Jesus. Das hat in der Aufführungsgeschichte der Johannespassion, insbesondere in der jüngeren Vergangenheit, immer wieder zu Kontroversen geführt. Dabei findet Bach auf solche Zuschreibungen im Johannesevangelium und der damit verbundenen Judenfeindlichkeit im II. Akt seiner Passion, in einem Choral (11.), durchaus seine eigene, bemerkenswerte Antwort: Auf die Frage des Chores nach der Schuld, auf die Frage: „Wer hat dich so geschlagen, mein Heil, und dich mit Plagen so übel zugericht` …“ antwortet Jesus: „Ich, ich und meine Sünden, die sich wie Körnlein finden des Sandes an dem Meer, die haben dir erreget, das Elend, das dich schläget, und das betrübte Marterheer.“ Jesus nimmt hier in den Worten des Chorals alle Schuld von „den Juden“ und lädt sie allein auf sich – und will auch nicht von Gott aus seinem nun folgenden, selbstverschuldeten Leid erlöst werden.
Ansonsten handelt der II. Akt insbesondere auch von der Verleugnung durch Petrus. Zunächst aber führt Bach die Sopranstimme mit einer Arie ein. Wie Martin Geck sagt, setzt Bach mit diesen Arien „Maßstäbe“ – und das gelte auch für die Instrumentation: zwei Oboen, zwei Flöten im Unisono, Streicher, zwei Viole d`amore, Streicher, Viola da gamba, Continuo, Flöte und Oboe – so lautet der Reihe nach die instrumentale Besetzung der Arien. „Eine so weiträumig disponierende Instrumentation kann man in kirchenmusikalischen Werken der Vorgänger und Zeitgenossen kaum finden“, sagt Geck, „sie erinnert an die höfischen Ensemble der Zeit und vor allem an diejenigen der früh-deutschen Oper, deren Komponisten in besonderem Maße auf hörerwirksame Instrumentencharakteristik bedacht waren.“
Man könnte jedenfalls erstaunt sein über die Heiterkeit der Sopran-Arie zu Beginn des II. Aktes, steht sie doch offenbar in einem krassen Widerspruch zum Inhalt der Erzählung. Der Evangelist berichtet (6./8.): „Die Schar aber und der Oberhauptmann und die Diener der Jüden nahmen Jesum und bunden ihn und führeten ihn aufs erste zu Hannas, der war Kaiphas Schwäher, welcher des Jahres Hoherpriester war. Es war aber Kaiphas, der den Jüden riet , es wäre gut, daß ein Mensch würde umbracht für das Volk. / Simon Petrus aber folgete Jesu nach und ein ander Jünger.“
Nach diesen Worten bricht die Erzählung ab – Bach selbst, so nimmt man heute an, hat veranlasst, dass nun ein freier Text eingefügt wird, wenn der Sopran beginnt mit den Worten (9.): „Ich folge dir gleichfalls mit freudigen Schritten und lasse dich nicht, mein Leben, mein Licht …“ Bach nimmt den Gedanken der freudigen Schritte auf und komponiert die Arie wie einen kleinen Tanz im freundlichen Dur. Aber auch hier ist die Musik wieder gestisch: Wie der Sopran Jesus folgt, folgt das Orchester dem Sopran in wiederholenden Sequenzen und einem Kanon. Wieland Schmid spricht in Zusammenhang mit dieser Arie auch von einer „musikalisch-rhetorische(n) Figur“, die „die Wirkung des Gesagten verstärken und vertiefen“ soll.
Man hat in Bachs Johannespassion über 150 solcher gestischer Stellen beziehungsweise musikalisch-rhetorischen Figuren identifiziert. Und auch am beim eben genannten Beispiel gibt es noch eine weitere Schicht musikalischer Bildhaftigkeit, die allerdings weniger offensichtlich ist: Sie besteht darin, dass Bach das Vorspiel zur Sopran-Arie für zwei unisono spielende Traversflöten schreibt. Es sei das, so Schmid, ein musikalisches Symbol – ein Symbol für die beiden Jünger, die Jesus, Johannes zufolge, folgten.
Johannes weicht hier von den Synoptikern ab, bei denen Petrus allein Jesus folgt. Der aber erscheint bei Johannes zögerlich – und muss erst von „derselbige(n) Jünger“ in den Palast geholt werden – wo nun die Verleugnungsszene (12.) folgt, bei der Petrus gefragt wird: „Bist du nicht seiner Jünger einer?“ Der aber leugnete und sprach: „Ich bin`s nicht“.
Im Palast werden die beiden Jünger Zeugen des Verhörs von Jesus. Das Verhör selbst ist zwar ein langes Rezitativ, das Bach aber durchaus dialogisch gestaltet – wie er in der Johannespassion insgesamt ohnehin wesentlich weniger Arien verwendet als dann in der Matthäuspassion: Bach reduziert damit die eher betrachtenden Solo- oder Monologszenen und betont stattdessen wesentlich mehr ein dialogisches, dramatisches Moment. In diesem Sinn auch erhält der Turba-Chor insgesamt mehr Raum gegenüber den Solisten.
Jesus verteidigt sich nicht. Er antwortet in dem Verhör mit sachlichen Argumenten, ohne erkennbare Gemütsbewegung. Für den Komponisten eines dramatischen Werks ist diese Haltung keine günstige Grundlage. Bach gleicht das Fehlen dramatischer Impulse durch scharfe Kontraste aus, die den Szenen eine ungeheure Wucht verleihen. Ganz in diesem kontrastierenden Sinn auch folgt nun, nachdem Jesus den gewalttätigen Diener gefragt hat (10.): „Was schlägst du mich?“, zunächst ein Choral.
Der Choral (11.) unterbricht das Verhör – und holt den Zuhörer von einer Position der Erhabenheit oder Unnahbarkeit (Jesus) wieder auf eine menschliche Ebene zurück. Jesus muss leiden, weil wir alle Sünder sind – das ist hier vielleicht die Botschaft. Das „Wir und unsre Kinder“ schließt dabei zunächst alle ein, bevor die Perspektive in der zweiten Strophe auf den sündigen Einzelnen, das schuldbewußte „Ich, ich und meine Sünden“, gelenkt wird – und beim Wort „Sünden“ Bach wieder mit einer harmonischen Dissonanz arbeitet: Wie schon bei der Gestaltung der Rezitative des Evangelisten im I. Akt kommt Bachs dramatische Intention auch hier zum Ausdruck, wenn wichtige Textpassagen oder einzelne Worte immer wieder deutlich kontrastierend herausgehoben sind und auch motivisch ausgearbeitet werden.
Weitere stärkere Kontraste ergeben sich aus den Handlungselementen des Dramas, das sich nun in der Folge um die Figur des Petrus entwickelt (12.). Petrus, der am Anfang noch jähzornig zum Schwert gegriffen hatte, wird hier als ein verzagter Mensch vorgeführt, der nicht wagt, sich zu Jesus zu bekennen. Das fängt schon an der Pforte des Palastes an – aber noch zwei weitere Male wird Petrus Christus auf die selbe Frage hin verleugnen. Bach schildert das „mit außerordentlichem Sinn für dramatische Wirkung“, wie Schmid bemerkt – und nutzt dazu auch einen Turba-Chor, in dem die Einsätze der einzelnen Stimmen gegeneinander versetzt sind: Immer mehr Volk, so scheint es, läuft zusammen und bedrängt Petrus.
Mit dem Versagen des Petrus und dem Krähen des Hahns schließt Johannes seinen Bericht – und richtet seinen Blick wieder auf die Lichtgestalt des Heilands. „Bach dagegen“, so Schmid, „interessiert der Mensch Petrus so sehr, dass er an dieser Stelle den Text des Evangeliums erweitert und einen Satz aus dem Passionsbericht des Matthäus einfügt: `Da gedachte Petrus an die Worte Jesu und ging hinaus und weinete bitterlich.´“
Die Worte, an die sich Petrus erinnert, kommen im Johannesevangelium gar nicht vor. Diese Stelle aber inspirierte ihn zu einer ungewöhnlichen kompositorischen Idee beim „weinete bitterlich“, von dem Matthäus berichtet: Bach kommt hier nämlich „zu einem schonungslosen Realismus der Darstellung, der in der Musikgeschichte einmalig ist“, wie Schmid weiß. Womöglich zielte Bach mit diesem außergewöhnlichen persönlichen Einschub der Reue und des tiefen Bedauerns von Petrus auch einfach darauf, „die Affecten“ seines Publikums zu bewegen und das subjektive Gefühl der empfindsamen Bürger jener Zeit zu berühren.
An das bitterliche Weinen fügt Bach jedenfalls noch eine Arie (13.) an, die die Szene weiterführt. Petrus selbst könnte es hier sein – ein Sinnbild des orientierungslosen Menschen, der nicht weiß wohin mit sich selbst. Hektisch von Takt zu Takt springt auch die Komposition in dieser Arie, auch sie ist eben Ausdruck einer menschlichen Zerrissenheit und Verzweiflung, die so im Evangelium des Johannes nicht vorkommt. Bach jedoch rückt sie am Ende des ersten Passionsteiles in Gestalt des Petrus in den Mittelpunkt – Wieland Schmid spricht in diesem Zusammenhang von einem „fesselnde(n) Psychogramm des Unglücklichen“.
Zwingend führt die Klage Petrus` zum Schluss des ersten Teils der Johannespassion, wo sich die Gemeinde im Choral (14.) das Gehörte ergriffen aneignet und im Verrat des Petrus ein Bild der eigenen Fehlbarkeit erkennt: „Jesu, blicke mich auch an, wenn ich nicht will büßen, wenn ich Böses hab getan, rühre mein Gewissen.“
Verhör und Prozess (15.-24.)
Eine fanatische Menge hat Jesus verhaftet – sie will Blut sehen. Damit beginnt, nach einem Choral (15.), der zweite Teil der Johannespassion. Jesus wurde verhaftet und, laut Johannesevangelium, zunächst in den Palast von Hannas geführt, dem Schwiegervater von Kaiphas, der in diesem Jahr Hohepriester war. Er führte demnach auch die erste Befragung von Jesus durch, der aber nur antwortete (18,21): „Was fragst du mich? Frage die, welche gehört haben, worüber ich mit ihnen geredet habe; die wissen, was ich gesagt habe.“ Daraufhin brachte ihn Hannas gefesselt zu Kaiphas, von dessen Haus Jesus zum Prätorium gebracht wurde, dem Amtssitz des römischen Statthalters Pontius Pilatus.

Steinfragment mit unvollständiger Inschrift des Namens „Pontius Pilatus“ aus Cesarea in Israel
© Berthold Werner
Pilatus Name leitet sich von „Pileatus“ her, was man mit „Filzkappe“ übersetzen kann und woran man erkennt, dass seine Vorfahren freigelassene Sklaven waren, die solche Kappen trugen. Der Legende nach ist er mit Claudia Procula verheiratet, der Tochter von Kaiser Tiberius. Entgegen der Lex Oppia, die es Angehörigen von Präfekten eigentlich verbot, diese in die Provinz zu begleiten, folgte sie ihm trotzdem nach Judäa. Dort lebten die beiden nicht, wie zu vermuten wäre, in Jerusalem – hierher kam Pilatus nur, wenn es notwendig war –, sondern in der Hafenstadt Cesarea, wo auch eine unvollständige Inschrift auf einem Steinfragment auf ihn verweist. Eine mögliche Lesart dieser Inschrift lautet: [nauti]s Tiberieum / [Po]ntius Pilatus / [praef]ectus Iudae[a]e / [ref]e[cit] („Für die Seeleute hat Pontius Pilatus, Präfekt von Iudaea, das Tiberieum erneuert“).
Pilatus` Amtssitz liegt in Cesarea etwa 90 Kilometer nord-westlich von Jerusalem an der Mittelmeerküste. Von hier aus macht sich der römische Statthalter von Judäa an Feiertagen wie dem Pessachfest mit seinen Soldaten auf den Weg nach Jerusalem – um die Bewohner daran zu erinnern, wer die Macht im Land inne hatte. Seine Anwesenheit sollte gewissermaßen Roms militäre Macht demonstrieren, Judäa ist damals nämlich erst seit etwa zwanzig Jahren eine römische Provinz – und nur widerwillig gewöhnen sich die Menschen allmählich an die Römer. In Jerusalem selbst war die römische Besatzungsmacht gerade einmal mit einer Kohorte von etwa 600 Mann in der Festung „Antonia“ oberhalb des Tempelberges dauerhaft stationiert.
Auch Pilatus residiert hier, wenn er in Jerusalem ist. Seine Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass während des Pessachfestes alles ruhig bleibt. Judäa – und dazu gehört auch Jerusalem – ist nämlich nur ein Außenposten, weit weg von Rom, und sollte es zu Unruhen kommen, könnte Pilatus erst Wochen später auf Verstärkung hoffen. Seine Herrschaft hing also von Anfang an von Kollaborationen in der Stadt ab – und dazu gehörten insbesondere auch Hohen Priester auf dem Tempelberg. Von ihrer oberhalb liegenden Festung mit ihren vier Türmen aus behielten die Römer sie fest im Auge.
Von den Türmen aus war der gesamte Tempelberg zu überblicken. Außerdem lagerten die Römer hier die Zeremoniengewänder des Hohen Priesters unter Verschluss. Sie wurden nur an besonderen Feiertagen, wie jetzt zum Pessachfest, getragen – ohne sie besaß der Hohe Priester keine Autorität. Die Römer hielten so buchstäblich den Schlüssel zur Macht über die Stadt in der Hand – und der Statthalter Pilatus kontrollierte so auch Kaiphas, das religiöse, aber in Pilatus` Abwesenheit auch politische Oberhaupt von Jerusalem: Im Grunde war es Kaiphas, der die Verantwortung für die Stadt und natürlich auch für den Tempel inne hatte. Aber ihm war zweifelsohne auch klar, dass seine Macht von Pilatus abhing.
Um ihre Privilegien zu behalten, waren die jüdischen Autoritäten zur Zusammenarbeit mit Pilatus aufgefordert. Das gilt erst recht für Kaiphas – und offensichtlich hatten er und Pilatus auch eine funktionierende Beziehung, arbeiteten sie doch fast zehn Jahre zusammen. Beide standen auf der selben Seite und waren daran interessiert, Unruhen zu vermeiden. Doch schon lange vor Jesus` Ankunft in Jerusalem, waren die Menschen wütend – auf ihre religiösen Autoritäten, weil sie mit den Römern kooperierten, und auf die Römer, weil sie das Land besetzt hielten. Und dann war gerade auch noch Pessach, wo man ja die Befreiung der Juden aus der ägyptischen Knechtschaft feierte! Es fehlte also ohnehin nicht viel um eine Revolte auszulösen.
Verhaftet wurde Jesus aber nicht allein deshalb, weil seine Ankunft beunruhigte, sondern eher die Botschaft, die er mitbrachte, predigte er doch das Jüngste Gericht und das kommende Reich Gottes – ein neues Reich werde kommen, basierend auf Gerechtigkeit, Liebe und Barmherzigkeit. Was die Aufmerksamkeit der Autoritäten – und zwar sowohl der religiösen als auch der politischen – erregte, war der Begriff „Königreich Gottes“, stellte er doch die Herrschaft beider infrage. Deshalb wurde Jesus nach seiner Verhaftung nun danach befragt.
Das Evangelium von Johannes unterscheidet sich gerade bei den Verhör- und Prozessszenen grundsätzlich von den synoptischen Evangelien: Während Jesus bei Johannes praktisch gleich an Pontius Pilatus übergeben wird, wird ihm dort vom Hohen Rat der Prozess gemacht (er wird dort von Kaiphas verhört, schweigt aber). Allerdings ist kein Bericht eindeutig in der Frage darüber, wer für das Urteil über Jesus verantwortlich ist. Historisch betrachtet nämlich kann es nicht sein, dass der jüdische Rat einen Prozess abhält, höchstens eine Versammlung wäre möglich gewesen, um Jesus zum Tode zu verurteilen. Allerdings heißt es in den Evangelien auch nirgends, dass Jesus vom Rat zum Tode „verurteilt“ wird – nur, dass er den Tod „verdient“ hat.
Bei Bach ist die Sache eindeutig – hier hat ein jüdischer Mob mit Jesus ein Hassobjekt gefunden (16.): „Wäre dieser nicht ein Übeltäter, wir hätten dir ihn nicht überantwortet“, rufen sie Pilatus zu und drängen ihn zum Todesurteil. Beim Wort „Übeltäter“ wiederholen sich dabei die Stimmen des rasenden Turba-Chores – und lassen buchstäblich ein Geheul hören in einer Folge von Halbtonschritten. Diese chromatische Tonfolge taucht immer wieder auf, in allen Stimmen, die sich hier gegenseitig anzustacheln scheinen. So hinterläßt diese Szene einer aufgehetzten und fanatisierten Volksmasse beim Zuhörer eine schaurige Wirkung. „Doch da ist etwas“, sagt Schmid, „das uns heute stört: diese rasende Menge, das sind ja die Juden – die nach Überlieferung der christlichen Kirche jahrhundertelang als `Mörder Christi´ gebrandmarkt wurden“. Auch wenn er die Frage nach der Schuld im Choral (11.) zuvor vielleicht von den Juden nimmt – hier ist Bach zweifelsohne wieder „ein Kind seiner Zeit“, wie Schmid es ausdrückt, und folgt dem Text des Johannesevangeliums Wort für Wort, „da gibt es keine Differenzierung, nicht einmal eine Steigerung: Die Menge ist fanatisch, vom Anfang bis zum Ende“.
Pilatus will den unbequemen Fall los werden und Jesus den Juden übergeben. Die aber erinnern ihn an das römische Besatzungsrecht: „Wir dürfen niemand töten“ – und beim Wort „töten“ ist wieder diese heulende chromatische Tonfolge zu hören, das „Abbild des Hasses“, wie Schmid sagt. Und auch eine zweite musikalische Figur taucht immer wieder auf in diesen Turba-Chören, die erste Violine hat sie zu spielen: rasche, spitze Sechzehntel-Noten in unablässiger Folge und zielloser Bewegung. „Ein Bild der Erregung und zugleich Gedankenlosigkeit“, so Schmid, der außerdem feststellt, dass die Bewegungen der Violinen charakteristisch für die Geschwindigkeit sind, mit der sich der Prozess abspielt – bei Bach nur unterbrochen von einem Choral (17.).
Grundsätzlich gilt, dass der Hohe Rat, abgesehen vom Vergehen der Blasphemie, nicht das Recht hat, jemanden zum Tode zu verurteilen. Historisch wurden Deliquenten nicht vom Hohen Rat gekreuzigt beziehungsweise zum Kreuzestod verurteilt – das Recht zur Hinrichtung lag allein in den Händen der Römer. Umgekehrt konnten die Römer, das heißt der römische Präfekt, nicht jemanden „richten“, sondern der Hohe Rat musste ein Urteil erst theologisch begründen. Sowohl das jüdische System des Hohen Rates, als auch das römische durch Pilatus mussten im „Fall Jesus“ also zusammenarbeiten, wobei erst Pilatus das Todesurteil verhängen konnte – er war der Exekutor.
Jesus hat allerdings den üblichen Ablauf zwischen den beiden Instanzen durcheinander gebracht. So wurde er zwar von den Hohepriestern (als Polizei) verhaftet, jedoch im Auftrag der Römer. Es handelt sich im „Fall Jesus“ insofern um eine doppelte Anklage: einerseits des Aufrührertums (politisch) und andererseits der Infragestellung der priesterlichen Hoheit (religiös). Von beiden Instanzen wurde das Verhalten Jesu gleichermaßen als kriminell beurteilt („kriminell“ heißt im griechischen Original „anomos“, „ungesetzlich, Frevler, Übeltäter“), allerdings nach anderen Gesichtspunkten.
Der Hohe Rat als jüdische Behörde hat den Fall nach den vorhandenen Normen der jüdischen Gesellschaft beurteilt: Jesus steht zwar nicht gegen den jüdischen Gottesgedanken – Jahwe wird von ihm keineswegs abgeschafft –, er steht aber in Opposition zur Priesterschaft. Als Messias, Gesalbter, setzt sich Jesus über das tradierte „Gesetz Mose“, die Thora, hinweg und nimmt für sich selbst die Autorität Gottes in Anspruch. Darüber hinaus will er den Tempel zerstören und prophezeit ein kommendes Reich Gottes mit einem gänzlich neuen Wertesystem (Gesetzen). Deshalb war Jesus aus der Perspektive des Hohen Rates zweifelsohne ein Häretiker, ein falscher Prophet, und mußte sterben. Im Johannesevangelium (19,7) und bei Bach (21f.) sagen „die Juden“ deshalb: „Wir haben ein Gesetz, und nach dem Gesetz muss er sterben …“. (Wie sich „die Juden“ hier an das Gesetz halten, so hält sich Bach bei der Vertonung dieser Szene an die Regeln des Kontrapunktes: „Mit einem beinahe hölzernen Thema wird das Argument vom Bass vorgetragen“, bemerkt Wieland Schmid in diesem Zusammenhang, „und immer beim Wort `sterben´ setzt die nächste Stimme ein, exakt und regelmäßig.“ Als die Menge später (23b.) noch ein weiteres Mal sachliche Argumente für die Todesstrafe vorbringt, erklingt das Thema noch einmal.)
Da der Hohe Rat jedoch kein Todesurteil sprechen kann, wurde Jesus zu Pontius Pilatus geführt. Der aber ist für das „jüdische Gesetz“ gar nicht zuständig. Hat er auch gegen römisches Gesetz verstoßen, fragt Pilatus deshalb, und verhörte Jesus selbst (16.). Dabei stellt sich heraus: Es gibt für Pilatus keinen Grund, ihn zu verurteilen: Während Jesus in den synoptischen Evangelien beim Verhör durch Kaiphas schweigt, konstruiert beziehungsweise ersinnt Johannes (18,33-37) einen Dialog zwischen Pilatus und Jesus: „Du bist der König der Juden? Jesus antwortete: Sagst du das von dir aus, oder haben es dir andere über mich gesagt? Pilatus antwortete: Bin ich etwa ein Jude? Dein Volk und die Hohen Priester haben dich an mich ausgeliefert. Was hast du getan? Jesus antwortete: Mein Reich ist nicht von dieser Welt. (…) Da sagt Pilatus zu ihm: Du bist also doch ein König? Jesus antwortete: Du sagst es. Ich bin ein König.“ Aber als König eines Reiches, das nicht von dieser Welt ist, wie er auch bei Bach (16.) sagt, steht Jesus nicht im Widerspruch zum irdischen römischen Reich, Pilatus hat folglich keinen Grund ihn zu verurteilen – er findet keine Schuld an ihm.
Johannes betont in der Passionsgeschichte vor allem die Gerichtsverhandlung vor den Hohepriestern und vor Pilatus, die er ausgiebig darstellt, insbesondere die dialogischen Momente über die Königsherrschaft Jesu. Bach, der stets bemüht ist, die theologische Eigenart des Johannesevangeliums gegenüber den synoptischen zu berücksichtigen, folgt ihm auch in diesen Szenen und nutzt, wie Geck schreibt, „extensiv die dramatischen Gestaltungsmöglichkeiten“.
Gleichwohl konnte Pilatus keine Schuld an Jesus finden – dann aber, so erzählt es Michael Köhlmeier der Legende entsprechend, kommt Claudia Procula und bittet Pilatus – vor den Augen des Volkes – Jesus freizulassen. Pilatus fühlt sich gedemütigt und besinnt sich auf eine römische Tradition zum Pessachfest: Er schlägt vor, das Volk zu fragen, welchen Gefangenen man freilassen sollte. (Bei Johannes fragt er nicht das Volk, sondern den Hohen Rat. Ihm schien es undenkbar, dass das gemeine Volk ins Prätorium, das Lager des Pilatus, eingelassen wird.)
Neben Jesus sind auch noch Barabbas und seine beiden Stellvertreter Dismas und Gestas inhaftiert, seit die politischen Unruhen im Volk zunahmen. (Dismas und Gestas werden erstmals im apokryphen Nikodemusevangelium genannt. Dismas ist dort der zur Rechten von Jesus gekreuzigte, „gute“ Verbrecher, der dem Lukasevangelium zufolge am Kreuz Reue zeigte, wofür ihm Jesus das Paradies versprach. Gestas ist der nachbiblisch-legendäre Name des „unbußfertigen Schächers“, der zur Linken Jesu gekreuzigt wurde und der Jesus verhöhnte, wie der römische Soldat Longinus berichtet, selbst ein Gläubiger, der dann den Speer in Jesus stößt.)
Dismas und Gestas wurden wie Barabbas aufgrund eines Vorwurfs verhaftet und verurteilt, der sowohl „Räuber“, als auch „Anführer“ bedeuten kann – etwa zu der Zeit, als auch Johannes der Täufer verhaftet wurde. (Michael Köhlmeier spricht in diesem Zusammenhang von einer „messianischen Zeit“ und der „Sehnsucht nach Erneuerung“. Dem hätten in geistig-religiöser Hinsicht der Täufer und in politischer Barabbas und seine Stellvertreter entsprochen.) Jedenfalls gab es seit 60 vor Christus nirgendwo im römischen Reich so viel Widerstand gegen die römische Besatzungsmacht wie in Palästina (Judäa allerdings wurde erst im Jahr 6 nach Christus direkt dem römischen Staat unterstellt).
Als Pilatus das Volk nun fragt, wer freigelassen werden soll, entscheidet es sich für Barabbas. Bei Johannes ist es nicht das Volk, sondern „die Juden“ respektive der Hohe Rat, die sich gegen Jesus und für Barabbas entscheidet: „Nicht diesen, sondern Barrabam!“, rufen sie ganz aufgeregt auch bei Bach (18.). Pilatus entscheidet sich jedenfalls für die Freilassung des Barabbas (was dafür spricht, dass es sich bei ihm eher um einen „Räuber“ handelt, wie es auch im Johannesevangelium (18,40) heißt – die Römer hätten wohl kaum einen politischen Anführer freigelassen). Jesus hingegen soll die Strafe des Barabbas erhalten – aber auch jene, die ihm vielleicht von Pilatus ursprünglich zugedacht wurde: er soll gegeißelt werden.
In den synoptischen Evanglien wird Jesus nun den Soldaten übergeben, die ihm eine Dornenkrone aufsetzen, einen Purpurmantel umlegen, ihn ins Gesicht schlagen und ihn als „König der Juden“ verspotten. Bei Bach wird Jesus nicht den Soldaten übergeben, sondern die Szene findet ihren dramatischen Höhepunkt darin, dass Pilatus selbst Jesus geißelt (18c.). Bach versucht in dieser Szene mit Harmonik und insbesondere auch mit einer besonders ausdrucksvollen Melodik das Wort „geißelte“ hervorzuheben. Damals war man so dramatische Effekte wie gerade jenen hier in der geistlichen Komposition nicht gewohnt und schockiert schreibt eine Zuhörerin zu dieser Szene auch: „Behüte Gott, ihr Kinder! Ist es doch als ob man in einer Opéra Comédie wäre.“
Nach der Freilassung des Barabbas setzt Bach mit einem Bass-Arioso (19.) – einer Form zwischen Arie und Rezitativ – eine längere, betrachtende Unterbrechung des Dialogs ein. Es steht in einem krassen Kontrast zur dramatischen Erzählung der Geißelung vorher und beschreibt mit einem ganz neuen Klangbild und einer sehr barocken Sprache, die aus einem tiefen Pietismus heraus entstanden ist, die stechenden Dornen und die Schmerzen Jesu – und geht sogar so weit, dass Jesu Schmerzen und Wunden mystisch verklärt den Himmel aufschließen („Himmelsschlüsselblumen blühen“). In der daran anschließenden Tenor-Arie (20.) wird dieses Bild weiter geführt und der „blutgefärbte Rücken“ zum „allerschönsten Regenbogen“, zu „Gottes Gnadenzeichen“ und dem Ende der Qual.
Gegeißelt, geohrfeigt und mit einer Dornenkrone malträtiert (21a.) wird Jesus anschließend als König der Juden „verkleidet“ und nach draußen geführt – auf den Gerichtsplatz (dem sogenannten „Gabbata“) vor dem Prätorium des Pilatus. Dort wird er den Priestern des Hohen Rates präsentiert, die seinen Tod verlangen (19,6) und rufen, wie es bei Bach heißt (21d.): „Kreuzige, Kreuzige!“
Man muss diese „Keuzige“-Rufe im historischen Kontext der Entstehung des Johannesevangeliums sehen respektive vor dem Hintergrund der Trennung und Distanzierung des Christen- vom Judentum. Vor diesem Hintergrund wäre es anachronistisch eine jüdische Kollektivschuld in die Passionsgeschichte zu legen, zumal ja auch das Evangelium des Johannes nicht vom Volk spricht, sondern nur von dessen geistiger Elite, dem Hohen Rat. Dennoch bekommt diese Turba-Chor-Szene in der Passion von Bach in seiner gestischen Kraft eine gewisse Brutalität, die er, wie Geck schreibt, „unmittelbar aus dem Sprachduktus und der dramatischen Situation“ heraus komponiert. Bach mache hier, so Geck weiter, „aus dem einzigen Wort `kreuzige´ das dramatische Zentrum und zugleich einen der theologischen Höhepunkte der Passion … In einer der Fugenform angenäherten, das heißt kunstvoll polyphonen, jedoch keineswegs schulmäßig kontrapunktischen Setzweise wird das Schlüsselwort der Passion in rhythmischen Zusammenballungen und schneidenden Dissonanzen heulend, hetzend, durcheinander und wild gestikulierend ausgesprochen. Wohl selten in der Musikgeschichte ist der Ausdruck leidenschaftlichen Hasses so sprechend in Musik umgesetzt worden.“
Obwohl Bach den Chor mit seinen kontemplativen Choralsätzen gleichzeitig auch zum Ruhepol seiner Johannespassion machte, blieb insbesondere diese Turba-Chor-Szene, die von Bach ohne musikalisches Vorbild komponiert wurde, nicht ohne Wirkung auf die Zeitgenossen. Noch einmal Geck in diesem Zusammenhang: „Eine zu Bachs Lebzeiten verbreitete Auslegung der Passionsgeschichte durch den Rostocker Theologen Heinrich Müller, die hier pars pro toto genannt sei, bezeichnet die `Kreuzige´-Rufe als `der Juden Mord=Gesang´ und fährt fort, `die Welt wird noch heutigen Tages besessen von dem rasenden Mord-Gelüste gleich den Juden´“.
Die Rolle des Pilatus hingegen, der sich vor dem Kaiser (Tiberius) und vor der Priesterschaft in Rom verantworten muss, wurde im Evangelium etwas beschönigt, um die Schuld von ihm weg direkt auf „die Juden“ und seine Verantwortung direkt auf den Kaiser zu lenken. Bei Johannes „schrien die Juden“ (19,12-16): „Wenn du den da freigibst, bist du kein Freund des Kaisers. Jeder, der sich zum König macht, widersetzt sich dem Kaiser. (…) Wir haben keinen König außer dem Kaiser! Da lieferte er ihnen Jesus zur Kreuzigung aus.“
Pilatus erscheint so als eine Art „Anwalt“, der seine Hände – allerdings nicht bei Johannes – dann ja auch in Unschuld wäscht: drei Mal betont er, dass Jesus „unschuldig“ sei, Jesu Tod haben insofern allein die Juden zu verantworten. Offensichtlich wollten die Verfasser der Evangelien die Christen als politisch ungefährlich gegenüber den Römern darstellen, tatsächlich nämlich herrscht Pilatus als römischer Statthalter autoritär. Der Regisseur Peter Sellars, der 2014 eine bemerkenswerte szenische Fassung der Johannespassion in der Philharmonie Berlin mit dem Dirigenten Simon Rattle inszenierte, bemerkt in diesem Zusammenhang: „Es ist eine schmutzige, ekelhafte Parodie von Gerechtigkeit. Es gibt in diesem Stück viele Heimlichtuereien und gleichzeitig diese unverhohlene Brutalität, als wäre es eine Geschichte aus heutiger Zeit.“
Tod am Kreuz (24.-37.)
Nachdem Jesus, im Evangelium nach Johannes, den Hohen Priestern übergeben wurde, führte man ihn zum Richtplatz nach Golgata auf den Kalvarienberg. Im Johannesevangelium trägt Jesus sein Kreuz allein – es gibt keinen „Simon von Kyrene“ der ihm das Kreuz abnimmt (die Gnostiker glauben, dass nicht Jesus – körperlich – am Kreuz gestorben ist, sondern Simon von Kyrene; Jesus sei ein geistiges Wesen). Johannes (19,17) schreibt: „Er trug sein Kreuz selber und ging hinaus zu der sogenannten Schädelstätte, die auf Hebräisch Golgota heißt. Dort kreuzigten sie ihn und mit ihm zwei andere …“.
Mit einer Bass-Arie beginnt Bach den letzten Teil der Johannespassion (24.). Sie lenkt den Blick auf die Kreuzigungsstätte, indem der Bass der verwirrten Gemeinde („Wohin?“) erklärt: „Eilt, ihr angefochtnen Seelen … nach Golgatha.“ Historisch ist dieser Ort schwer einzuordnen. Es ist aber zumindest nicht unwahrscheinlich, dass es sich bei dem Richtplatz beziehungsweise der Kreuzigungsstätte tatsächlich um jenen Ort im heutigen Jerusalem handelt, auf dem die Mutter von Konstantin, dem ersten christlichen Kaiser Roms, im Gefolge einer Pilgerreise im Jahr 325 die Grabeskirche errichten ließ.
Was heute als Kreuzweg bekannt ist, die „Via Dolorosa“ („Schmerzreiche Straße“) in Jerusalem, ist nicht historisch (dennoch soll seit dem 18. Jahrhundert in jeder römisch-katholischen Kirche ein Kreuzweg abgebildet sein). Auch die „Leidensmeditation“ auf den vierzehn Kreuzwegsstationen gewann erst mit den Franziskanern seit dem 13. Jahrhundert Bedeutung. Die einzelnen Stationen sind:
- Jesus wird zum Tode verurteilt
- Jesus nimmt das Kreuz auf seine Schulter
- Jesus fällt zum ersten mal unter dem Kreuz (wird im Neuen Testament nicht erwähnt)
- Jesus begegnet Maria, seiner Mutter (wird ebenso nicht erwähnt)
- Simon von Kyrene hilft Jesus das Kreuz tragen
- Veronika reicht Jesus das Schweißtuch (auch nicht erwähnt)
- Jesus fällt zum zweiten Mal unter dem Kreuz (ohne Erwähnung im Neuen Testament)
- Jesus begegnet den weinenden Frauen
- Jesus fällt zum dritten Mal unter dem Kreuz (wird auch nicht erwähnt)
- Jesus wird seiner Kleider beraubt
- Jesus wird ans Kreuz genagelt
- Jesus stirbt am Kreuz
- Jesus wird von Kreuz abgenommen
- Der heilige Leichnam Jesu wird in das Grab gelegt
Fast alles davon bleibt im Johannesevangelium ausgespart. Und noch etwas anderes kommt nicht zur Sprache, was jedoch in den synoptischen Evangelien geschildert wird: Als Jesus auf dem Kalvarienberg angekommen war, bringen sie ihn, wie Markus (12,20-25) berichtet, „an den Ort Golgota, das heisst `Schädelstätte´. Und sie gaben ihm Wein, der mit Myrrhe gewürzt war; er aber nahm ihn nicht.“ Und auch Matthäus (27,33) beschreibt diese Szene: „Und als sie an den Ort namens Golgata kamen – das heißt `Schädelstätte´ –, gaben sie ihm Wein zu trinken, der mit Wermut vermischt war, und als er gekostet hatte, wollte er nicht trinken.“
In Palästina führte zur Zeit Jesu eine verfeinerte Trinkkultur (davon wird zum Beispiel im Buch Nehemia 5,18 gesprochen) dazu, dass Weine mitunter gewürzt wurden. Etwa 50 Sorten von mit Gewürzen verfeinertem Wein werden in antiken Rezepten erwähnt, während der Zusatz von Pech, Harz oder Salzwasser während der Vinifikation der Trauben dazu diente, den Wein mikrobiologisch zu stabilisieren (heute geschieht das durch Schwefelung). Der laut dem Markusevangelium Jesus angebotene und mit Myrrhe angereicherte Wein jedoch war kein besonders verfeinerter Wein, sondern sollte als ein Betäubungsmittel dienen, das die Qualen der Kreuzigung erträglicher machen sollte. Dasselbe gilt für den erwähnten Wermut bei Matthäus. Jesus, der dem Wein ansonsten nicht grundsätzlich abgeneigt war, lehnte den mit Betäubungsmitteln versetzten Wein jedoch ab und war bereit, so soll suggeriert werden, das Leiden mit vollem Bewusstsein auf sich zu nehmen (wie übrigens auch Sokrates).
Es ist unklar wer Jesus gekreuzigt hat: Während ihn Pilatus in den synoptischen Evangelien den römischen Soldaten übergibt, wird er bei Johannes den jüdischen Hohepriestern „ausgeliefert“. Johannes spricht in Zusammenhang mit der Kreuzigung nur von „sie“, aber ist es überhaupt vorstellbar, dass Jesus von den Hohepriestern gekreuzigt wird? In seinem „Jüdischen Krieg“ berichtet Flavius Josephus, dass Kreuzigungen tatsächlich auch von Juden – wenn auch nicht von Hohepriestern – vorgenommen wurden. Damit stellt sich grundsätzlich die Frage, ob Kreuzigungen überhaupt von den Römern eingeführt wurden?
Unklar ist außerdem, wie diese Kreuzigungen vonstatten gingen, denn auch schon im Alten Testament werden Menschen an ein Kreuz beziehungsweise einen „Pfahl“ – gehängt. Im Deuteronomium (21,22) heißt es beispielsweise: „Und wenn jemand ein todeswürdiges Verbrechen begeht und er getötet wird und du ihn an einen Pfahl hängst, darf sein Leichnam nicht über Nacht am Pfahl hängen bleiben …“
Hängen ist nun in unserer Vorstellung nicht kreuzigen. Aber tatsächlich gibt es auch nur einen einzigen archäologischen Hinweis darauf, dass Delinquenten ans Kreuz genagelt wurden: Im Jahr 1968 fand man die sterblichen Überreste eines Jochanam aus dem 1. Jahrhundert nach Christus, in dessen rechter Ferse noch ein Nagel steckte, an dem sich Reste von Akazien- und Olivenholz befanden. Das ist der einzige Hinweis auf Kreuzigungen überhaupt. Ob Jesus also ans Kreuz genagelt wurde weiß man nicht, erst recht nicht, ob ihm auch die Hände durchgenagelt wurden (Markus und Mätthaus schreiben auch von Narben an den Händen). Wahrscheinlicher ist, dass die Delinquenten, wie es bereits in der Thora geschrieben steht, ans Kreuz gebunden wurden.
Die Nagelung jedenfalls ist nicht Ursache des Kreuzestodes: Da dem Delinquenten noch zusätzlich die Beine gebrochen werden, sackt sein Körper durch, was dazu führt, dass er (relativ schnell) erstickt. Im Johannesevangelium (19,33) heißt es in diesem Zusammenhang: „Als sie [die Soldaten] aber zu Jesus kamen und sahen, dass er schon gestorben war, zerschlugen sie ihm die Schenkel nicht …“
Bei Johannes folgt auf die Kreuzigung unmittelbar die Verteilung der Kleider unter den Soldaten des Hinrichtungskommandos. Diese Szene taucht in allen Evangelien auf, vielleicht auch, weil das Verlosen der Kleidung einer Aussage aus den alttestamentarischen Psalmen (22,9) über die „Leiden und Herrlichkeit des Gerechten“ entspricht, an dessen Anfang die Frage steht (Ps 22,2): „Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?“.
Ebenfalls aus diesem Psalm stammt die Verspottung Jesu durch die Soldaten (22,8), die bei Johannes indes nicht vorkommt. Lukas (23,35-37) jedoch schreibt: „Und das Volk stand dabei und sah zu. Und auch die vornehmen Leute spotteten: Andere hat er gerettet, er rette jetzt sich selbst, wenn er doch der Gesalbte Gottes ist, der Auserwählte. Und auch die Soldaten machten sich lustig über ihn; sie traten vor ihn hin, reichten ihm Essig und sagten: Wenn du der König der Juden bist, dann rette dich selbst!“ In dem Spott kommt Enttäuschung und auch Unverständnis zum Ausdruck: Jesus verheißt nicht den Neubau des Tempels in der unmittelbar bevorstehenden messianischen Zeit, sondern meint die Ablösung des Tempels durch seine Gemeinde.
Im Johannesevangelium kommt das dadurch zum Ausdruck, dass dort, im Unterschied zu den synoptischen Evangelien, neben der Mutter auch andere Mitglieder der Familie sowie weitere Frauen unter dem Kreuz anwesend sind, und auch ein (unbenannter) Jünger, den Jesus seiner Mutter als neuen „Sohn“ anvertraut. Bei Bach erklärt der Evangelist (27c.): „Es stund aber bei dem Kreuze Jesu seine Mutter und seiner Muttter Schwester, Maria, Kleophas Weib, und Maria Magdalena. Da nun Jesus seine Mutter sahe und den Jünger dabei stehen, den er lieb hatte, spricht er zu seiner Mutter: `Weib, siehe, das ist dein Sohn.´ Darnach spricht er zu dem Jünger: `Siehe, das ist deine Mutter.´“
Auf diese Begegnung folgt in der Johannespassion ein Choral (28.), in dem noch einmal betont wird, dass Jesus „alles wohl in acht (nahm) in der letzten Stunde“ und noch am Kreuze alles harmonisch, in seinem Sinne bedachte und regelte: „o Mensch mache Richtigkeit, … stirb darauf ohn alles leid“, heißt es im Choral. In diesem Satz steckt aber zugleich auch eine theologische Aussage: „Richtigkeit“ sollen die Menschen nicht nur im täglichen Leben machen, sondern insbesondere auch im Glauben.
In dieser Zuversicht kann Jesus unbetrübt sterben – und doch darauf vertrauen, theologisch, im Glauben seiner Gemeinde, zu überleben: „Mein teurer Heiland, laß dich fragen, da du nunmehr ans Kreuz geschlagen und selbst gesagt, es isst vollbracht, bin ich vom Sterben frei gemacht, kann ich durch deine Pein und Sterben das Himmelreich ererben. Ist aller Welt Erlösung da? Du kannst vor Schmerzen zwar nichts sagen; doch neigest du das Haupt und sprichst stillschweigend Ja. Jesu, der du warest tot, lebest nun ohn Ende …“, heißt es bei Bach (32.).
Aus jüdischer Perspektive jedoch ist der Kreuzestod etwas Widersinniges: Man rettet die Welt nicht an ein Kreuz genagelt. Für die Juden des Johannesevangeliums hat Jesus keine messianische Kraft: Er verfügt weder über die Möglichkeit, sich vom Kreuz zu befreien, noch scheint er sich gegen seinen Tod zu wehren. Dabei ist gerade das aus einer im wahrsten Sinne des Wortes christlichen Perspektive entscheidend: Sein Hoheitstitel Christus besteht laut Lukas (24,26) ja gerade in der Annahme beziehungsweise Überwindung des Leids.
In der Überwindung des Leids besteht der Triumph Jesu. Und lange nach seinem Kreuzestod dominiert auch die Darstellung dieses triumphierenden Jesus in seiner Pracht – der leidende Jesus hingegen, der von den Dornen seiner Krone und den Nägeln in seinen Gliedern verletzte und blutverschmierte Jesus, wird erst ab dem 13. Jahrhundert zum Gegenstand insbesondere der katholischen Ikonografie (nur im Katholizismus wird „der Gekreuzigte“ überhaupt dargestellt, bei den Protestanten herrscht das blanke Kruzifix vor).
In dieses Zusammenhang wurde auch die „mystische Kelter“, wie Gutermuth bemerkt, zu einem Motiv der Darstellung der Leiden Jesu. Jesus wird hier in der Kelter dargestellt, wie eine Traube niedergedrückt vom Kelterbalken, sich aufopfernd und sein Blut gebend wie eine Traube. Die Weinpresse wird hier zum Symbol des menschlichen Leidens und Sterbens, das der Mönch Notker von St. Gallen (840-912) so zusammenfasst: „Uva (Traube) war ich, / Getreten bin ich, / Vinum werd ich!“

Meester van het Martyrium der Tienduizend – Christus in der Kelter (1463-1467), Rijksmuseum Amsterdam
Gegen diese Darstellungen des leidenden Jesus steht das Johannesevangelium: Im Unterschied zu den synoptischen Evangelien wird Jesus hier nicht als seinem Schicksal ausgeliefert beschrieben, sondern bei Johannes handelt er weitestgehend selbstbewusst in Eigeninitiative. Anders als bei Lukas, wo die Soldaten Jesus den Essigtrank reichen, macht er sie bei Johannes zum Beispiel auf seinen Durst aufmerksam. Johannes (19,28-29) schreibt: „Danach spricht Jesus im Wissen, dass schon alles vollbracht ist: Mich dürstet! So sollte die Schrift an ihr Ziel kommen. Ein Gefäß voll Essig stand da, und so tränkten sie einen Schwamm mit Essig, steckten ihn auf ein Ysoprohr und führten ihn zu seinem Mund.“
Ein mit „Essig aus Wein“ (Numeri 6,3) getränkter Schwamm fungierte hier nicht dazu, den sterbenden Jesus noch zusätzlich zu quälen, sondern Essig diente in Palästina zu dieser Zeit, wie Gutermuth weiß, außer zum Würzen und Konservieren, insbesondere ärmeren Menschen und Soldaten in verdünnter Form als Durstlöscher, sie führten den „posca“ genannten, auf Essigbasis hergestellten Trank bei sich. Nicht alle Trauben dienten also der Weinherstellung. Und auch unvergorener Traubensaft wurde getrunken, wenngleich es aufgrund des heißen Klimas eher öfter vorgekommen sein dürfte, dass sich Wein in Essig verwandelt hat.
„Als Jesus nun den Essig genommen hatte sprach er“, erklärt Johannes (19,30): „Es ist vollbracht. Und er neigte das Haupt und verschied.“ Jesus geht selbstbewusst in den Tod: „Der Held aus Judäa siegt mit Macht“, heißt es dazu bei Bach (30.), der den Augenblick des Todes damit auch als Triumph Jesu über den Tod darstellt. Geck spricht in diesem Zusammenhang von einer „sieghafte(n) Fanfarenmelodik“ und „eine(r) geradezu opernhafte(n) Gestik“.
Auf den Tod Jesu reagiert der Tenor in einem Arioso mit dem Ausruf: „Mein Herz, in dem die ganze Welt bei Jesu Leiden gleichfalls leidet …“ (34.) Nachdem im ersten Takt „das erregt zitternde Herz“ vorgestellt worden ist, wie Geck sagt, deuten die folgenden sechs Takte die Reaktionen der ganzen Welt an. Im Libretto der Johannespassion heißt es dazu (35.): „Und die Erde erbebte, und die Felsen zerrissen, und die Gräber taten sich auf …“ In seinem Evanglium allerdings verzichtet Johannes auf solche Schilderungen, weshalb Bach hier – neben der Verleugnungsszene – zum zweiten Mal auf das Matthäusevangelium zurückgreift.
Anders als Johannes versuchen die synoptischen Evangelisten den Unterschied der Kreuzigung Jesu von anderen herauszustellen und tun das, indem sie einen Zusammenhang zur alttestamentarischen Apokalypse herstellen. Zeichen, die diese Kreuzigung einzigartig machen sind zum Beispiel das Zerreißen des Tempelvorhangs, das anzeigt, dass Gott den Tempel verlassen hat und seine Zerstörung bevorsteht, sowie die Finsternis als Hinweis für das bevorstehende Gericht Gottes, Jesaja (13,9-10) entsprechend: „Sieh, der Tag des Herrn kommt (…) Die Sterne des Himmels und seine Orione lassen ihr Licht nicht strahlen, finster ist die Sonne bei ihrem Aufgang.“ (Ähnlich heißt es bei Markus (13,24-27) zu den „Zeichen für das Kommen des Menschensohnes“: „Aber in jenen Tagen … wird die Sonne sich verfinstern, und der Mond seinen Schein nicht geben, und die Sterne werden vom Himmel fallen …“)
Um den Tod Jesu eindeutig festzustellen, stieß einer der Soldaten (im apokryphen Nikodemusevangelium ist es ein Soldat mit dem Namen Longinus) einen Speer in den Körper, „und sogleich floss Blut und Wasser heraus“, schreibt Johannes (19,34). Ist Jesus bei Johannes zunächst der „göttliche Logos“, quasi enthistorisiert und entkörperlicht, stirbt er nun, ohne dass ihm die Beine gebrochen werden müssen, und es fließt tatsächlich Blut aus ihm – das Blut Christi.
Jesus ist gestorben als „König der Juden“. Dem Evangelium von Johannes zufolge ließ Pilatus eine Tafel beschriften und sie oben am Kreuz anbringen auf der geschrieben stand: „Jesus von Nazaret, der König der Juden“ (19,19). Bei Bach singt der Evangelist (25a.): „Piltus aber schrieb eine Überschrift und satzte sie auf das Kreuz, und war geschrieben: `Jesus von Nazareth, der Jüden König´. Diese Überschrift lasen viele Jüden; (…) Und es war geschrieben auf hebräische, griechische und lateinische Sprache. Da sprachen die Hohenpriester der Jüden zu Pilato [Chor 25b.]: Schreibe nicht: der Jüden König, sondern daß er gesaget habe: Ich bin der Jüden König“ – Bach verwendet hierfür übrigens den selben Chor wie zuvor schon bei „Sei gegrüßet, lieber Jüdenkönig!“ (21b.) -, woraufhin Pilatus antwortet (25c.): „Was ich geschrieben habe, das habe ich geschrieben.“
Was auf dem Kreuz steht, ist gewöhnlich der Grund („Titulus“) der Verurteilung, auch wenn der hier nicht zwingend ist: Er lautet in allen Evangelien „König der Juden“. Dennoch ist die Kreuzesinschrift in allen Evangelien anders notiert: Bei Markus (15,26) heißt es nur „König der Juden“ (15,26), bei Lukas (23,38) „Dieser ist der König der Juden“, während Matthäus schreibt: „Dieser ist Jesus, der König der Juden“ (37,37). Die Verbindung zu Nazareth in Galiläa taucht nur im Johannesevangelium auf und die Verbindung von Jesus dahin ist von dessen Verfasser womöglich nachträglich hergestellt worden.
Möglicherweise um einen universalen Anspruch herzustellen, betont Johannes, anders als die Synoptiker, dass die Inschrift in drei Sprachen erfolgte, obwohl die Mehrheit der Bevölkerung nur aramäisch sprach, kein hebräisch (das ist eine alte, eher liturgische Sprache) und griechisch wird dann in Ephesos gesprochen, wo das Evangelium entsteht.
Überhaupt stellt sich die Frage, weshalb es heißt: „König der Juden“? Denn bis 60 vor Christus, als die Römer die Region eroberten, hatten die Juden Könige und ihr Königreich einen Namen: es hieß Israel. Für sie hätte die Kreuzesinschrift entsprechend eigentlich „König von Israel“ lauten müssen, so wird Jesus laut dem Johannesevangelium ja auch bei seinem Einzug in Jerusalem begrüßt. Nur als Römer konnte man „König der Juden“ sagen, weshalb die Hohepriester im Evangelium nach Johannes (19,21-22) Pilatus auch gedrängt haben: „Schreibe nicht: Der König der Juden, sondern dass er gesagt hat: Ich bin der König der Juden.“ Die Hohepriester wollten damit, Johannes zufolge, deutlich machen beziehungsweise festschreiben, dass sie dem römischen Kaiser gegenüber loyal sind.
Gleichsam betont Johannes damit noch einmal, wie bereits anfangs ausgeführt, den Gegensatz zwischen Christen und Juden, wie er sich insbesondere zur Zeit der Verfassung des Evangeliums herauskristalliert hat. Insbesondere die johannitische Gruppe beziehungsweise johannäische Gemeinde steht in Rivalität zu „den Juden“ (auch wenn Johannes mit dieser Bezeichnung in erster Linie nur die Hohepriester meint) und die Christen werden zunehmend zu Außenstehenden und stehen unter einem gewissen Legitimations- oder Profilierungsdruck, der hier zum Ausdruck kommt.
Grablegung und Auferstehung (38.-40.)
Als Jesus gestorben war, erbittet Josef von Arimatäa von Pilatus, den Leichnam vom Kreuz nehmen und ihn ins Grab legen zu dürfen. Historisch betrachtet ist es ist nicht unwahrscheinlich, dass Gekreuzigte ihren Familien zurückgegeben werden, zumindest lag der einzige Gekreuzigte, der jemals gefunden wurde, Jochanam, in einem Einzelgrab und nicht in einem anonymen Massengrab. Auch Flavius Josephus berichtet von der Begnadigung zweier Gekreuzigter, die höchstwahrscheinlich ihren Familien zurückgegeben wurden.
Gemeinsam mit Nikodemus, der dem Johannesevangelium (19,38-42) zufolge „wohlriechende Salben“ aus „eine(r) Mischung aus Myrrhe und Aloe“ mitgebracht hat, wickeln sie den Leichnam in Leinenbinden ein, „wie es bei einem jüdischen Begräbnis Sitte ist“.
Hier endet die Handlung von Bachs Johannespassion. Die Passion selbst schließt er mit einem Schlußchor ab, bevor dann jedoch ungewöhnlicherweise noch ein Schlußchoral folgt (40., „Lieb Engelein…“). Der ist zwar trostvoll, die Gründe für den Choral nach dem eigentlichen Schlußchor jedoch sind unklar und können, wie Geck bemerkt, „auch der Wunsch jenes Leipziger Geistlichen gewesen sein, der die Textvorlage zu begutachten hatte. Allgemein gilt: Vokalwerke dieses Ausmaßes komponierte man in eine Aufführungssituation hinein …“, entsprechend flexibel war sicherlich auch Bach bei seiner Komposition.
Am Morgen nach der Abnahme Jesu vom Kreuz fand Maria das Grab leer vor. Anders als das Johannesevangelium, beschreibt das letzte Kapitel des Markusevangeliums (16,1), dass außer Maria noch zwei Frauen dabei waren, die „wohlriechende Öle“ bei sich hatten, um den Leichnam „zu salben“. Das erscheint seltsam, denn niemand wäre damals in Jerusalem auf die Idee gekommen, einen schon beerdigten Leichnam einzubalsamieren, das entsprach nicht der Begräbnissitte. Allerdings zeigt diese Szene, dass man dem Markusevangelium zufolge offensichtlich nicht darauf vorbereitet war, dass Jesus vor dem Ende der Zeiten auferstehen könnte. Das gilt ebenso für die Jünger, denn auch sie hatten, wie Johannes (20,9) bemerkt, „die Schrift, dass er von den Toten auferstehen müsse, (noch) nicht verstanden“.
Vermutlich glaubten Jesus` Jünger an die Auferstehung, allerdings erst zum Jüngsten Gericht. (Von „Auferstehung“ direkt wird im Neuen Testament dabei selten gesprochen, sondern öfter von „Erweckung“ und „Wunder“ bei den Aposteln, und auch der Begriff der „Erhöhung“ taucht im Psalm 110 sowie bei Lukas auf, der in Vers 24,51 schreibt, dass Jesus „in den Himmel emporgehoben wurde“.) Demgegenüber kennt das Alte Testament verschiedene Vorstellungen eines Lebens nach dem Tod, wobei sich die eigentliche Auferstehungsvorstellung, das heißt die Vorstellung vom Tod als Beginn eines neuen, ewigen Lebens, erst in der apokalyptischen prophetischen Literatur der hellenistischen Zeit (seit der Eroberung durch Alexander den Großen 332 vor Christus) findet. Nach griechischer Vorstellung lebt der Geist nach dem Tod weiter. Bis dahin jedoch glaubten nur die Pharisäer an eine Auferstehung, wie im Buch Daniel beschrieben, das von den alttestamentarischen Texten der wichtigste und unumstrittenste Beleg für eine Auferstehungsvorstellung ist. Entstanden in der Makkabäerzeit im 2. Jahrhundert vor Christus, während der Judenverfolgung durch den Griechen Antiochos IV., versucht Daniel hier (12,2) eine Antwort auf die Frage nach Gerechtigkeit angesichts der Martyriumserfahrungen der Gerechten: „Und viele von denen, die im Erdenstaub schlafen, werden erwachen, die einen zu ewigem Leben und die anderen zu Schmach, zu ewigem Abscheu.“
Die Auferstehung kann nur im Rahmen einer theologischen Logik und im Glauben verstanden werden. Aus dieser Perspektive „musste“ der Leichnam Jesu verschwinden, denn die Behauptung der Auferstehung impliziert, dass Jesus nicht mehr im Grab ist. In den kanonischen Evangelien ist sie allerdings eine Leerstelle, das heißt nur die apokryphen Evangelien beschreiben die Auferstehung selbst: Das Petrus-Evangelium, das zwischen 70 und 150 in Antiochia geschrieben wurde, ist der einzige urchristliche Text, der den Vorgang der Auferstehung beschreibt: Nachdem Jesus bestattet und sein Grab versiegelt wurde, ist im zehnten Kapitel eine Szene geschildert, in der die von Pilatus am Grab Jesu aufgestellten Wachen drei Männer aus dem Grab treten sehen, gefolgt von einem Kreuz. Als eine Stimme aus dem Himmel fragt: „Hast du den Toten gepredigt?“ kommt vom Kreuz her die Antwort: „Ja, das habe ich getan.“
Bevor Jesus „aufersteht“, so berichtet es Nikodemos in seinem apokryphen Evangelium (es wird auf Anfang des 4. Jahrhunderts datiert), ist er – „wie alle Helden der Mythologie“, wie Köhlmeier bemerkt – zunächst in die Unterwelt, das heißt die Hölle, „hinabgestiegen“. Über diesen Aufenthalt erfährt man in den Evangelien nichts. Dass er dort aber wenigsten zwei Tage war, bezeugt noch heute das apostolische Glaubensbekenntnis, wo es von Jesus heißt, er sei „hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel; er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters; von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten“.
Bevor Jesus allerdings in den Himmel fährt, erscheint er laut Johannesevangelium (20,11-18) zunächst Maria. Ihr verkündet er die sogenannte Auferstehungsbotschaft: „Geh aber zu meinen Brüdern und sag ihnen: Ich gehe hinauf zu meinem Vater …“
Für die Jünger ist unklar, weshalb der göttliche Wille durch den Tod Jesu am Kreuz ausgedrückt werden sollte, zumal das Reich Gottes noch nicht gekommen war. Da sie die Schrift nicht verstanden, wie Johannes sagt, „musste“ Jesus also noch leben. Entsprechend herrscht in diesem Zusammenhang in den Evangelien eine Art Terminologie des Lebens vor: In einem der ältesten Texte des Neuen Testaments, im Ersten Korintherbrief (geschrieben um das Jahr 56), schreibt Paulus von Erscheinungen Jesu – er ist also „erschienen“ (15,5) und wurde gesehen. Auch bei Lukas (24,5) erscheinen den Frauen am Grab schon zwei Engel die sie fragen: „Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten?“, bevor Jesus schließlich den Jüngern selbst erscheint, „obwohl die Türen verschlossen waren“, wie Johannes (20,26) bemerkt, der außerdem schreibt (20,20), dass „er ihnen die Hände und die Seite (zeigte); da freuten sich die Jünger, weil sie den Herrn sahen“.

Caravaggio, „Der ungläubige Thomas“ (1601-1602) – Jesus erscheint seinen Jüngern, die „erschraken aber und fürchteten sich und meinten, sie sähen einen Geist. Und er sprach zu ihnen: Was seid ihr so erschrocken, und warum kommen solche Gedanken in euer Herz? Seht meine Hände und Füsse: Ich selbst bin es. Fasst mich an und seht! Ein Geist hat kein Fleisch und keine Knochen, wie ihr es an mir seht.“ (Lukas 24,36-39)
Während in hellenistischer Vorstellung der Geist weiterlebt, bilden Körper und Seele im jüdischen Verständnis eine Einheit: Ohne Körper gibt es auch keinen Geist. Entsprechend wird der Leichnam von Jesus in den vier kanonischen Evangelien auch nicht als Geist dargestellt, sondern sein Körper trägt bei der Erscheinung bei den Jüngern die Stigma der Kreuzigung. Um den „ungläubigen Thomas“ zu überzeugen, der dieser Begegnung nicht beiwohnte, erscheint er ihnen laut Johannes (20,27) sogar ein weiteres Mal und fordert Thomas auf: „Leg deinen Finger hierher und schau meine Hände an, und streck deine Hand aus und leg sie in meine Seite, und sei nicht ungläubig, sondern gläubig!“ Das tat der ungläubige Thomas und verlor daraufhin alle Zweifel, worauf Jesus zu ihm sagte: „Du glaubst, weil du mich gesehen hast. Selig, die nicht mehr sehen und glauben!“
Jesus erscheint also als eine leibliche Gestalt, die durch geschlossene Türen gehen kann – wie ein Engel. Entscheidend ist dabei die theologische Bedeutung dieser Erscheinungen, denn Jesus erscheint offenbar nur denen, die an ihn glauben (nie seinen Feinden). Noch weitere Male erscheint er so, bevor er 39 Tage nach dem Ostersonntag, an „Christi Himmelfahrt“, in den Himmel auffährt, wo er „zur Rechten Gottes“ sitzt und zum Christus des Dogmas wird, seit im 4. Jahrhundert auf den ersten christlichen Kirchenversammlungen in der entstehenden Reichskirche die grundlegenden Vorstellungen von der Gottesschohnschaft Jesu dogmatisch fixiert wurden.
Epilog: Die Legende vom Kreuz
Bevor der ungläubige Thomas alle Zweifel verloren und seinen Glauben gefunden hat, weil er den verstorbenen Jesus gesehen hat, war er der Legende nach – wie uns Michael Köhlmeier in seinem (Hör-)Buch „Der Menschensohn“ (2001) erzählt – als Ingenieur in Jerusalem tätig. Geboren wurde Thomas mit einem anderen Namen: er hieß ursprünglich Judas. Da es jedoch viele Judas in Jerusalem gab, nannte man ihn Thomas, was soviel wie „Zwilling“ oder „Zweifler“ bedeutet. Und so ging Judas als Thomas der „Zweifler“ beziehungsweise der „Ungläubige“ in die Geschichten des Neuen Testaments ein.
Als Ingenieur, so erzählt es die Legende, übergab ihm Pontius Pilatus den Auftrag zum Bau einer Zisterne. Dabei machte er folgendes Erlebnis: Während der Grabungsarbeiten für die Wasserleitung fand man einen alten, steinharten und schwarzen Baumstamm in etwa zehn Meter Tiefe. Als Thomas den Holzstamm berührte, verfiel er der Melancholie und dem Trübsinn. Darüber verzweifelt, zog er seinen Bekannten Judas Iskariot ins Vertrauen, der ihn auf Jesus von Nazareth verwies: Er könne ihm bestimmt helfen, schließlich hat er auf der Hochzeit von Bartholomäus Wasser in Wein verwandelt und den Sohn des Hauptmanns von Kapernaun geheilt.
Thomas machte sich daraufhin auf den Weg und begegnete Jesus zum ersten Mal als er vor 5.000 Menschen predigte. Es war die sogenannte Bergpredigt, wie Matthäus sie nannte (bei Lukas fand sie in der Ebene statt), wo Jesus fünf Gerstenbrote und zwei Fische verteilte und die Menge damit sättigte – sehr wundersam in den Augen des Thomas, der sich kurzerhand entschloss, noch etwas bei den Jüngern und Jesus zu bleiben.
Dort erlebte er, wie Jesus eines Nachts Besuch bekam. Es waren die beiden Hohepriester Josef von Arimatäa und Nikodemus. Sie warnten Jesus vor dem Hohen Rat und Kaiphas, der ihm eine Falle stellen wolle. Und tatsächlich tauchen ein paar Tage später zwei Vertreter des Hohen Rates bei Jesus und seinen Jüngern mit einer Ehebrecherin auf und fragen Jesus vermeintlich um seinen Rat – er wisse ja genau, was im Gesetz stehe: Im Deuteronomium stehe, dass Ehebrecher und Ehebrecherin vor den Toren der Stadt gesteinigt werden sollen. Um eine Grund für seine Verhaftung zu haben, wollten die beiden Jesus provozieren, hat er doch stets Barmherzigkeit gepredigt („nicht wir richten, sondern Gott im Himmel“). Entweder er spricht nun gegen das Gesetz und läßt die Ehebrecherin ohne Strafe gehen – oder er widerspricht seiner eigenen Predigt … Jesus aber antwortete: „Dem Gesetz soll genüge getan werden“, setzte jedoch hinterher: „Wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein!“ Daraufhin verlassen die beiden vom Hohen Rat den Ort und Jesus schickt die Ehebrecherin nach Hause mit den Worten: „Sündige nicht mehr.“
Ein weiteres Mal ist Thomas tief beeindruckt – und fällt ein zweites Mal in Ohnmacht. Nachdem er sich vom Schwindel erholt hatte, wird Thomas endgültig zum Jünger und zum Zeugen von Jesus` Heilungen und Wundertaten. Er beginnt ein kommentarloses Protokoll zu führen, das später als apokryphes Thomasevangelium bekannt wird, aber in diesem Protokoll wird von keinem einzigen Wunder berichtet, es wird nur notiert, was Jesus gesagt hat – in 114 Logien, wie zum Beispiel: „Geben ist seliger als nehmen“, die man 1945 in einer nahezu vollständigen koptischen Übersetzung aus der Zeit um 350 nach Christus in Ägypten fand. Die Sammlung wurde nicht vom Jünger Thomas verfasst, gibt diesen aber als Autor an. Sie enthält keine Passions- und Auferstehungsgeschichte und wird daher nicht zu den kanonischen Texten des Neuen Testaments gezählt, obwohl es zwischen der Kreuzigung und kurz vor dem Jahr 200 verfasst wurde und damit als ältestes Evangelium gilt.
Wie sich herausstellt, so weiß es die „Legende vom Kreuz“ aus der „Legenda Aurea“ („Goldene Legende“) des Dominikaners Jacobus de Voragine aus dem Jahr 1264, war das Stück Holz, dass Thomas beim Bau der Zisterne fand, jenes Holz, aus dem dann das Kreuz für Jesus gemacht wird. Ursprünglich soll es sich hierbei um einen Ast vom Baum der Erkenntnis gehandelt haben, der vom König Salomon aufgrund einer Prophezeiung von Königin von Saba vergraben wurde und … sicherheitshalber wurde es von Pilatus nach der Kreuzigung tief vergraben. Dort sollte es wieder jahrhundertelang liegen, bis eines Tages die Frau eines römischen Kaisers am Vorabend einer Schlacht davon träumte, dass der Sieg nur errungen werden kann unter dem Zeichen des Kreuzes. Und sie träumte gleich mit, wo das Kreuz begraben lag. Tatsächlich konnte der Sieg errungen werden und das Christentum Staatsreligion im Römischen Reich werden. „Hier aber“, so schließt Michael Köhlmeier mit seiner Erzählung, „wird die Mythologie zur Geschichte … und es beginnt die Theologie.“